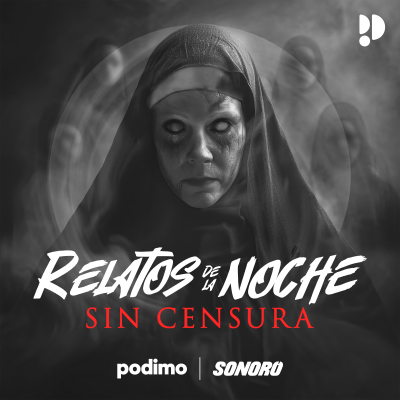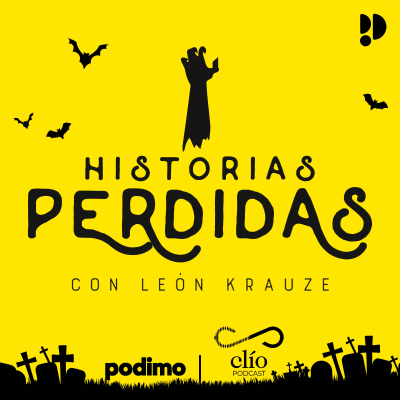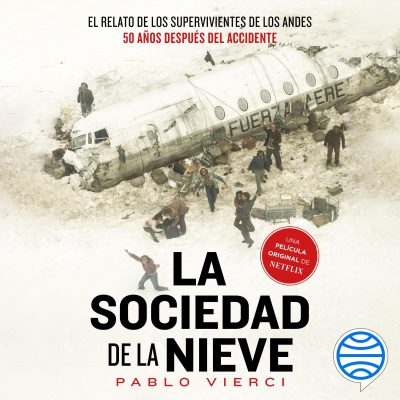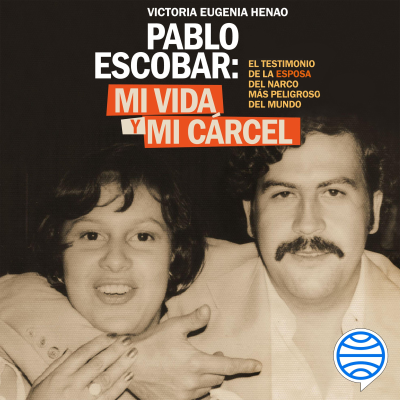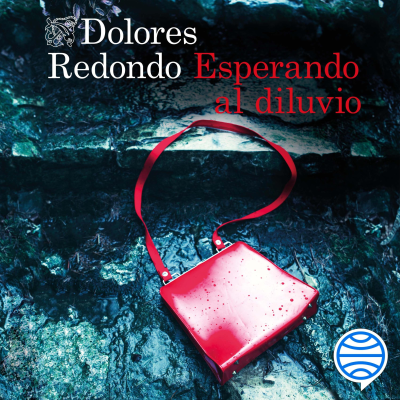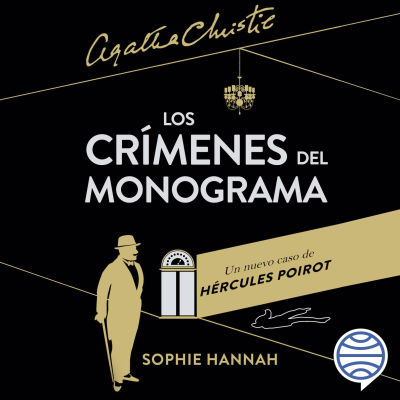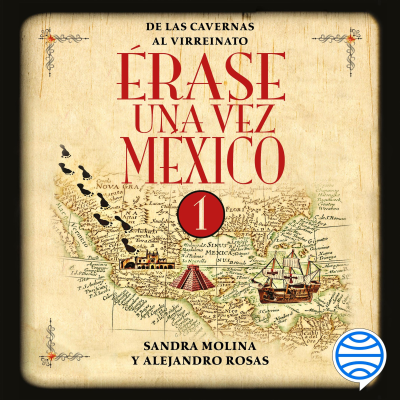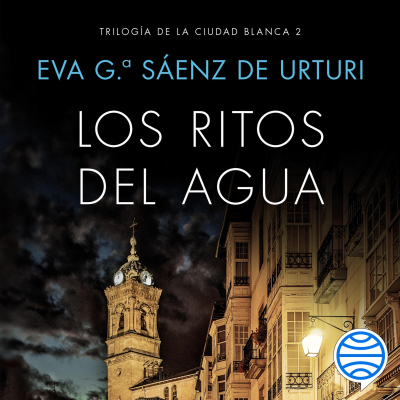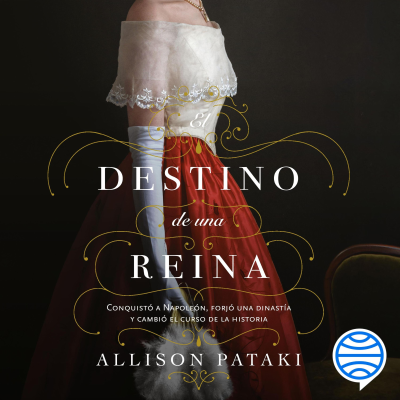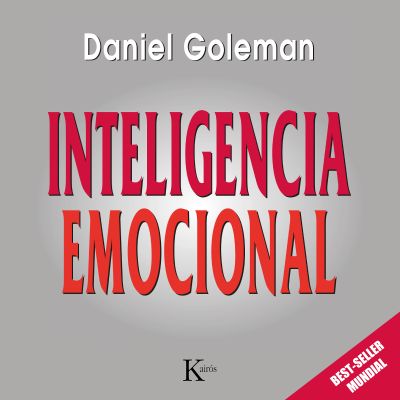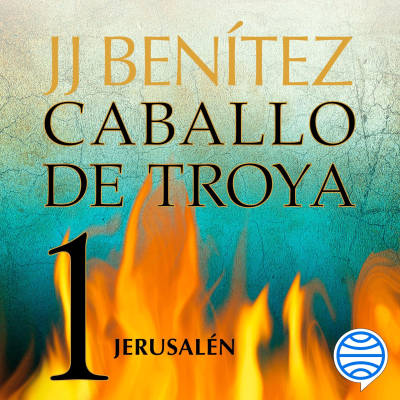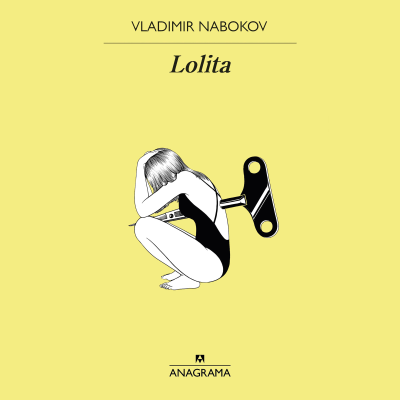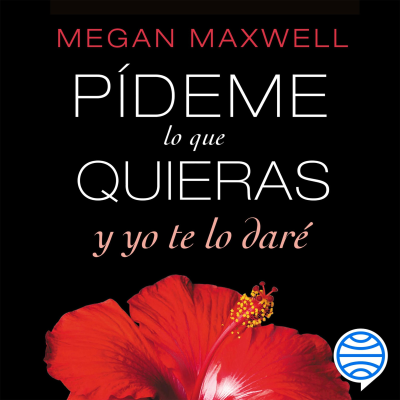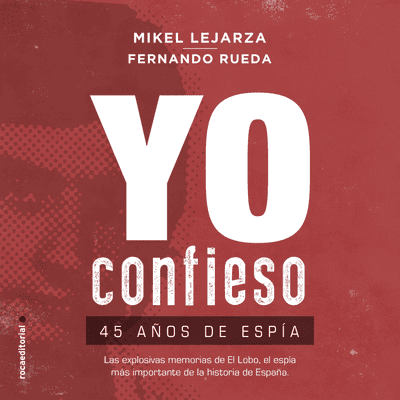NachDenkSeiten – Die kritische Website
Podcast de Redaktion NachDenkSeiten
Disfruta 7 días gratis
$99 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
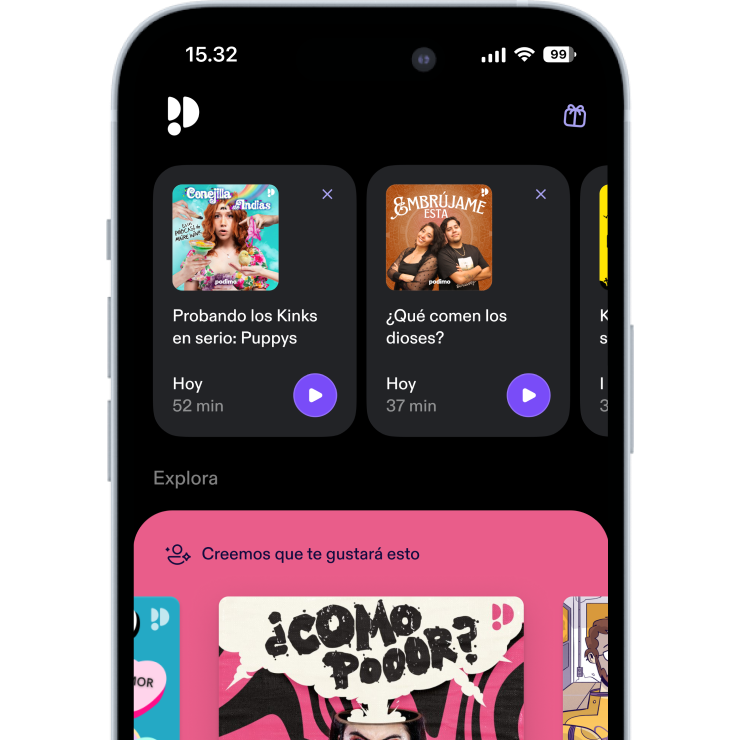
Más de 1 millón de oyentes
Podimo te va a encantar, y no sólo a ti
Valorado con 4,7 en la App Store
Acerca de NachDenkSeiten – Die kritische Website
NachDenkSeiten - Die kritische Website
Todos los episodios
4221 episodiosDer Terroranschlag auf die Pipeline Nord Stream 2 im September 2022 war ein beispielloser Angriff auf die deutsche Infrastruktur und Energieversorgung. Umso skandalöser ist die Untätigkeit, die die Ermittlungsbehörden bei dem Fall bisher an den Tag gelegt haben. Die nun vermeldete Verhaftung eines Verdächtigen wirft aber mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Es gibt neue Entwicklungen im Fall der Anschläge auf die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2, wie etwa die Berliner Zeitung in diesem Artikel berichtet [https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/sprengung-von-nord-stream-2-erste-verhaftung-in-italien-li.2350861]: Demnach hat die Bundesanwaltschaft in der Nacht zu Donnerstag aufgrund eines Europäischen Haftbefehls den ukrainischen Staatsangehörigen Serhii K. in der Provinz Rimini (Italien) festnehmen lassen, wie der Generalbundesanwalt (GBA) mitteilt. Der Beschuldigte sei des gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion (§ 308 Abs. 1 StGB), der verfassungsfeindlichen Sabotage (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 StGB) sowie der Zerstörung von Bauwerken (§ 305 Abs. 1 StGB) dringend verdächtig. Weitere Infos finden sich in dem oben verlinkten Artikel. Verschiedene Theorien zum Vorgang der Anschläge Es gibt verschiedene Theorien zum Vorgang der Anschläge und zur Herkunft der Täter: nichtstaatliche ukrainische Einzeltäter; ukrainische Täter mit Verbindungen zu staatlichen ukrainischen bzw. US-amerikanischen Stellen; – oder aber US-amerikanische Täter unter Anleitung eines US-Geheimdienstes. Die letzte Variante wird unter anderem vom US-Investigativ-Journalisten Seymour Hersh formuliert. Die erste Theorie der „nichtstaatlichen Einzeltäter“ wurde kurz nach den Anschlägen eher von westlichen Mainstream-Journalisten nahegelegt. Von dieser allzu unrealistischen Version haben sich manche deutsche Medien später aber wieder abgewandt – nachdem auch westliche Medien wie etwa das Wall Street Journal (WSJ) den Standpunkt vertreten hatten [https://archive.is/8LKeL#selection-2571.76-2571.124], dass die Nord-Stream-Attacken vom damaligen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte organisiert worden seien und auch Präsident Selenskyj der Operation (vorübergehend) grünes Licht gegeben habe. So entstand eine absurde Gleichzeitigkeit: Während auch große deutsche Medien über die im WSJ-Bericht unterstellte staatliche Mittäterschaft der Ukraine schrieben, verweigerten viele deutsche Journalisten trotzdem den Schritt, darum die weitere Unterstützung der Ukraine infrage zu stellen. Von den Fragen, die eine erwiesene Täterschaft eines US-Geheimdienstes aufwerfen müsste, mal ganz zu schweigen. Was die oben beschriebenen Theorien gemeinsam haben, ist, dass die Täter sehr wahrscheinlich im Kreise der „Verbündeten“ Deutschlands (Ukraine und/oder USA) zu suchen sind: Die zu Beginn von vielen deutschen Stimmen vertretene Variante, nach der Russland seine eigenen Pipelines gesprengt habe, ist mittlerweile weitgehend verstummt. Die aktuelle Verhaftung soll mutmaßlich die Version von der für den Anschlag genutzten Segelyacht (zumindest scheinbar) stützen. Die NachDenkSeiten sind in zahlreichen Artikeln auf die Nord-Stream-Anschläge und die skandalöse Verweigerung einer seriösen Aufklärung eingegangen, eine Auswahl der Beiträge finden Sie unter diesem Text. Reaktionen auf die Verhaftung Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, sagte der Berliner Zeitung [https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/botschafter-russland-verlangt-vollstaendige-aufklaerung-von-nord-stream-anschlag-li.2351022]: „Die russische Seite besteht weiterhin auf einer objektiven und vollständigen Ermittlung des Terroranschlages auf die Nord-Stream-Pipelines, der Feststellung und Ahndung der Täter und Organisatoren.“ Die Sprengungen seien „eklatante Akte des internationalen Terrorismus“. Die russische Nachrichtenagentur Tass schreibt laut Medienberichten: > „Laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow ist Moskau davon überzeugt, dass die Sabotageakte an der Nord-Stream-Pipeline mit US-Unterstützung durchgeführt wurden. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen eines Akts des internationalen Terrorismus eingeleitet.“ Die Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht, forderte einen Untersuchungsausschuss des Bundestags. Sie sagte der Berliner Zeitung, dieser „staatsterroristische Akt“ müsse konsequent aufgeklärt werden. Es sei „komplett abwegig, dass der nun Festgenommene und seine Mittäter ohne Rückendeckung der ukrainischen Führung und der damaligen Biden-Administration in den USA handelten“. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „sollte vor einem Untersuchungsausschuss im Bundestag aussagen müssen“. Es sei „völlig absurd, dass Deutschland viele Milliarden für Ukraine-Hilfen ausgibt, aber niemals Aufklärung von Selenskyj einforderte“. Auch die Frage nach einer Entschädigung müsse gestellt werden. Aufreizend ist angesichts des bisherigen Verhaltens der deutschen Ermittler zum Nord-Stream-Anschlag, wenn diese jetzt ihrerseits eine Aufklärung „einfordern“: So sprach Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) nach der nun bekannt gewordenen Festnahme in Italien laut AFP von einem „beeindruckenden Ermittlungserfolg“. Die Sprengung der Pipelines müsse aufgeklärt werden, „auch strafrechtlich“, betonte sie. Die Verhaftung wirft Fragen auf Der aktuelle Vorgang der Verhaftung eines ukrainischen Verdächtigen wirft meiner Meinung nach unter anderem die folgenden spekulativen Fragen auf: * Legt der Zeitpunkt der Verhaftung des Ukrainers während der aktuellen Friedensverhandlungen zwischen Russland und den USA nahe, dass damit nun die Ukraine zu Zugeständnissen im Verhandlungsprozess bewegt werden soll – indem droht, dass das Land demnächst (dann auch endlich ganz „offiziell“) als Terrorstaat identifiziert werden könnte und dadurch der „Heiligenstatus“ der Ukraine verloren geht? * Oder soll – im Gegenteil – durch die Verhaftung die umstrittene „Yacht-Theorie“ und damit eher eine Einzeltäterschaft radikaler Individuen ohne staatliche Kontakte gestützt werden? Und soll dadurch wiederum eine naheliegende Beteiligung/Führung des Anschlags durch US-Geheimdienste verschleiert werden? * Oder ist der jetzige Zeitpunkt der Verhaftung einfach nur Zufall und man sollte den europäischen Ermittlern ein Kompliment zu ihrem Erfolg machen? Titelbild: shutterstock / apprenticebk[https://vg09.met.vgwort.de/na/98891c529dd046d9af8e2d5a7876cf71] Mehr zum Thema: Der Scoop des Jahres: Reporter-Legende Seymour Hersh macht die USA und Norwegen für die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines verantwortlich [https://www.nachdenkseiten.de/?p=93548] Nord-Stream-Sprengung – neue Enthüllungen bringen die Bundesregierung in Zugzwang [https://www.nachdenkseiten.de/?p=119718] Ostseewasser sind tief – Neue Rechercheergebnisse zu den Nord-Stream-Anschlägen [https://www.nachdenkseiten.de/?p=129811] China und britische Versicherer glauben nicht an die offizielle Version zur Sprengung von Nord Stream [https://www.nachdenkseiten.de/?p=114565] BPK: Laut CIA-Quellen war Kanzler Scholz über Pläne zur Zerstörung von Nord Stream eingeweiht [https://www.nachdenkseiten.de/?p=104474] US-Außenminister Blinken zur Zerstörung von Nord Stream 2: „Dies bietet eine enorme strategische Chance für die kommenden Jahre“ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=88813] Nord-Stream: Die Terroristen haben (vorerst) gewonnen – Und niemanden kümmert’s [https://www.nachdenkseiten.de/?p=102299]
Zehn Staaten sollen laut Medienberichten bereit sein, Soldaten in die Ukraine zu senden – darunter Deutschland. Bei dem Vorhaben geht es um eine angebliche „Friedenssicherung“ für die Ukraine. Medien sprechen von einem „Pakt der Zehn“ [https://www.n-tv.de/politik/Bericht-Zehn-Laender-bereit-Truppen-in-Ukraine-zu-entsenden-article25975587.html], der noch diese oder nächste Woche fertiggestellt werden soll. Von Marcus Klöckner. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Der „Pakt der Zehn“ – so bezeichnen Medien ein politisches Vorhaben, das offensichtlich gerade hinter den Kulissen abgesprochen wird. Zehn Staaten – darunter Frankreich, Großbritannien und Deutschland – überlegen, bei einem Friedensabkommen Truppen in die Ukraine zu schicken. Über den Umfang der Soldaten genauso wie über die Stationierungsstandorte sei bereits gesprochen worden, berichtet der Nachrichtensender ntv. Der Pakt solle „in den kommenden Tagen, vorzugsweise noch diese Woche“, fertiggestellt werden. Der Sender stützt sich auf Aussagen von Antonio Costa, Präsident des Europäischen Rates. Der EU-Vertreter habe dies gegenüber Journalisten in Lissabon gesagt. Hintergrund des Vorhabens: Bei einem im Raum stehenden Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodomyr Selenskyj solle der ukrainische Präsident schon im Vorfeld in eine möglichst starke Verhandlungsposition gebracht werden. Ntv berichtet weiter, am Dienstag seien in zwei Gesprächsrunden Regierungschefs und EU-Beamte zusammengekommen, um Sicherheitsgarantien für die Ukraine auszuarbeiten. Zusätzlich fand ein Treffen hochrangiger Militärs aus den USA und Europa in Washington in Sachen Friedensabkommen statt. Dabei seien von US-Generalstabschef Dan Caine und europäischen Militärchefs „die besten Optionen für ein mögliches Friedensabkommen für die Ukraine“ erörtert worden, so ntv. Am Mittwoch folgte dann eine Zusammenkunft der Generalstabschefs der 32 NATO-Staaten. Der Oberbefehlshaber der NATO, US-General Alexus Grynkewich, wollte bei dem Treffen die Teilnehmer über die aktuelle Sicherheitslage im Hinblick auf die Ukraine-Gespräche informieren, heißt es von ntv unter Berufung auf den Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Guiseppe Cavo Dragone. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte laut ntv, der Umfang der deutschen Unterstützung im Rahmen der Sicherheitsgarantien müsse „politisch und militärisch“ festgelegt werden. Am Mittwoch bekräftigte [https://x.com/AussenMinDE/status/1958166360032239969] Außenminister Johann Wadephul zuvor geäußerte Standpunkte zur deutschen Ukraine-Politik auf der Plattform X: > Die #Ukraine braucht starke Sicherheitsgarantien & unsere Unterstützung. Wir müssen gemeinsam Druck auf #Russland machen und Putin verdeutlichen, dass wir weiter fest an der Seite der #Ukraine mit @ZelenskyyUa stehen. Darin war ich mir heute im Gespräch mit @andrii_sybiha einig. Titelbild: Ira.foto.2024 / shutterstock.com[http://vg04.met.vgwort.de/na/b61dc67c4cc642ebb4c007733f6b044c]
Die Berliner Staatsanwaltschaft nimmt Andreas Scheuer wegen möglicher Lügen im Maut-Untersuchungsausschuss ins Visier. Das ist gut so, passiert aber reichlich spät und erhellt nur einen winzigen Ausschnitt seines politischen Sündenregisters. Dass der CSU-Mann verurteilt wird und hinter Gittern landet, erscheint leider abwegig. Andernfalls müssten einige mehr prominente Fälle von Gedächtnisverlust im Amt justiziabel werden. Wie hieß noch der alte Bundeskanzler, fragt sich Ralf Wurzbacher. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Andreas Scheuer kann sich nicht erinnern. Also nicht an alles. Von dem Schlamassel mit der „Ausländermaut“, den er angerichtet hat, von dem weiß der Ex-Bundesverkehrsminister schon noch. „Dafür habe ich die politische Verantwortung – auch für andere – bereits übernommen“, sagte er am Mittwoch der Bild [https://www.bild.de/adblockwall.html]. Nun ja! Wenn „politische Verantwortung“ so viel, wenig oder gar nichts bedeutet wie „Schwamm drüber“ und „vergesst es einfach“, dann mag das sogar stimmen. Aber darum geht es jetzt nicht. Woran sich der frühere CSU-Spitzenpolitiker nicht entsinnen kann, sind Details der Begleitumstände, unter welchen das Projekt Pkw-Maut seinerzeit angebahnt wurde, und weswegen er jetzt, etliche Jahre später, durch die Berliner Staatsanwaltschaft angeklagt wurde. Konkret stellt sich die Frage, ob es da diese Offerte seitens des Betreiberkonsortiums gab, mit der Unterzeichnung der Verträge zuzuwarten, bis höchstrichterlich in der Angelegenheit entschieden ist. Zur Erinnerung: Im Juni 2019 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) ziemlich erwartungsgemäß den „diskriminierenden“ deutschen Sonderweg als rechtswidrig verworfen, mit dem ausländische Fahrer abkassiert und einheimische durch Senkung der Kfz-Steuer verschont werden sollten. Nur Stunden später annullierte das Verkehrsressort aus ordnungspolitischen Gründen und wegen vermeintlicher „Schlechtleistungen“ die Kontrakte, die ein halbes Jahr davor in einer Nacht-und-Nebel-Aktion hinter dem Rücken des Bundestages besiegelt und dann von einem ahnungslosen Parlament durchgewunken wurden. Kaffeeklatsch beim „Andi“ Der Spiegel hatte Monate später enthüllt, der Niederbayer habe sich mit Managern der Firmen Kapsch und Eventim im Oktober 2018 in dessen Ministerium zum Frühstück getroffen, und über das Stelldichein aus einem Gedächtnisprotokoll zitiert. Eventim-Vorstandsboss Klaus-Peter Schulenberg soll demnach angeregt haben, „mit einer Vertragsunterzeichnung bis zu einer Entscheidung des EuGH zu warten“. Scheuer habe das abgelehnt und stattdessen ein Gegenangebot gemacht, um den Preis zu drücken und zügig zu einem Geschäftsabschluss zu kommen. Zu diesem Vorgang wurden er und sein damaliger Staatssekretär Gerhard Schulz (parteilos) wiederholt vor dem Anfang 2020 zur Aufklärung der Affäre eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschuss befragt. Und jedes Mal beharrten beide darauf, sich partout nicht an die Sache erinnern zu können. Die Staatsanwaltschaft Berlin nimmt ihnen das nicht ab und hat gegen beide Anklage „wegen des Verdachts der Falschaussage“ [https://www.berlin.de/generalstaatsanwaltschaft/presse/pressemitteilungen/2025/pressemitteilung.1591145.php]erhoben. Laut einer Bekanntmachung vom Mittwoch soll der Schritt „aufgrund der sich aus dem Verfahrensgegenstand und der Position der Angeschuldigten ergebenden besonderen Bedeutung der Sache“ erfolgt sein. Bei erwiesener uneidlicher Falschaussage drohe eine „Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren“. Scheuer und Schulz sollen, heißt es weiter, im U-Ausschuss „entgegen ihrer tatsächlichen Erinnerung angegeben haben, sich an ein solches Verschiebungsangebot nicht erinnern zu können“. Zu fragen ist allerdings, wie das zu beweisen wäre und warum und was die Ermittler geschlagene drei Jahre ermittelt haben. Denn schon im April 2022 haben sie losgelegt und schon vor 15 Monaten war von einer unmittelbar bevorstehenden Entscheidung die Rede. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Können Psychologen plötzlich nachweisen, dass Scheuer an eingebildeter Demenz leidet, oder ist doch noch ein Tagebuch von ihm aufgetaucht, in welchem zu besagtem Termin vermerkt ist: „Kaffeeklatsch mit Mautkumpels. Wollen das Ding auf Eis legen. Daumen nach unten!“ Abwarten. Siegeszug der Unehrlichkeit Über Scheuers Verteidigungsstrategie besteht hingegen Klarheit. Wie sein Rechtsanwalt Daniel Krause der Presse sagte, habe sein Mandant eine „wahrheitsgemäße Aussage zu seiner tatsächlich nicht vorhandenen Erinnerung gemacht“ [https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-08/gescheiterte-pkw-maut-anklage-staatsanwaltschaft-berlin-andreas-scheuer]. Und „wer keine Erinnerung an einen Vorgang hat, muss und kann sich nur so äußern. Jede andere Äußerung wäre unrichtig.“ Logo. Aussetzer im Oberstübchen können dem Grundehrlichsten passieren. Und ergo könnte sich alles durchaus so zugetragen haben, wie die verhinderten Betreiber es darstellen, und Scheuer nur ein unwissender Lügner sein – der Arme. Muss aber auch nicht so sein. Das Magazin Multipolar hat jüngst einen lesenswerten Beitrag unter dem Titel „Auf Autopilot“ [https://multipolar-magazin.de/artikel/auf-autopilot] publiziert und die Frage aufgeworfen, „welches Ausmaß an Unehrlichkeit ist die Gesellschaft bereit zu akzeptieren? Wie viel Falschheit wird schweigend mitgetragen?“ Erst bei 9/11, den sogenannten Terroranschlägen gegen die USA, „später dann, noch viel massiver, bei Corona“, sei Unehrlichkeit zum „Grundrauschen der Politik“ geworden, „das die Dauerdepression unterfüttert und positive Zukunftsvisionen lächerlich erscheinen lässt“ und „kollektive Ohnmachtsgefühle“ befördere, konstatiert Autor Paul Schreyer. In Deutschland manifestiert und verhärtet sich diese gravierende Zäsur in der Wahrnehmung des Politischen in „Erinnerungslücken“ hochgestellter Amtsträger, die ganz offensichtliche und schwerwiegende Verfehlungen einfach damit abstreiten, von diesem und jenem einfach keine Kenntnis mehr zu haben. Da wären vorneweg Olaf Scholz (SPD) und seine Zusammenkünfte mit dem Hamburger Banker Christian Olearius, der um die Rückforderung seiner mit Cum-Ex-Machenschaften ergaunerten Beute herumkam: Von den Treffen wusste der Ex-Kanzler zunächst gar nichts, später dann nichts mehr über das, was hierbei besprochen wurde. Und Scholz kommt damit durch [https://www.nachdenkseiten.de/?p=104975]. Dabei ist es ihm offenkundig völlig egal, dass in der Bevölkerung eine Mehrheit der Ansicht sein dürfte, „der hat Dreck am Stecken“. Er tut einfach so, als wäre nichts gewesen, weil, es wurde ja nichts bewiesen – vor Gericht. Nur wird dort Politik nicht verhandelt, sondern in der Öffentlichkeit, und dafür braucht es eigentlich vor allem eines: Glaubwürdigkeit. „Abgrund von Ignoranz und Rechtsbruch“ Scheuer trieb und treibt das scham- und würdelose Treiben noch auf die Spitze. Die damalige Opposition aus Grünen, Linkspartei und FDP hielt in ihrem Sondervotum zum U-Ausschuss [https://www.nachdenkseiten.de/?p=73756] fest. „Nach der Vernehmung von 72 Zeugen und Sachverständigen in 24 Beweisaufnahmen bleibt man fassungslos zurück und blickt in einen politischen Abgrund von Ignoranz, Verantwortungslosigkeit, Bedenkenlosigkeit und Rechtsbruch – verbunden mit einem Erschrecken über mangelhaftes Regierungshandwerk.“ Er habe den „größtmöglichen Schaden für die Bundesrepublik in Kauf“ genommen, und bayerische Parteiinteressen „höher gewichtet als das Gemeinwohl“ und „dabei war die Grenze zwischen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit fließend“. Aber trotz erdrückender Beweislast gab es für ihn, im Sommer 2021, einen „Freispruch“ mit kleinen Schrammen und rückblickend grünes Licht für ein Vorgehen, das, wenn auch risikobehaftet, „vertretbar“ gewesen sei. 2023 bekam die BRD beziehungsweise der Steuerzahler die Quittung aufgetischt: 243 Millionen Euro Schadenersatz fürs „Risiko“ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=100936], obendrauf noch die Kosten eines jahrelangen Rechtsstreits, der mindestens 50 Millionen Euro verschlungen hat. Für nichts und wieder nichts blättert der Staat 300 Millionen Euro hin, weil ein sogenannter Staatsdiener sein Ego nicht im Zaum halten konnte. Oder: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) orderte 4,6 Milliarden Corona-Impfstoffdosen für 71 Milliarden Euro, wovon der Großteil nicht einmal produziert, aber bezahlt werden muss. Und löschte später den Mailverkehr mit Pfizer-Boss Albert Bourla zu dem windigen Deal. Um dann auch noch wiedergewählt zu werden an die EU-Spitze. War was gewesen? Generalamnesie Was macht so viel Verkommenheit mit und aus der Demokratie, aus der politischen Kultur im Land? Die Sorge befiel sogar ganz kurz einmal das politische Berlin, als eine Debatte aufflackerte, ob Politiker nicht für die Schäden, die sie verursachen, in Haftung genommen werden müssten. Aber dann entschied die Ampelregierung, von einer Regressklage gegen Scheuer abzusehen, und das Thema war ruckzuck vom Tisch beziehungsweise fiel der Vergessenheit anheim. Vergessen auch, dass der Komplex „Ausländermaut“ ein riesiges Komplott war und die Frage, ob Scheuer nun gelogen hat oder nicht, nur eine Petitesse ist. Wie hier [https://www.nachdenkseiten.de/?p=55679] von den NachDenkSeiten beschrieben, war das Projekt eine Auftragsarbeit neoliberaler Profitjäger, die perspektivisch eine allgemeine, sprich eine Maut für alle, durchsetzen wollten. Und dafür brachen Scheuers Mannen alle Regeln: Man mauschelte beim Vergabeverfahren (Staat muss draußen bleiben), trickste bei der Kostenkalkulation, führte den Bundestag hinters Licht und pfiff zu schlechter Letzt auch noch auf Rechtssicherheit. Läuft es schief, zahlt der Steuerzahler, was soll`s. Das alles hätte gereicht, Scheuer zehnmal vor die Tür zu setzen. Aber er klebte wacker weiter auf seinem Sessel und war sich nicht für noch viel mehr Skandale zu schade – einmal mehr, alle zum Vergessen. Ganz verheerend: Das Phänomen, für politisches Fehlverhalten nicht mehr geradestehen, keine persönliche Verantwortung mehr übernehmen zu wollen oder zu müssen, greift endemisch um sich. Längst vergessen die Zeiten, als Politiker von sich aus ihr Amt zur Verfügung stellten, um dasselbe zu schützen. Tritt heute überhaupt noch einer ab, was kaum noch geschieht, dann, weil er dazu „getreten“ wurde. Und dann sieht es der Geschasste auch nicht ein, weil das Maß für „richtig“ und „falsch“ nachhaltig verloren gegangen oder eben vergessen worden ist. Es wirkt so, als hätte die politische Klasse eine Generalamnesie erfasst, woraus sie eine Art von Generalamnestie ableitet. Motto: Wir erlauben uns alles, uns kann keiner was, unser Gewissen schon gar nicht. Spendier mir was … Apropos: „Andi“ Scheuer hat sein Bundestagsmandat vor mehr als einem Jahr aus freien Stücken niedergelegt. Im Vorfeld gründete er zwei Firmen und schon seit Herbst 2023 fungiert er als beratendes Mitglied, sprich Lobbyist, im Fachbeirat [https://www.mosolf-group.com/unternehmen/fachbeirat/] des Automobillogistikers Mosolf. Ende Januar berichtete der Spiegel (hinter Bezahlschranke) über eine „geheime Spenderliste“ mit Namen von Unternehmen, die Scheuers Kampagne im Bundestagswahlkampf 2021 mit „mindestens 132.000 Euro“ unterstützt hatten und sich im Gegenzug etwas von dem Bedachten wünschten. Eines bat „um politische Flankierung für eine größere Investition in Bayern“. Der Name des Gönners: Mosolf. Wer bei all dem noch auf die fixe Idee kommen sollte, bei den etablierten Parteien sein Kreuzchen zu machen: Vergessen Sie’s einfach! Titelbild: Grok – Das Titelfoto ist ein mit künstlicher Intelligenz erstelltes Symbolbild[http://vg09.met.vgwort.de/na/ae4d37ddc88f4b51aa0171cd8763af9e]
Empörenden Klartext zum Vasallen-Status von „Verbündeten“ gegenüber den USA hat kürzlich US-Finanzminister Scott Bessent gesprochen: Als Folge von Einigungen wie dem EU-Deal mit den USA könnten ausländische Werte laut Bessent bald indirekt wie ein US-„Staatsfonds“ und nach Ermessen des US-Präsidenten behandelt werden. Die ausbleibende Reaktion auf diese brutale „Offenheit“ unterstreicht die unterwürfige Haltung „unserer Politiker“. Diese Haltung muss sich ändern, der EU-Deal muss dringend neu verhandelt werden. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. US-Finanzminister Scott Bessent hat in einem Interview mit dem US-Sender Fox News kürzlich unter anderem gesagt, dass die USA Werte von Verbündeten wie Japan oder EU-Ländern nun indirekt wie einen amerikanischen „Staatsfonds“ behandeln würden. Die USA würden den Verbündeten „weitgehend nach Ermessen des [US-]Präsidenten“ Anweisungen geben, wie sie ihr Geld verwenden sollen, um US-amerikanische Fabriken zu bauen und US-amerikanische Industrien wieder ins Land zu holen, so Bessent. Sogar der Moderator von Fox News kann diese Aussage kaum glauben und spricht von „offshore appropriation“ (Aneignung ausländischer Werte) – er sei sich nicht sicher, ob es so etwas überhaupt schon einmal gegeben hätte. Der Ausschnitt mit deutschen Untertiteln findet sich unter diesem Link [https://x.com/katharina_munz/status/1955626450956206116]. EU-Milliarden für die USA Die aktuelle Haltung von Bessent deckt sich mit älteren Aussagen von US-Präsident Donald Trump bezüglich des kürzlich bekanntgewordenen, selbstzerstörerischen EU-Deals mit den USA [https://www.nachdenkseiten.de/?p=136577]. Trump hatte laut Medien [https://www.deutschlandfunk.de/trump-bezeichnet-zugesagte-eu-investitionen-als-geschenk-100.html] die von der EU im Rahmen des Zollabkommens zugesagten Investitionen von 600 Milliarden Dollar als „Geschenk“ bezeichnet. Er sagte im Sender CNBC, er könne das Geld der Europäischen Union in alles investieren, was er wolle. Falls die EU die Zusage nicht einhalten sollte, werde er Zölle in Höhe von 35 Prozent verhängen. Trumps Äußerungen standen laut Deutschlandfunk aber im Widerspruch zu damaligen Angaben der EU-Kommission. Diesen damaligen Angaben zufolge handele es sich bei den Investitionen um Interessenbekundungen von Unternehmen. Die Kommission als Behörde könne sie gar nicht garantieren. Welche Unternehmen Investitionsabsichten und in welcher Höhe bekundet hätten, teilte die Brüsseler Behörde laut dem Bericht nicht mit. Zusätzlich zu den 600 Milliarden Dollar hatte die EU Trump laut Medien zugesagt, binnen drei Jahren amerikanische Flüssiggas-, Öl- und Kernenergieprodukte im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen. Dazu kommt aktuell noch die US-Forderung, dass EU-Europa den „Löwenanteil“ bei den „Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine übernehmen solle [https://www.welt.de/politik/ausland/article68a4f9aa9886663123aa2ef4/Ukraine-Krieg-Europa-muss-laut-US-Vizepraesident-Loewenanteil-der-Last-bei-Sicherheitsgarantien-uebernehmen-Liveticker.html]. „Übergriffige Frechheit“ Das BSW hat zu den Äußerungen von US-Finanzminister Bessent aktuell erklärt [https://x.com/Buendnis_SahraW/status/1958133641491489092]: > „Selten dürfte ein US-Finanzminister die kolonialen Ansprüche der #USA [https://x.com/hashtag/USA?src=hashtag_click] gegenüber seinen ‚Verbündeten‘ offener ausgesprochen haben. (…) Der US-#Finanzminister [https://x.com/hashtag/Finanzminister?src=hashtag_click] wünscht unverhohlen eine koloniale Plünderung. Den deutschen #Medien [https://x.com/hashtag/Medien?src=hashtag_click] ist dieses bemerkenswerte Interview noch nicht einmal eine Meldung wert. Wie kann das sein? Tatsächlich haben die USA ihre europäischen Verbündeten gerade dazu gebracht, 5 Prozent des BIP für US-Kriege auszugeben, für eine dreiviertel Billion Euro überteuertes US-Frackinggas zu kaufen und weitere zig Milliarden in den USA zu investieren. Die #Bundesregierung [https://x.com/hashtag/Bundesregierung?src=hashtag_click] und die #EU [https://x.com/hashtag/EU?src=hashtag_click] dürfen sich von den USA nicht jede übergriffige Frechheit gefallen lassen.“ EU-Deal mit USA kann und sollte noch gestoppt werden Ja: Wo bleiben jetzt die empörten Reaktionen von US-„Verbündeten“ auf das aktuelle Interview, die einen solchen Umgang streng zurückweisen? Oder handelt es sich bei den aktuellen Aussagen von Bessent (und zuvor auch von Trump) nur um aufgebauschte Sprücheklopferei, mit der die US-Politiker beim eigenen Publikum im Inland punkten wollen? Schließlich stellt die EU-Kommission die Dinge anders dar und der EU-Deal mit den USA muss erst noch umgesetzt werden. Aber selbst in dem Fall, dass es sich bei den Äußerungen „nur“ um Eigen-PR von US-Politikern handeln sollte, müsste trotzdem der von den US-Politikern gewählte koloniale Ton öffentlich vonseiten der Bundesregierung und der EU-Kommission scharf gerügt werden. Der EU-Deal kann noch in den nationalen Parlamenten und im EU-Parlament gestoppt werden [https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/zollstreit-usa-trump-eu-100.html] – die US-Reaktionen wären dann vermutlich hohe Zölle. Ein Wirtschaftskrieg der EU mit den USA sollte wenn irgend möglich verhindert werden. Aber: Die aktuellen Äußerungen des US-Finanzministers sollten trotz der US-Zoll-Drohungen eine zusätzliche Motivation darstellen, den „EU-Deal“ mit den USA in der angekündigten Form nicht einzugehen – er muss neu verhandelt werden. Titelbild: Screenshot/Fox News Mehr zum Thema: EU beschließt Selbstzerstörung: Durch Sanktionen und US-Unterwerfung [https://www.nachdenkseiten.de/?p=136577] An das EU-Parlament und die Nationalstaaten: Bitte stoppen Sie noch den zerstörerischen EU-Deal mit den USA [https://www.nachdenkseiten.de/?p=136633] [https://vg09.met.vgwort.de/na/050b1f1ba17b4a908abdb235ff60dbd0]
Im und um den Libanon wird gestritten. Der kleine Zedernstaat am östlichen Rand des Mittelmeeres kommt auch Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit vom französischen Mandat nicht zur Ruhe. Das Mandat, autorisiert vom damaligen Völkerbund, dauerte von 1920 bis 1943. Doch die französischen Truppen zogen erst 1946 ab. Von Karin Leukefeld. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Irgendwie ist Frankreich allerdings nie ganz gegangen. Die koloniale „Fürsorge“ der Regierungen in Paris hat ihre Spuren hinterlassen. In manchen Privatschulen wird auf Französisch unterrichtet, das französische Schulsystem gilt im ganzen Land. Frankreich erteilt Ratschläge, wie besser regiert werden sollte, unterstützt Strafmaßnahmen (Sanktionen) bei „Fehlverhalten“ und bietet – bei „Wohlverhalten“ – wirtschaftliche Hilfe, um dem Zedernstaat aus Dauerkrisen zu helfen. Die französische Politik ist in gewisser Weise zum Standard gegenüber dem Libanon geworden, auch in Berlin und London sieht man im Zedernstaat keinen unabhängigen, souveränen Staat und vollwertiges UN-Mitglied und mischt sich wie selbstverständlich in die inneren Angelegenheiten ein. Ähnlich die Haltung der USA und verbündeter arabischer Staaten, mit dem Nachbarland Israel befindet der Libanon sich nach zahlreichen israelischen Besetzungen im Kriegszustand. Viele der Dauerkrisen sind darauf zurückzuführen, dass das französische Mandat dem Libanon ein politisches System hinterließ, in dem nicht nationale und staatliche Unabhängigkeit im Mittelpunkt stand und steht. Vielmehr definiert per Gesetz die Zugehörigkeit zu einer Religion die Rechte der Libanesen. Und wie bei allen Staaten der Region sind die Krisen und Kriege auch im Libanon auf die kolonial-imperiale Zerteilung während und nach dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) zurückzuführen. Wichtige Faktoren dieser Entwicklung waren das Sykes-Picot-Abkommen (1916) [https://www.britannica.com/event/Sykes-Picot-Agreement], die Balfour-Erklärung (1917) [https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-balfour-deklaration-von-1917-wer-hat-wem-was-versprochen-100.html] sowie die Vertreibung der Palästinenser [https://www.lib-hilfe.de/infos_ausstellung.html], um den Staat Israel zu errichten (1948). Die UN-Interimsmission für den Libanon, UNIFIL Libanon steht aktuell im UN-Sicherheitsrat ganz oben auf der Agenda. Es geht um die Verlängerung des Mandats der UN-Interimsmission, UNIFIL. Frankreich ist im Sicherheitsrat als „Penholder“ [https://www.securitycouncilreport.org/research-reports/the-penholder-system.php] für den Libanon zuständig. Das bedeutet, wann immer der Libanon auf der Tagesordnung steht, spricht Frankreich zuerst und übernimmt alle notwendigen Initiativen bezüglich der jeweiligen Debatte. Das UNIFIL-Mandat wird jährlich verlängert. Die aktuell 10.509 Soldaten der Mission kommen aus 47 Ländern. Deutschland beteiligt sich an der UNIFIL-Mission mit bis zu 300 Soldaten und Soldatinnen und leitet die maritime, die seeseitige Mission, um illegale Waffenlieferungen in das Land zu stoppen. Zudem bildet Deutschland die libanesische Marine aus. Das aktuelle UNIFIL-Mandat [https://unifil.unmissions.org/unifil-mandate] endet am 31. August und soll auf Antrag des Libanon um ein weiteres Jahr bis zum 31. August 2026 verlängert werden. Die UN-Mission kontrolliert den Südlibanon seit 1978, um den Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon zu überwachen, die Teile des Landes besetzt hatten (UNSR-Resolutionen 425, 426, 1978). Im Jahr 2000 – nach dem Rückzug der israelischen Truppen, den die libanesische Hisbollah mit zahlreichen Guerillaoperationen befördert hatte – zog UNIFIL die „Blaue Linie“, eine libanesisch-israelische Waffenstillstandslinie, um den israelischen Rückzug zu bestätigen. Das von UNIFIL kontrollierte Gebiet befindet sich zwischen dieser „Blauen Linie“ und dem ca. 30 Kilometer nördlich verlaufenden Fluss Litani. Im Jahr 2006 – nach einem erneuten Krieg zwischen Israel und Libanon/Hisbollah – wurde dieses UNIFIL-Mandat vom UN-Sicherheitsrat erweitert mit der UNSR-Resolution 1701. Danach soll der Rückzug der israelischen Truppen überwacht und die Autorität der libanesischen Regierung unterstützt werden. Zudem sollen in dem Gebiet zwischen der „Blauen Linie“ und dem Litani ausschließlich die Libanesische Armee und UNIFIL über Waffen verfügen. Mit anderen Worten: Weder die israelische Armee – die abziehen muss – noch die libanesische Hisbollah, Amal-Bewegung oder andere nichtstaatliche bewaffnete Organisationen sollen in dem Gebiet über Waffen verfügen. Die Waffen sollen der libanesischen Armee übergeben werden. Im November 2024 – nach einem Jahr Krieg zwischen Israel und Libanon/Hisbollah – änderte sich das UNIFIL-Mandat erneut. Das Abkommen zur Beendigung der Gewalt, das die USA und Frankreich zwischen Israel und Libanon/Hisbollah ausgehandelt hatten, beendete offiziell die beidseitigen Angriffe, die von September 2024 bis Ende November 2024 das Ausmaß eines Krieges erreicht hatten [https://www.nachdenkseiten.de/?p=118916]. Die Gewalt zwischen Libanon/Hisbollah und Israel hatte am 8. Oktober 2023 mit der Entscheidung der Hisbollah begonnen, die Palästinenser im Gazastreifen zu unterstützen. Diese wurden seit dem 7. Oktober 2023 von der israelischen Armee bombardiert. Israel reagierte auf einen Angriff palästinensischer Kämpfer am Morgen des 7. Oktober 2023 am gleichen Tag mit dem Bombardement ziviler Infrastruktur im palästinensischen Gazastreifen. Das Abkommen zur Beendigung der Gewalt Mit dem Abkommen zur Beendigung der Gewalt wurde der ursprüngliche UNIFIL-Mechanismus verändert. Ein Militärrat unter Vorsitz der USA kontrolliert nun die Situation im Südlibanon, mit dabei Frankreich, die libanesische Armee und die israelische Armee. UNIFIL ist Gastgeber. Der zwischen 2006 und 2024 bestehende Mechanismus aus Dreiertreffen von Militärs aus Israel, Libanon und von UNIFIL, um Konflikte entlang der „Blauen Linie“ zu besprechen und zu klären, war außer Kraft gesetzt. Laut der libanesisch-israelischen Vereinbarung [https://www.peaceagreements.org/media/documents/IL_LB_241126_Announcement_of_a_Cessation_of_Hostilities_and_Related_Commitments.pdf] sollten seitens Israel keine militärischen Angriffe mehr auf libanesisches Territorium verübt werden. Die libanesische Regierung ihrerseits sollte Hisbollah und andere bewaffnete Gruppen daran hindern, Ziele in Israel anzugreifen. „Inoffizielle“, d.h. nichtstaatliche militärische Infrastruktur sollte von der libanesischen Armee entfernt, nichtstaatliche Waffen sollten beschlagnahmt werden. Sowohl Israel als auch libanesische Medien berichteten allerdings von einer bilateralen Vereinbarung zwischen den USA und Israel, womit Israel das Recht zugestanden wird, auf „Bedrohungen“ durch die Hisbollah zu reagieren. Davon hat Israel ausgiebig und täglich, manchmal mehrmals am Tag Gebrauch gemacht. Innerhalb eines Monats (Dezember 2024) wurden in den Orten im Südlibanon mindestens 800 Häuser und Gebäude gesprengt. Mehr als 4.000 Mal bombardierte Israel seit Inkrafttreten des Abkommens Ziele im ganzen Libanon, einschließlich Beirut. Mehr als 200 Personen wurden seit Beginn des Abkommens zur Beendigung der Gewalt gezielt getötet. Extreme Siedler aus dem Libanon wollen den Südlibanon bis zum Litani-Fluss besiedeln [https://www.middleeasteye.net/news/israeli-settler-group-advertises-new-properties-southern-lebanon]. Mitte Februar zogen die israelischen Truppen von zahlreichen Stellungen aus dem Südlibanon ab, halten seitdem aber fünf Hügel und zwei Pufferzonen besetzt. Mindestens 98 Mal operierten israelische Truppen von dort aus in libanesische Ortschaften hinein, heißt es in einem UN-Bericht. Sie blockieren die Rückkehr der Bevölkerung und die Stationierung der libanesischen Armee. Opfer israelischer Angriffe gibt es sowohl unter der libanesischen Zivilbevölkerung als auch unter Soldaten der libanesischen Armee. Auch Mitglieder der Hisbollah werden gezielt getötet. Bis Ende Juni 2025 hat die libanesische Armee nach UN-Angaben 116 Positionen südlich des Litani eingerichtet und insgesamt 7.522 Soldaten stationiert. Waffenlager und unterirdische Stellungen, auch Tunnel wurden gefunden und geräumt. UNIFIL wurde und wird immer wieder in der Arbeit behindert. Aufgebrachte Bewohner vermuten in den Aktivitäten der internationalen Truppe verdeckte Spionage ausländischer Staaten. Israelische Truppen haben UNIFIL-Stellungen während des Krieges wiederholt direkt unter Feuer genommen und die UN-Blauhelme aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, weil sie der Hisbollah Deckung gäben. UNIFIL blieb. Libanon beantragt die Verlängerung des UNIFIL-Mandats Der Antrag der libanesischen Regierung vom Juni 2025, das UNIFIL-Mandat um ein weiteres Jahr zu verlängern, entspricht dem Mehrheitswillen im Libanon über politische Grenzen hinweg. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat im Juli 2025 dem UN-Sicherheitsrat empfohlen, das Mandat um ein Jahr zu verlängern. Die UN-Generalversammlung hat bereits ein Budget für die Verlängerung der Mission bewilligt. Die Resolution zur Verlängerung des UNIFIL-Mandats wurde in der Generalversammlung von 147 Staaten angenommen. Drei Staaten stimmten dagegen, es gab eine Enthaltung. Israel und die USA wollen ein Ende des UNIFIL-Mandats. Israel hat das wiederholt öffentlich erklärt, wirbt dafür bei Verbündeten und hat UNIFIL-Posten direkt angegriffen. US-Präsident Donald Trump hat die Gelder, die von UN-Mitgliedsstaaten für UN-Friedensmissionen und auch für UNIFIL eingezahlt werden, für 2025 gekürzt und für 2026 nicht bewilligt. Begründet wurde das u.a. mit „Unzufriedenheit über UNIFIL“, wie einem UN-Bericht zu entnehmen ist [https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2025-08/lebanon-34.php?utm_medium=email&utm_campaign=The%20Week%20Ahead%2018-22%20August%202025&utm_content=The%20Week%20Ahead%2018-22%20August%202025+CID_6453945b32e04c1c65b64bbf6db8ace5&utm_source=Email%20Newsletter&utm_term=Lebanon]. Die Mitglieder im UN-Sicherheitsrat unterstützen mehrheitlich die Verlängerung der UNIFIL-Mission und betonen dabei die stabilisierende Funktion der UNIFIL im Südlibanon. Frankreich hat vorgeschlagen, dass die fünf Positionen, die israelische Truppen im Südlibanon besetzt halten, von UNIFIL-Truppen kontrolliert werden könnten. Die UN-Resolution 1701 allerdings sieht vor, dass das gesamte Gebiet – einschließlich der fünf israelisch besetzten Positionen – von der libanesischen Armee kontrolliert werden sollen. Scharfe Unterschiede gibt es laut UN bei den Sicherheitsratsmitgliedern hinsichtlich der Einstufung der Hisbollah. Manche unterscheiden zwischen dem militärischen und politischen Flügel der Organisation und haben deren militärischen Teil als „Terrororganisation“ gelistet. Andere, beispielsweise Russland, stufen Hisbollah als „legitime sozialpolitische Kraft im Libanon“ ein. Russland und China lehnen eine Einmischung des Sicherheitsrates in die internen politischen Angelegenheiten des Libanon ab. Die Hisbollah verfügt über große Unterstützung im Libanon, ist im Parlament vertreten und auch in der Regierung. Eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrates über die Mandatsverlängerung wird spätestens in der kommenden Woche erwartet. Teile und herrsche Thomas Barrack, US-Botschafter in der Türkei seit Mai 2025 und US-Sonderbeauftragter für Syrien und Libanon, hat bei zahlreichen Regierungsgesprächen in Beirut den Druck auf die libanesische Regierung erhöht. Zusätzlich zu der UN-Sicherheitsratsresolution 1701 – die die Entwaffnung nichtstaatlicher Akteure im Südlibanon und den vollständigen Rückzug israelischer Truppen vorsieht – solle die Regierung einen Beschluss herbeiführen, die Hisbollah komplett zu entwaffnen. Dann werde die USA Israel drängen, sich aus dem Libanon zurückzuziehen und die Angriffe einzustellen. Unklar ist bis heute, ob Israel dem zustimmt. Als Vorlage für einen solchen Regierungsbeschluss legte Barrack einen Vier-Phasen-Plan [https://globalbridge.ch/libanon-im-visier-zuckerbrot-und-peitsche-fuer-den-zedernstaat/] vor, der bis Ende des Jahres 2025 umgesetzt werden solle. In diesem US-Plan sind elf Klauseln enthalten, wie der Libanon seine Grenzen mit Israel und Syrien festlegen solle. Wenn alles so umgesetzt werde wie in dem Plan aufgeschrieben, würden die USA, Frankreich und arabische Golfstaaten einen Wirtschaftsgipfel organisieren, um die Wirtschaft des Libanon und den Wiederaufbau zu unterstützen. Für die libanesische Armee wird „militärische Hilfe“ zugesagt. In einem Interview mit der Zeitung The National [https://www.thenationalnews.com/news/us/2025/07/11/tom-barrack-lebanon-hezbollah/] erklärte Barrack wenig später, sollte der Libanon den Plan nicht schnell umsetzen, werde die Entwicklung über das Land hinwegziehen und es werde wieder zu „Bilad al Sham“ werden. Das war der historische Name Syriens und bedeutet mit anderen Worten, Libanon werde wieder Teil Syriens oder von Syrien eingenommen. „Die Syrer sagen, Libanon ist ihr Badestrand“, so Barrack. Innerlibanesische Angelegenheit In Gesprächen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun als auch in wiederholten öffentlichen Stellungnahmen hatte Hisbollah erklärt, in Zusammenarbeit mit Regierung und Armee im Libanon die Übergabe der Waffen zu regeln. Allerdings sei das eine innerlibanesische Angelegenheit und man werde auf keinen Fall unter Zeitdruck handeln. Bis zum Litani-Fluss sind die Waffen weitgehend unter der Kontrolle der libanesischen Armee, die Kampfverbände der Hisbollah haben sich und schwere Waffen in das Gebiet nördlich des Litani zurückgezogen. Diese Waffen werde Hisbollah nicht abgeben, solange Israel weiter im Libanon angreift und tötet, Gebiete im Südlibanon besetzt hält und den Rückzug verweigert, so die Organisation. Hisbollah zu entwaffnen bedeute, das Land schutzlos Israel zu überlassen, so Hisbollah-Chef Naim Qassem [https://english.almanar.com.lb/2477092] anlässlich des religiösen schiitisch-muslimischen Gedenktages Arbaeen. Wenn nötig, werde der Widerstand (Hisbollah) kämpfen, „wie Imam Hussein in Kerbala kämpfte“ [https://www.zvab.com/schiitische-Islam-Heinz-Halm-C.H-Beck/31954292381/bd]. Die Vereinbarung zur Beendigung der Gewalt wird von Hisbollah eingehalten, was von verschiedenen Seiten einschließlich UNIFIL bestätigt wird. Die libanesische Regierung und die Libanesen Ministerpräsident Nawaf Salam und verschiedene Medien werfen Naim Qassem vor, einen Bürgerkrieg zu befeuern. Tatsächlich ist die Lage im Libanon vor allem entlang der religiösen Gruppen sehr angespannt. Manche werfen der Hisbollah vor, Marionetten des Iran zu sein, und fordern schiitisch-muslimische Libanesen auf, den Libanon zu verlassen und in den Iran zu gehen. Das erinnert an das westdeutsche Motto „Geht doch nach drüben“ [https://www.globkult.de/politik/besprechungen/1791-frank-blohm-geh-doch-rueber-revisited-ein-ost-west-lesebuch]. Der Konflikt ist ein anderer. Tatsächlich gehören Schiiten ebenso wie alle anderen Religionsgruppen zur libanesischen Gesellschaft. Sie werden gewählt und sind im Parlament sowie in der Regierung vertreten. Die Frage der Bewaffnung der Hisbollah ist eine Antwort auf die israelische Invasion im Libanon und Massaker an palästinensischen Flüchtlingen in Beirut 1982. Nicht nur für libanesische Schiiten sind die Waffen der Hisbollah gegen Israel gerechtfertigt, solange Israel seine expansionistische Politik gegenüber den Völkern der Levante nicht stoppt. Sie sind gerechtfertigt, weil die libanesische Armee schwach und schlecht ausgebildet ist und die Libanesen – im ganzen Land – nicht vor israelischen Angriffen schützen kann. Auch die libanesischen Regierungen werden allgemein als schwach, korrupt und abhängig von den USA, Frankreich oder Saudi-Arabien abgelehnt, zumal die Sorge um die Menschen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Schutz auch gegen israelische Angriffe nicht gewährleistet sind. Die Libanesen helfen sich seit Jahrzehnten selbst. Sie überleben und leben, weil ihre Familienangehörigen, die in vielen Ländern der Welt arbeiten, ihre Verwandten im Libanon unterstützen. Hilfe vom Staat gibt es nicht. Wem nutzt es Nach den Drohungen Tom Barracks, die Existenz des Libanon sei gefährdet, wenn es den Plan zur Entwaffnung nicht umsetze, reagierte Ministerpräsident Nawaf Salam, der Regierungschef, sofort. Entgegen anderen Vorschlägen, auch seitens Präsident Joseph Aoun, legte Salam der Regierung den Plan des Tom Barrack zur Abstimmung vor. Die Minister der verbündeten (schiitischen) Amal-Bewegung und Hisbollah verließen vor der Abstimmung die Sitzung unter Protest. Die verbliebenen Regierungsmitglieder verabschiedeten den Barrack-Plan einstimmig. Der US-amerikanische Druck und die fortgesetzten israelischen Angriffe haben nicht nur die libanesische Regierung entzweit, sondern auch die libanesische Bevölkerung gespalten. Teile der libanesischen Medien, vor allem aber die „sozialen Medien“ befördern mit Hetze, Vorwürfen, falschen Behauptungen, mit religiösen, sektiererischen Anfeindungen die gesellschaftliche Spaltung. Beobachter verschiedener Lager sprechen von der Möglichkeit eines erneuten Bürgerkrieges. Israel nutzt das, um seine Drohungen zu verschärfen. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz warnte [https://english.aawsat.com/arab-world/5151476-israel%E2%80%99s-katz-warns-more-lebanon-strikes-if-hezbollah-not-disarmed], es werde „ohne Sicherheit für den Staat Israel keine Ruhe in Beirut geben, keine Ordnung oder Stabilität im Libanon“. Wenn der Libanon nicht tue, „was verlangt wird, werden wir weiter handeln und mit großer Gewalt“. Titelbild: Hiba Al Kallas / Shutterstock
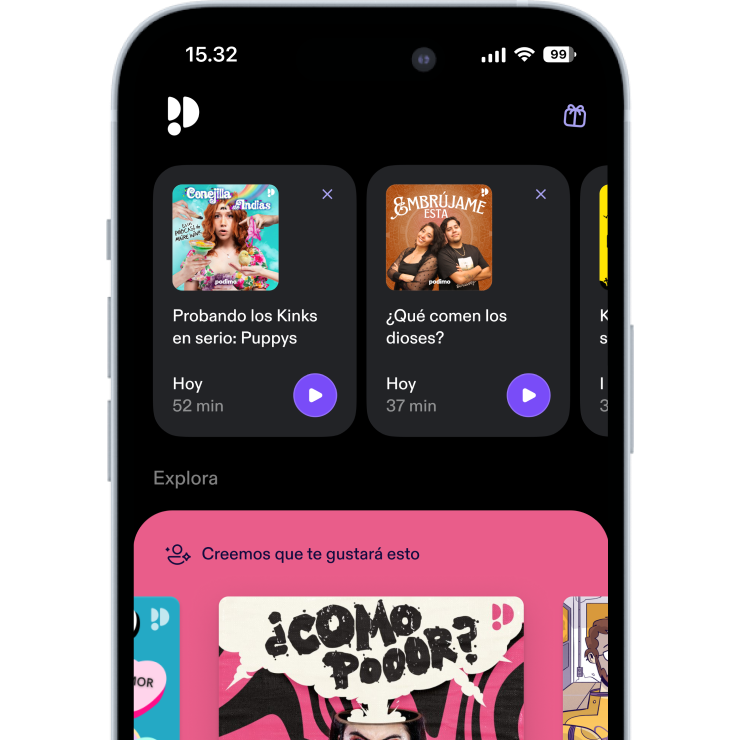
Valorado con 4,7 en la App Store
Disfruta 7 días gratis
$99 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
Podcasts exclusivos
Sin anuncios
Podcast gratuitos
Audiolibros
20 horas / mes