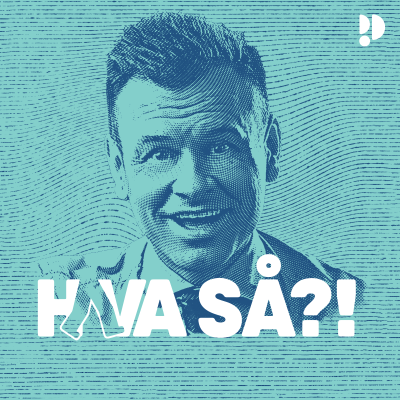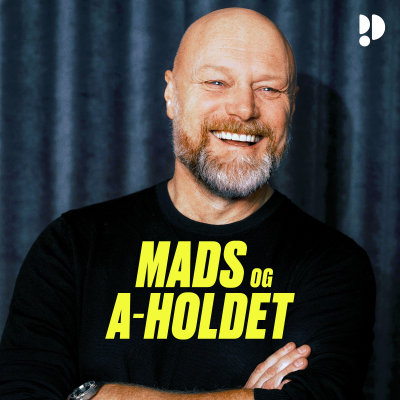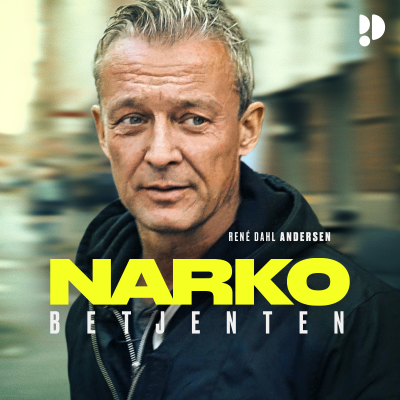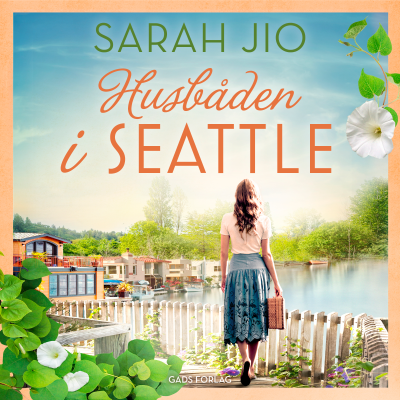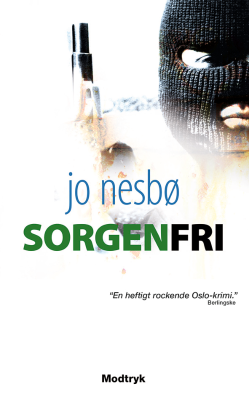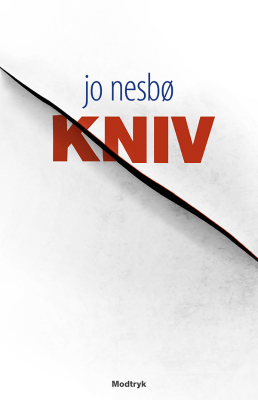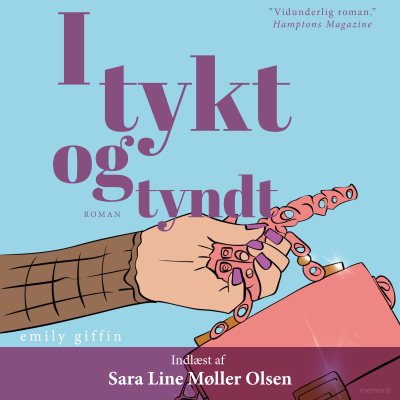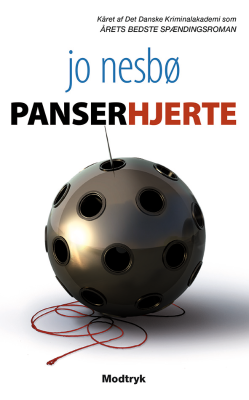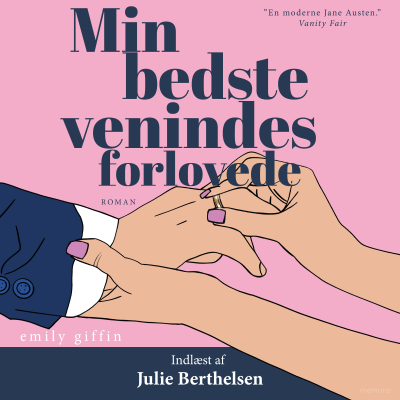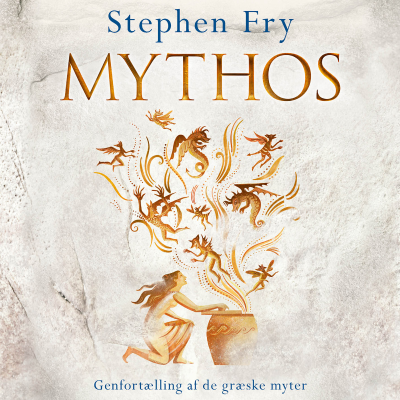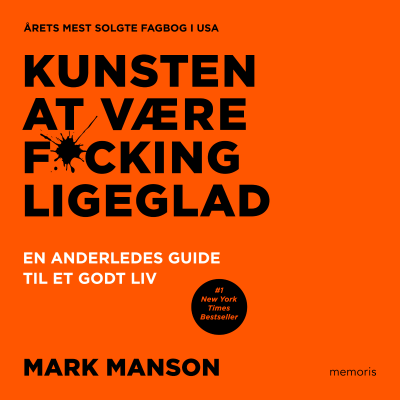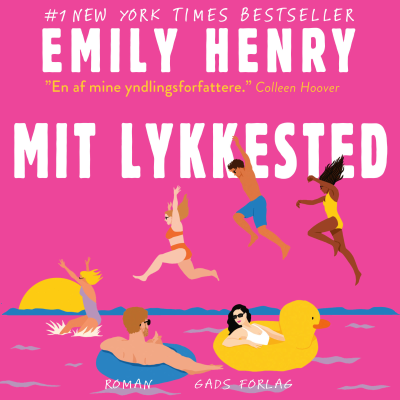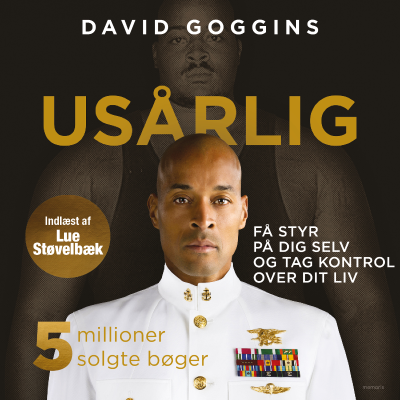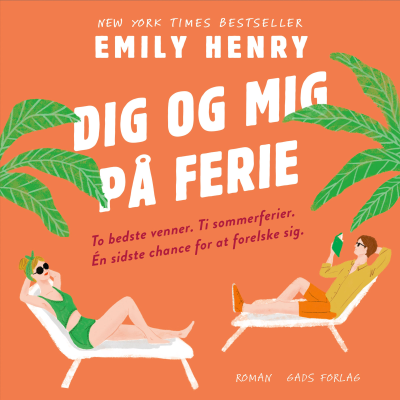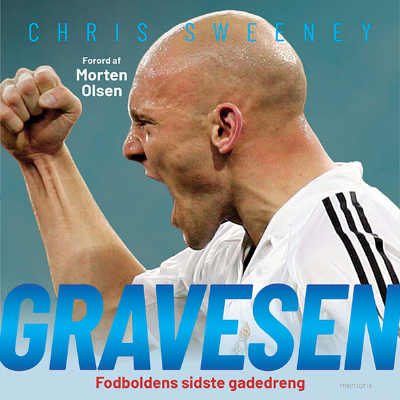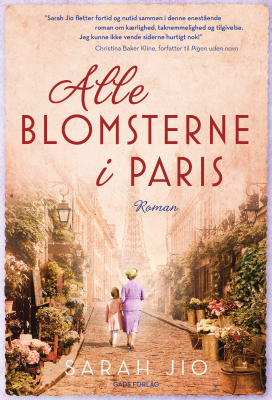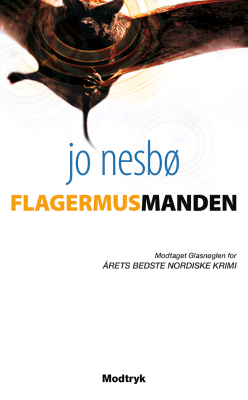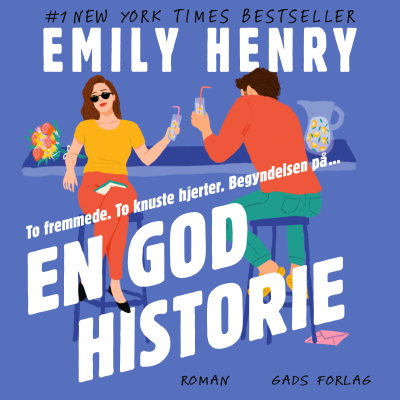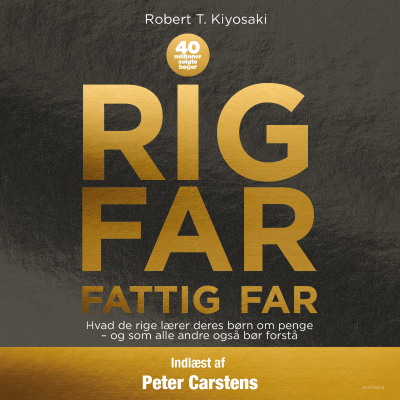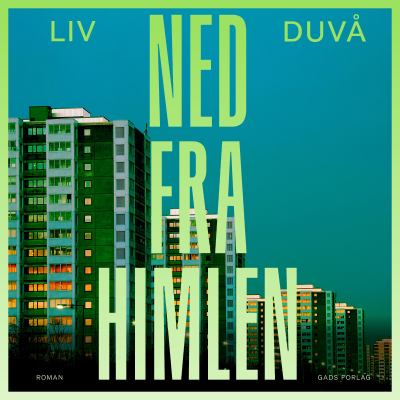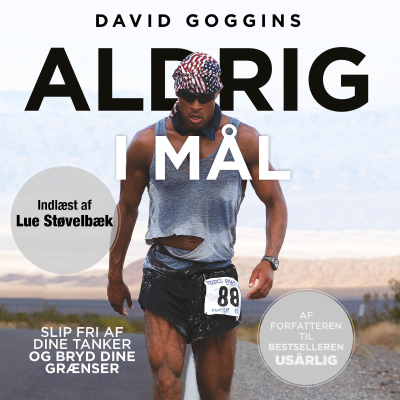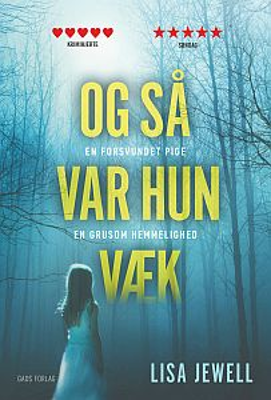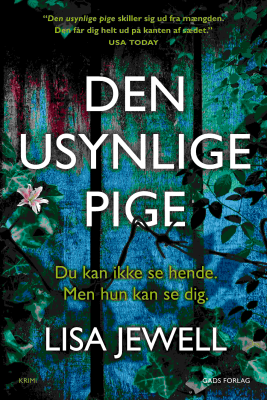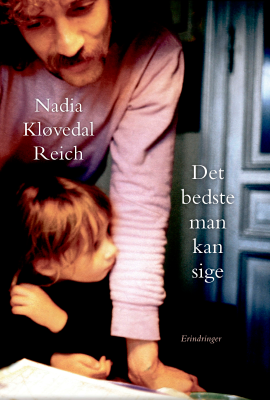Alles Geschichte - Der History-Podcast
Podcast af ARD
Begrænset tilbud
1 måned kun 9 kr.
Derefter 99 kr. / månedIngen binding.

Mere end 1 million lyttere
Du vil elske Podimo, og du er ikke alene
Bedømt til 4,7 stjerner i App Store
Læs mere Alles Geschichte - Der History-Podcast
Hinter allem steckt Geschichte und wir erzählen sie euch - euer History-Podcast.
Alle episoder
450 episoderWas heute für Urlauber an den Adriastränden kaum vorstellbar ist, war mehr als tausend Jahre lang Normalzustand: Freibeuter haben Segelschiffe mit wertvoller Fracht überfallen und ausgeraubt. Piratenboote gehörten quasi zur maritimen Landschaft wie heute touristische Ausflugsdampfer. Von Bernd-Uwe Gutknecht (BR 2025) Credits Autor: Bernd-Uwe Gutknecht Regie: Martin Trauner Es sprachen: Berenike Beschle, Florian Schwarz, Katja Amberger, Katja Schild Technik: Andreas Lucke Redaktion: Thomas Morawetz Im Interview: Srecko Cecuk, Neven Cagal, Dr. Vanja Kovacic, Nikolas Jaspert, Senka Vlahovic, Karlo Kovacic Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025 Besonderer Linktipp der Redaktion: SWR: Archivradio Das Radio: seit einem Jahrhundert Wegbegleiter der deutschen Geschichte. Historische Tondokumente vermitteln ein Gefühl für wichtige Ereignisse und Stimmungen vergangener Jahrzehnte. ZUM PODCAST [https://1.ard.de/archivradio_cp] Linktipps funk (2023): Die Wahrheit über Afrikas Piraten Vor einigen Jahren kamen in den Nachrichten ständig schockierende Meldungen über #Piraten-Angriffe in Somalia. Europa und die USA starteten Anti-Piraterie-Missionen und patrouillierten an der Ostküste Afrikas. Und heute? Heute gibt es vor Somalia quasi keine Piraterie mehr. Das Problem hat sich auf die andere Seite des Kontinents verlagert. Der Golf von Guinea in Westafrika ist zum neuen Hotspot der Piraten geworden. Auf einer der wichtigsten Seestraßen der Welt überfallen sie Handelsflotten und halten Geiseln fest, um Lösegeld zu erpressen. Aber: Wieso gibt es in Somalia eigentlich keine Piraten mehr? Und warum musste ausgerechnet Westafrika das neue Piratenparadies werden? JETZT ANSEHEN [https://www.ardmediathek.de/video/atlas/die-wahrheit-ueber-afrikas-piraten-i-atlas/funk/Y3JpZDovL2Z1bmsubmV0LzEyMjc1L3ZpZGVvLzE5MjM5NTUvc2VuZHVuZw] Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte: DAS KALENDERBLATT [https://www.ardaudiothek.de/sendung/das-kalenderblatt/5949906/]erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/5945518/]. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de. Alles Geschichte gibt es auch in der ARD Audiothek: ARD Audiothek | Alles Geschichte JETZT ENTDECKEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-geschichte-history-von-radiowissen/82362084/] Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript: Erzählerin: Männer mit Tüchern auf dem Kopf und Säbeln in der Hand klettern bedrohlich brüllend von ihren kleinen Holzbooten auf ein großes Segelschiff. Im idyllisch gelegenen Hafenbecken von Omis im südlichen Kroatien herrscht normalerweise eine entspannte Stimmung: neben Fischkuttern liegen hier Segelboote für Urlauber. Einmal im Jahr, immer am 18. August, verwandelt sich der ruhige Küstenort aber in ein lautes, grelles und schrilles Piraten-Nest! Ein örtlicher Verein veranstaltet eine Piratenschlacht nach historischem Vorbild. Srecko Cecuk ist der Vorsitzende: SPRECHER 1 „Wir spielen die Schlacht nach, als Papst Honorius der Dritte seine Marine hierherschickte, um gegen die Seeleute aus Omis zu kämpfen. Die Piraten besiegten den Papst! Wir haben Details über den Verlauf der Schlacht in italienischen Archiven gefunden. Also wir wissen ungefähr, was passiert ist: die Seeleute aus Omis attackierten mit kleinen wendigen Booten die wenig beweglichen großen Schiffe des Papstes und enterten sie. Um das Ganze für unsere Besucher spektakulärer zu machen, verwenden wir auch Kanonen, die es damals ja noch gar nicht gab.“ Erzählerin: Im Jahr 1221 mussten die päpstlichen Schiffe diese empfindliche Niederlage gegen die Omiser Seeräuber einstecken. Sieben Jahre später kamen die Schiffe des Papstes wieder, diesmal behielten sie die Oberhand. Die Angriffe der Piraten aus Omis blieben eine Zeitlang aus, aber schon wenige Jahre später trieben die dalmatinischen Freibeuter wieder ihr Unwesen. Ein paar Hundert Meter neben dem Hafenbecken mündet der Fluss Cetina ins adriatische Meer. Der Fluss kommt aus den Bergen und trägt Sedimente mit sich, deren bräunliche Farbe vermischt sich mit dem Azurblau des Meeres. Der einheimische Fischer Neven Cagal (sprich: Newen Tschagall) kennt die Küste hier wie seine Westentasche. Kurz hinter der Mündung drosselt er den Motor seines Holzbootes: SPRECHER 2 „Jetzt sind wir genau über der Mostina! Da unten am Meeresboden, diese Stein-Mauer, die reichte früher bis anderthalb Meter unter die Meeresoberfläche, große Militär-Schiffe mit Tiefgang sind da aufgelaufen. Sie hatten also keine Chance, vom Meer aus in die Schlucht hineinzufahren. Die sogenannten Omis-Pfeile dagegen waren so flach gebaut, dass sie ohne Probleme drüberfahren konnten. So ruderten die Piraten ein paar Kilometer ins Hinterland und waren dort absolut sicher.“ Erzählerin: Unter anderem wegen dieses natürlichen Schutzraumes in der Cetina-Schlucht konnten die Seeräuber aus Omis über 300 Jahre lang den Küstenraum im mittleren Dalmatien beherrschen. EIN Piratenclan dominierte den Seeraub: die berüchtigten Kacic! SPRECHERIN 1 „Die Kacic waren eine Fürstenfamilie, diese Seeräuber waren also Adlige! Einige Vornamen der Kacic-Seeräuber sind bekannt: Malduk, Osor, Jodimir oder Miroslav. Man muss verstehen: Seeraub war damals eine ganz normale Form der Geldbeschaffung. Man trieb Handel, wenn die Geschäfte aber nicht gut liefen, hat man eben Zwangszölle, Wegegeld, Lösegeld etc. eingetrieben. Das war gang und gebe im Mittelalter. Im Stadtarchiv von Dubrovnik gibt es dazu einige Dokumente. Etwa einen Vertrag zwischen Omis und Kotor, in dem die Piraten den Handelsreisenden freie Durchfahrt garantierten. Natürlich gegen ein Entgelt.“ Erzählerin: Dr. Vanja Kovacic ist Archäologin, hat lange am Staatlichen Institut für Konservierung in Split gearbeitet und hat ein Buch über die Piratenfamilie Kacic geschrieben. SPRECHERIN 1 „Die ersten schriftlichen Quellenangaben zu Piraten in Omis sind aus dem 12. Jahrhundert. Sie kontrollierten den gesamten Küstenstreifen von Trogir in Nord-Dalmatien bis zur Insel Korcula in Süd-Dalmatien. Sie attackierten vor allem venezianische Schiffe, aber auch der Überfall auf ein Schiff des deutschen Kaisers Friedrich des Zweiten ist überliefert. Und nicht zuletzt päpstliche Schiffe waren Ziele der Seeräuber. Sie mussten Tribut zahlen, sonst wurden sie geplündert.“ Erzählerin: Kaiser Friedrich residierte in Süditalien, seine Handelsschiffe fuhren von dort Richtung Konstantinopel. Die Freibeuter aus Omis hatten ihre Beutezüge also bis ins südliche Italien ausgedehnt. Ihre Lieblings-Opfer waren aber die reich beladenen Schiffe aus Venedig, die quasi direkt vor der Haustüre vorbeifuhren: SPRECHERIN 1 „Die Venezianer segelten nach Osten: ins Heilige Land, an die Levante, nach Konstantinopel, um Handel zu treiben. Viele dieser Handelsschiffe kamen aber nicht weit weg von Venedig, nur bis hierher! An Bord wurden sogar Pferde transportiert, ansonsten Wein, Getreide, das berühmte Glas aus Venedig, und auf dem Weg zurück unter anderem Metalle oder Gewürze. Davon haben wir detaillierte Warenlisten im Archiv gefunden.“ Erzählerin: Außer den schriftlichen Erwähnungen ist vom Kacic-Clan nicht viel erhalten. Im Stadtmuseum von Omis liegt aber ein etwa drei Meter langer Steinblock, vermutlich ein Grabstein der Freibeuter. Die Archäologin liest die kurze Inschrift vor: SPRECHERIN 1 „Hier ruht Miroslav Kacic zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder. - Diese Steintafel wurde am Friedhof außerhalb der Stadtmauer entdeckt. Was wir auch in Omis gefunden haben, ist ein Dokument eines gewissen Burgherren Jura, in dem er den Bewohnern ausdrücklich die Piraterie erlaubt.“ Erzählerin: Auch Nikolas Jaspert, Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg, forscht über Piraten in der Adria. Er ist Autor des Buches „Seeraub im Mittelmeerraum“. Mit dem Hollywood-Image der Piraten aus der Karibik, also mit Papagei auf der Schulter, Rumflasche in der Hand und Totenkopf auf der Fahne, hat die historische Realität der dalmatinischen Akteure nicht viel zu tun: O-TON NIKOLAS JASPERT „Keine Totenköpfe, nein, nicht trinkfest! Man kann aber diese Karrieren verfolgen, das sind verarmte Adlige. Und wie auf dem Land manche verarmte Adlige zu Räubern werden, andere überfallen, so entschließen manche verarmte Kleinadlige auch, zur See zu gehen. Denn das, was sie können, ist kämpfen.“ Erzählerin: Neben den Kacic aus Omis gab es im Mittelalter weitere Seeräuber-Gruppierungen entlang der dalmatinischen Küste. Sie hatten sich die Reviere wohl aufgeteilt, ähnlich wie das heute die Mafia tut. Und auch an der westlichen, italienischen Küste der Adria, im westlichen Mittelmeer oder der Ägäis terrorisierten Piraten Handelsreisende. Teilweise agierten diese Freibeuter im Auftrag von Herrschenden: O-TON NIKOLAS JASPERT „Es handelt sich – wenn man so will – um eine Form halbstaatlicher Gewalt. Das sind Personen, die etwa von der Republik Venedig oder der Krone Aragon oder Genua oder wem auch immer Kaperbriefe und die Erlaubnis erhalten, die Feinde dieser Herrschaften anzugreifen. Und es gibt auch – und das ist überraschend – Kaufleute, die auch mal zu Gewalt greifen. Das heißt also der Berufspirat, wie wir es uns vorstellen, so Blackbeard und Captain Sparrow und so, den gibt es im Mittelalter so gut wie gar nicht, sondern die anderen beiden Typen sind vorherrschend.“ Erzählerin: Nikolas Jaspert ist Mitglied einer internationalen Forschungsgruppe, die eine Datenbank über Piraterie im Mittelmeerraum aufbaut. Die Wissenschaftler durchforsten dafür Stadt - und Kirchenarchive, analysieren Handelsverträge und Register, kartographieren regionale Brennpunkte und berechnen die Gewinne der Raubzüge. Laut dem Heidelberger Historiker ein bislang vernachlässigtes Forschungsfeld: O-TON NIKOLAS JASPERT „Da ist noch viel zu finden über Gewalt zu See. Also wenn so ein Seeraub, so eine Prise gemacht wurde, also ein Schiff gekapert wurde, dann hat das häufig diplomatische Konsequenzen gehabt, dann wurden Gesandte hin und hergeschickt und es ging um Schadensausgleich und die Androhung von Repressalien und sowas konnte sich über Monate, Jahre, ja Jahrzehnte hinziehen. Und hat auch Texte hinterlassen, die weitgehend unbekannt sind. Und die gilt es erst einmal zu lesen und auszuwerten und zwar so, dass man die Karrieren und die Handlungen von einzelnen Seeräubern, Individuen verfolgen kann und auch ihre Verbindungen zu unterschiedlichen politischen Einheiten, Herrschaften, Staaten, wenn man so möchte, auch verfolgen kann. Und das ist bislang nicht möglich gewesen, weil die Forschung in der Regel national orientiert ist, also die Italiener forschen zur italienischen Geschichte und die Spanier zur spanischen. Aber diese Seeräuber waren – das liegt in der Natur der Sache – grenzüberschreitend tätig.“ Erzählerin: Von der Altstadt von Omis aus führen einige steile Stufen zur Mirabela-Festung hinauf. Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und überragt die Stadt. Von der Original-Anlage ist noch der Turm erhalten. Senka Vlahovic veranstaltet für Interessierte Piraten-Touren durch Omis, vermittelt Wissen aus der Zeit an Schulkinder und spielt auf Festivals eine Kacic-Fürstin. Vom Turm der Festung aus schaut sie auf´s Meer und zur vorgelagerten Insel Brac: SPRECHERIN 2 „Die Festung wurde zur Verteidigung benutzt, hatte verschiedene Zwecke: der Turm war natürlich Aussichtspunkt, von hier aus hat man einen Blick über die Adria, auf den Kanal zwischen Festland und der Insel Brac, über die ganze Insel hinweg, und auf der anderen Seite zum Cetina-Fluss und den Anfang der Schlucht. Außerdem war es ein Leuchtturm. Mit dem Feuer konnten sie ihren eigenen Booten nachts signalisieren, wo ihr Hafen ist. Und die Burg war der letzte Rückzugsort. Wenn Gegner in die Stadt eindringen konnten, hätte sich die Kacic-Familie für die letzte Schlacht hier verschanzt.“ SPRECHERIN 2 „Von diesem Ort aus regierten sie. Vor der Kacic-Ära hatte sich hier ein anderes Fürstentum zwischen den Flüssen Neretva und Cetina etabliert. Die Kacic-Familie hat ihnen die Herrschaft über diesen Landstrich entrissen. Die geografische Lage ist prädestiniert für Herrschende: die Stadt wurde nicht nur durch die Burg beschützt, sondern auch durch eine Stadtmauer und wo heute die Hauptstraße ist, war ein schützender Wasserkanal.“ Erzählerin: Bereits in der Antike sorgten illyrische Piraten für Angst und Schrecken an der Adria. Die Illyrer waren eine Ansammlung verschiedener Stämme wie den Japoden, Liburnern oder Histriern, die der Region Istrien ihren Namen gaben. Sie jagten schon in den Jahrhunderten vor der Zeitenwende römische oder griechische Handelsschiffe. Laut Nikolas Jaspert nutzten sie vor allem versteckte Buchten auf den vielen Inseln vor der kroatischen Küste: O-TON NIKOLAS JASPERT „Insofern sind solche zerklüfteten Küsten für Seeräuber perfekt, weil die Opfer gewissermaßen an den Küsten entlangfahren und dann kann man von einer Küstenbucht aus oder von hinter einer Küste relativ schnell vorstoßen. Und deshalb ist die Küste Dalmatiens schon seit vielen Jahrhunderten und auch im frühen Mittelalter ein Gebiet, von dem erzählt wird, wo sich sehr häufig Seeraub ereignete. Da sind die illyrischen Seeräuber nur ein Beispiel für eine lange Tradition.“ Erzählerin: Was für heutige Urlauber an den Adriastränden kaum vorstellbar ist, war mehr als Tausend Jahre lang Normalzustand: Segelschiffe mit wertvoller Fracht wurden von Freibeutern überfallen und ausgeraubt. Piratenboote gehörten quasi zur maritimen Landschaft wie heute touristische Ausflugsdampfer. Laut Archäologin Kovacic liegt das an der unterschiedlichen Beschaffenheit der italienischen und kroatischen Küstenlandschaften: SPRECHERIN 1 „Entlang der kroatischen Adriaküste sind Tausende Inseln. Hier gibt es unzählige Buchten, wo Schiffe anlegen konnten. Auf der italienischen Seite ist die Küste ewig lang, ohne schützende Buchten. Deshalb fuhren venezianische oder päpstliche Schiffe lieber auf unserer Seite. Gleichzeitig waren diese Buchten perfekte Verstecke für die Piraten. Die Seeräuber überfielen aber auch konkurrierende Städte an der Küste. So ist bekannt, dass die Bewohner von Omis einmal fast alles verloren, weil die Stadt von anderen Piraten eingenommen wurde.“ Erzählerin: Von den Neretva - Piraten ist die Taktik überliefert, in Inselbuchten Feuer zu entzünden und damit Handelsreisende anzulocken. Die mussten immer wieder anlanden und ihre Vorräte auffüllen. Näherten sie sich den Feuerstellen vermeintlicher Siedlungen, so tappten sie in die Piratenfalle. Am 18. September 887 ereignete sich vor Makarska eine legendäre See-Schlacht: die Neretva-Seeleute verteidigten ihre Stadt gegen eine übermächtige Flotte mit 12 Kriegsschiffen aus Venedig. Der venezianische Doge Urso I. verlor in der Schlacht sein Leben. Am 18. September wird jährlich der „Tag der kroatischen Marine“ gefeiert. In der frühen Neuzeit, also im 16. und 17. Jahrhundert, war eine andere Piratengruppe aus dem heutigen Kroatien sehr erfolgreich: die Uskoken! Dieser militärisch organisierte Verband rekrutierte seine Mitkämpfer unter anderem aus Flüchtlingen osmanisch besetzter Gebiete in Süd-Dalmatien, aber auch aus anderen Bevölkerungsgruppen des westlichen Balkans. Zentrum der Uskoken war der Küstenort Senj in der Nähe des heutigen Zadar. Laut Quellen konnten die Uskoken dauerhaft auf 1000 Kämpfer zurückgreifen und legten sich erfolgreich sowohl mit den Venezianern als auch mit den Osmanen an. In Italien nannte man sie „Venturini“, also Glücksritter. Spezialität der Uskoken waren Angriffe nicht auf offener See, sondern im Hafen: O-TON NIKOLAS JASPERT „Das sind Überfälle auf Schiffe, die gerade im Hafen sind, und das passiert sehr häufig. Also unser Bild des Seekrieges, das wir aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert kennen, mit den großen Schlachtschiffen und vielen Kanonen, das gilt für die frühe Zeit und auch für die Zeit der Uskoken weniger. Sie haben schnelle Schiffe, mit denen sie auch Handelsschiffe überfallen. Also ihr Vorteil ist, dass sie das Gelände natürlich gut kennen und in dieser Inselwelt zuhause sind und notfalls auch in Flüsse hochfahren können. Und zum zweiten, dass sie eben kleinere, schnellere, wendigere Schiffe haben.“ Erzählerin: Zur rein materiellen Motivation kam auch eine religiöse hinzu. Die Seeräuber aus Senj raubten vorzugsweise Schiffe der Osmanen aus. O-TON NIKOLAS JASPERT „Die religiösen Gegensätze zwischen Muslimen und Christen erleichtern den Seeraub, weil man als Christ problemlos einen Muslim überfallen darf, weil er eben ein Glaubensfeind ist. Und umgekehrt gilt es genauso, während man sonst schon darauf achten muss, wenn man als Genuese einen Christen überfällt, weil das diplomatische Schwierigkeiten bedingt. Also der Seeraub zwischen Andersgläubigen ist schlichtweg risikoärmer für die Gewaltakteure, für die Piraten.“ Erzählerin: Was oftmals bei Piraten-Erzählungen unberücksichtigt bleibt, ist die Versklavung der Opfer. Seeräuber nahmen nicht nur sämtliche Waren der eroberten Schiffe mit, sondern oftmals auch die Besatzung oder Reisende. Und Archäologin Kovacic hat Aufzeichnungen ausgewertet, die sogar Entführungen in Küstenorten erwähnen: SPRECHERIN 1 „Aus dem 16. und 17. Jahrhundert haben wir Belege, dass osmanische Piraten hierherkamen und vor allem auf den Inseln Männer und Frauen entführt haben, die nach kräftigen Arbeitskräften aussahen. Teilweise wurden alle Bewohner von kleineren Inseln mitgenommen, so dass diese Eilande über Nacht unbewohnt waren. 1571 drangen ottomanische Piraten nach Zentraldalmatien ein, sie griffen die Siedlungen auf der Insel Hvar an und brannten praktisch alles nieder. Aber aus welchem Grund auch immer sind sie nicht ins nahegelegene Omis gekommen.“ Erzählerin: Der Heidelberger Historiker Niklas Jaspert macht in seinen Veröffentlichungen immer wieder deutlich, dass Piraterie von der Antike bis zur Neuzeit eine breite gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Bedeutung hatte. Das Bild der freiheitsliebenden Revolutionäre unter dem Totenkopf, die den Reichen das Geld stahlen und es den Armen gaben, ist ihm zufolge stark romantisierend. Ein Freibeuter im Mittelmeer war eher Wirtschaftskrimineller als Robin Hood. Und letztlich war ein großer Teil der Bevölkerung beteiligt: als Täter, Opfer oder Nutznießer: O-TON NIKOLAS JASPERT „Man tut gut daran, wenn man eine Geschichte des Seeraubs in Dalmatien und an der Küste schreibt, dann immer die Küstenbewohner mitzuschreiben, die ganz unterschiedlich involviert sein können. Als Opfer natürlich von Überfällen, als Täter, die selbst zur See gehen und rauben, aber nicht zuletzt auch als Käufer und als Teil dieses Handels-Netzwerks, auf dem ja auch der Seeraub beruht, dass man die Beute verkaufen können muss.“ Erzählerin: Die kroatische Archäologin Vanja Kovacic ergänzt, dass man Piraterie in früheren Epochen nicht mit heutiger Moral beurteilen dürfe: SPRECHERIN 1 „Das war keine Frage von gut und böse, das war normal. Sie forderten Geld oder Ware dafür, dass fremde Schiffe durch die hiesigen Seegebiete fahren durften. Wenn man so will, tun wir das heute auch, in dem wir Zölle, auf der Autobahn Gebühren von den Durchreisenden oder in den Häfen Liegegebühren verlangen, freilich ohne Gewalt!“ O-TON NIKOLAS JASPERT „Ich halte Seeraub schon für ein zeitloses Phänomen, wir haben es ja immer noch! Also am Golf von Aden und anderswo, man muss sich nur die Zahlen anschauen, werden Jahr für Jahr Schiffe überfallen. Und das kriegen wir in Deutschland nur bedingt mit. Am Horn von Afrika eine Zeitlang schon, da war es auch in den Nachrichten. Und Reedereien reagieren zum Beispiel damit darauf, dass sie Söldner, Privattruppen anstellen, um Schiffe zu verteidigen. Also das ist ein Phänomen, das die Zeiten überdauert.“ Erzählerin: Wenn alljährlich im August im Hafenbecken von Omis die Piratenschlacht tobt, hat man von der Festung Fortica Starigrad aus den besten Ausblick. 300 Meter über der Stadt ist diese Anlage aus dem 15. Jahrhundert. Auch sie diente den Piratenfamilien als Hochburg, Aussichtspunkt und Rückzugsort. Erobert wurde sie nie. Wann genau und warum die Herrschaft der Kacic-Freibeuter endete, ist nicht überliefert. Ihre Nachfolger in Dalmatien, die Uskoken, gerieten im sogenannten „Krieg um Gradiska“, den Venedig und Habsburg ausfochten, zwischen die Fronten. Nach dem Friedensschluss der beiden Großmächte von 1617 wurden alle Schiffe der Uskoken verbrannt, sie mussten ins Hinterland umsiedeln. Viele von ihnen schlossen sich als Söldner den Habsburgern an, die übrigen zerstreuten sich zwischen Balkan und Österreich, die Piraterie an der kroatischen Küste löste sich fast über Nacht in Luft auf! Erzählerin: Karlo Kovacic ist Mitglied der örtlichen Sektion des kroatischen Wanderverbandes und kümmert sich mit seinem Team um die Instandhaltung der Wanderwege zu den Burgen und Höhlen der Gegend. Er beobachtet die Piratenschlacht immer von oben, ganzjährig führt er Wandergruppen auf den Spuren der Piraten durchs Gelände. Und auf EINE Entdeckung warten die Bewohner von Omis seit langem: irgendwo muss doch ein Piratenschatz vergraben liegen!? SPRECHER 1 „Leute aus Omis suchen seit Jahrhunderten nach möglichen Piratenschätzen, zum Beispiel in den vielen kleinen Höhlen hier. Bisher hatte aber noch kein Schatzjäger Glück, es wurde nichts Wertvolles gefunden. Wir wissen nicht, wohin die Kacic ihre Schätze geschafft haben oder ob sie hier irgendwo ruhen. Zur Bank haben sie die Schätze sicher nicht gebracht!“
Pirat im Dienst der Königin - Francis Drake, geboren 1543, begann als Sklavenhändler. Dann plünderte er spanische Schiffe und Küstenstädte, umsegelte dabei die Welt und schlug sogar noch die mächtigste spanische Flotte aller Zeiten, die legendäre Armada, in die Flucht. Francis Drake wurde Englands Nationalheld, eine Art Robin Hood der Ozeane. Von Brigitte Kohn (BR 2009) Credits Autorin: Brigitte Kohn Regie: Martin Trauner Es sprachen: Franziska Ball, Martin Umbach, Johannes Hitzelberger, Ulrich Frank, Katja Amberger Redaktion: Hildegard Hartmann Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2009 Besonderer Linktipp der Redaktion: ARD (2025): Ready for Liftoff! Der Raumfahrt-Podcast Immer mehr Raketen, immer abgefahrenere Missionen! In der Raumfahrt geht's gerade richtig ab. Das Wettrennen zum Mond und Mars hat längst begonnen. Bereit für den Start? Anne-Dorette Ziems, Fritz Espenplaub und David Beck nehmen euch alle zwei Wochen mit auf diese Reise. Wir sprechen über die neuesten Missionen, spannende Zukunftsvisionen und geben überraschende Einblicke in die Welt der Raumfahrt – ohne zu viel komplizierte Physik! ZUM PODCAST [https://1.ard.de/ready-for-liftoff] Linktipps WDR (2022): Anne Bonny - Die Piratin Schon als Kind will Anne keine "kleine Lady" sein. Als ihre Eltern mit ihr von Irland nach Amerika auswandern, rebelliert sie sowohl gegen die Sklavenhaltung als auch gegen alle Konventionen. Aber wie kann sie ihrem Schicksal als "feine Dame" entkommen? JETZT ANHÖREN [https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:c0e4e5a2445091b6/] Das Kalenderblatt (2008): Francis Drake überfällt Frigata 27.10.1572: Der englische Freibeuter Francis Drake war der erste Weltumsegler und Sieger in der Seeschlacht gegen die spanische Armada - was ihm den Status als "Volksheld" einbrachte. Doch mit knapp 55 Jahren ereilte ihn nicht der Heldentod, sondern er starb ganz unheroisch an der Ruhr … JETZT ANHÖREN [https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:392f7210fc0420ea/] Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte: DAS KALENDERBLATT [https://www.ardaudiothek.de/sendung/das-kalenderblatt/5949906/]erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/5945518/]. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de. Alles Geschichte gibt es auch in der ARD Audiothek: ARD Audiothek | Alles Geschichte JETZT ENTDECKEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-geschichte-history-von-radiowissen/82362084/] Hier ein Auszug der Folge zum Nachlesen: ZITATOR FRANCIS DRAKE: „Seht, so enden Verräter!“ ERZÄHLERIN: Drake hat das Szepter nun fest in der Hand, die Reise wird ein voller Erfolg. Im September 1580 läuft Drakes Flotte unter der Führung seines Flagschiffs, der legendären Golden Hind, nach drei Jahren in den heimischen Hafen von Plymouth ein. England jubelt, Drakes Ruhm verbreitet sich in ganz Europa. Er hat eine ungeheure Leistung als Seemann vollbracht, die verhassten Spanier an den pazifischen Küsten ausgeplündert, wichtige Handelsbeziehungen hergestellt und herausgefunden, dass es südlich der Magellanstraße keinen Südkontinent gibt, dass vielmehr der Atlantische und der Pazifische Ozean dort ineinander übergehen. Und er hat unermessliche Reichtümer an Bord, die sofort in den Schatzkammern der Königin eingelagert werden. Der spanische Gesandte schäumt vor Wut und beantragt eine Audienz. ZITATOR GESANDTER: „Im Namen seiner Majestät des Königs von Spanien erhebe ich schärfsten Protest und fordere die sofortige Rückgabe des spanischen Eigentums!“ ZITATORIN KÖNIGIN ELISABETH: „Senor de Mendoza, was fällt Euch ein, Euch in meine Staatsgeschäfte zu mischen? Ich erwarte eine schriftliche Entschuldigung Eures Gebieters wegen dieser Verletzung der Etikette!“ ERZÄHLERIN: Am 4. April 1581 gibt Drake ein großartiges Festessen für Elisabeth an Bord der Golden Hind. Eine riesige, kaum zu bändigende Menschenmenge säumt das Ufer. Als die Königin das Schiff betritt, rutscht ihr ein rotes Strumpfband herunter. Ohne große Umstände streckt sie ihr schlankes Bein aus und befestigt es wieder an der richtigen Stelle. Absicht oder nicht, wer weiß das schon? Elisabeth ist eine Meisterin der Selbstinszenierung. Die Seemänner johlen vor Begeisterung. Drake wird zum Ritter geschlagen. Danach kauft er sich ein großes Landgut und betätigt sich als Unternehmer und Politiker. O-TON PROFESSOR KLEIN: „Er war ja mehrere Male Parlamentsmitglied und war auch in vielen Ausschüssen. Aber interessant ist, dass die Redebeiträge von Drake nie in den Protokollen auftauchen. Er war nicht der Starparlamentarier. Ich glaube, dass er ein ganz guter Regionalpolitiker gewesen ist. In Devon hat er eine ganze Menge gemacht für die Sicherung der Küsten.“ ERZÄHLERIN. Das ist auch nötig, denn die Spanier rüsten zum Krieg. Elisabeth hat 1587 die schottische Königin Maria Stuart hinrichten lassen, das verschärft die Spannungen. Seit Philipp II. von Spanien Portugal annektiert hat, ist seine Macht noch gewachsen, nun soll auch England dran glauben. 1588 schickt Philipp die legendäre Armada, die größte Flotte der damaligen Zeit, gegen das Inselreich aus. Die gewaltigen Schiffe wirken wie schwimmende Kasernen. Jeder hält sie für unbesiegbar, aber das ist ein Irrtum. Die Spanier werden vernichtend geschlagen. Drake, inzwischen zum Vizeadmiral ernannt, hat die englische Flotte erfolgreich modernisiert. Er nimmt auch selbst an der Schlacht teil, und allein sein Name lässt die Spanier erzittern. O-TON PROFESSOR KLEIN: „Die Führungsstruktur bei den Spaniern war ganz hierarchisch. Der Oberbefehlshaber hat sozusagen den Unterbefehlshabern genaue Direktiven gegeben und die Spanier sind ja auch immer in so einer Halbmondformation gesegelt, und die Engländer waren flexibler.“ ERZÄHLERIN: Wie ein Rudel Hyänen, das einen Elefanten jagt, schießen die modernen englischen Schiffe auf die Armada zu. Auf den Enterkampf, für den die Armada konstruiert ist, lassen sich die Engländer gar nicht erst ein. Fünf Stunden lang tobt eine brutale Seeschlacht. Wenn sich die angeschossenen spanischen Schiffe kenternd zur Seite neigen, ergießt sich kübelweise Blut ins Meer und färbt das Wasser rot. Sturm kommt auf und treibt die fliehenden Schiffe gegen die umtosten Felsklippen. Das Ende der Armada ist ein Desaster. MUSIK ERZÄHLERIN: Dass der Zugriff Spaniens auf England dauerhaft abgewehrt werden konnte, daran haben die Leistungen Francis Drakes großen Anteil. Doch mit der spanischen Seemacht ist es noch lange nicht vorbei. Als Drake versucht, ihr in weiteren Expeditionen den Todesstoß zu versetzen scheitert er. Die Spanier haben dazugelernt. Sie fürchten Drake, den sie El Dragon, den Drachen nennen, wie der Teufel das Weihwasser, und sie rechnen jetzt überall mit ihm. Für den Matrosen Heinrich Hasebeck sind Drakes Attacken während seiner letzten Fahrt 1595 nach Südamerika nur ein sinnloses Gemetzel. ZITATOR MATROSE HASEBECK: „Da krachte es schon. Die Spanier hatten uns sehr wohl bemerkt, hatten uns nahe genug herankommen lassen und dann präzise das Feuer eröffnet. Augenblicklich herrschte Krieg. Fast von allen Seiten wurde auf uns gefeuert. Schon ein Schuss der ersten Salve traf in unseren Bug, riss dort ein Loch hinein und einen Mann entzwei. Ich sah, wie jemand die Leiche des zerfetzten Mannes über Bord wuchtete, und ich sah, wie ein Seemann versuchte, einen Schwall Blut von sich abzuwischen. Vorwärts, ihr Hunde, brüllte Drake.“ ERZÄHLERIN: Nichts wünschen die Spanier mehr als Drakes Tod. Doch Drake stirbt nicht im Kampf, er stirbt an der Ruhr, die unter den erschöpften Männern schnell um sich greift. Im Fieberwahn kurz vor seinem Tod im Januar 1596 stößt er wilde Flüche aus und verlangt nach seiner Rüstung. Am nächsten Tag wird seine Leiche in einen Bleisarg gebettet und unter dem Donner der Kanonen der See übergeben. Und Hasebeck? Der steht nicht dabei. Er ist von Bord geflohen, zusammen mit seiner Geliebten, einer schwarzen Frau namens Maria, die er in Rio de la Hacha kennen gelernt hat. Sein Tagebuch lässt er an Bord zurück, er braucht es jetzt nicht mehr. Irgendwo im heutigen Kolumbien verliert sich seine Spur.
Blutrünstige Barbaren oder freiheitssuchende Abenteurer? Wie waren Piraten wirklich? Ein Blick in die Geschichte offenbart Leben voller Abenteuer, Mordlust - und sogar Demokratie unter Piraten. Von Niklas Nau (BR 2018) Credits Autor: Niklas Nau Regie: Frank Halbach Es sprachen: Stefan Wilkening, Caroline Ebner, Christian Baumann Technik: Helge Schwarz Redaktion: Thomas Morawetz Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018 Besonderer Linktipp der Redaktion: BR (2025): Nicht mehr mein Land Im Flüchtlingssommer 2015 ist Ali Gutsfeld stolz auf sein Land. Damals zeigt sich Deutschland offen, hilfsbereit, empathisch. Und Angela Merkel verspricht: "Wir schaffen das". Aber schon im selben Jahr gibt es heftige Proteste gegen Flüchtlinge. Merkel sagt daraufhin, wenn wir uns für Hilfe in Notsituationen entschuldigen müssen, "dann ist das nicht mein Land". In seinem neuen Podcast will Ali Gutsfeld herausfinden: Was ist in den letzten zehn Jahren falsch gelaufen? Was können wir dagegen tun? Und er fragt sich: Ist das noch mein Land? In sechs Folgen trifft er Menschen, für die 2015 alles verändert hat. Ein Podcast für alle, die ihr Land nicht wiedererkennen. Damit wir wieder lernen, miteinander zu reden. ZUM PODCAST [https://www.ardaudiothek.de/sendung/nicht-mehr-mein-land-geschichten-ueber-migration-den-rechtsruck-und-die-graeben-zwischen-uns/urn:ard:show:3f637b2746ad2030/] Linktipps Radiowissen (2025): „Pirate Queens“ – Frauen unter der Totenkopf-Flagge Sie sind Mythos: "Pirate Queens", Seeräuberinnen, der Schrecken der Karibik. Es gab sie wirklich, sie waren reale Personen in der Geschichte der Piraterie. Als Abenteurerinnen, Kämpferinnen für Frauenrechte und leidenschaftliche Liebhaberinnen sind sie zu Ikonen der Popkultur geworden. Autor: Frank Halbach JETZT ANHÖREN [https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:459611c5b3b83776/] funk (2022): Mythos Piraten – Wie lebten sie wirklich? Piraten – wir kennen sie von Figuren wie Captain Jack Sparrow, dem wohl berühmtesten Piraten Hollywoods . Doch ein Leben als Pirat bedeutet in der Realität mehr als versteckte Schätze zu heben. Und selten geht die Geschichte der Piraten in der Vergangenheit so gut aus, wie Hollywood es uns vermittelt. Es ist vor allem ein Leben geprägt von Brutalität, Not und Armut. Die Piraterie ist so alt wie die Schifffahrt selbst. Diebe auf dem Meer gibt es, seit Handel über den Seeweg betrieben wird. Die Kilikischen Seeräuber versetzen schon in der Antike die Seeleute auf dem Mittelmeer in Angst und Schrecken. Piraten rauben, morden, plündern, nehmen Geiseln und bereichern sich. Auch das wird oft verklärt. Wieso es zu nahezu jedem Zeitpunkt in der Geschichte Piraten gab, was sie antreibt und wie ihr Leben tatsächlich aussah, erklärt euch Mirko in diesem Video. JETZT ANSEHEN [https://www.ardmediathek.de/video/mrwissen2go-geschichte/mythos-piraten-wie-lebten-sie-wirklich/funk/Y3JpZDovL2Z1bmsubmV0LzEyMDI0L3ZpZGVvLzE4MTUyNzEvc2VuZHVuZw] Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte: DAS KALENDERBLATT [https://www.ardaudiothek.de/sendung/das-kalenderblatt/5949906/]erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/5945518/]. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de. Alles Geschichte gibt es auch in der ARD Audiothek: ARD Audiothek | Alles Geschichte JETZT ENTDECKEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-geschichte-history-von-radiowissen/82362084/] Und hier ein Auszug des Audios zum Nachlesen: Erzähler Daniel Collins ist 23, und hat schon viele Seefahrten als Marinesoldat hinter sich, als er 1824 an Bord der Betsey geht. Von Wiscasset an der Ostküste der USA sticht die Crew des Handelsschiffs in See. Die Fahrt sollte zum Albtraum werden: Erzählerin Nur zwei Tage später läuft die Betsey in stürmischen Gewässern zwischen Florida und Kuba auf Grund. Die Mannschaft kann sich in einem beschädigten Rettungsboot auf eine kleine Insel retten. Doch sie sind nicht die einzigen dort: Zitator “Meine Ängste, dass es Piraten waren, bestätigten sich nun; und als ich sie so sah – ohne jeden Anreiz oder Provokation folterten sie einen Seemann, der keinen Penny besaß und durch einen Schiffbruch in ihre Fänge geraten war, krank und fast völlig hilflos, der Sie anflehte, ihn nicht in der Blüte seines Lebens (…) zu töten und sie daran erinnerte, dass er Frau und seine Eltern zurücklassen würde – da brach ich in Tränen aus und stand unwillkürlich auf, wie, um mein Leben teuerst zu verkaufen.“ Erzähler Collins schafft es tatsächlich, den Piraten zu entkommen. Nach einer abenteuerlichen Irrfahrt gelangt er zurück nach Wiscasset, wo er seine Geschichte aufschreibt. Eine Geschichte, in der uns Piraten so begegnen, wie wir sie auch aus manch anderen Legenden und Erzählungen kennen: Gierig, verschlagen, grausam, böse. Immer bereit, zu morden und zu brandschatzen, und hilflose Opfer über die Planke zu schicken, hinab zu den Haien. Erzählerin Und doch kennen wir noch ein zweites Piratenklischee: Das vom romantischen Freiheitssucher und Gentleman-Abenteurer mit Herz aus Gold. Captain Jack Sparrow ist so einer, oder Errol Flynns „Captain Blood“. Erzähler Welches Bild stimmt, wer waren Piraten wirklich? Grausame Schurken, romantische Abenteurer, oder ein bisschen was von beidem? Erzählerin Piraten gab es schon in der antiken Welt; zeitweise wimmelte etwa das Mittelmeer nur so von Ihnen. Erzähler Vor allem dort, wo Krieg herrscht, gedeiht die Piraterie während der Antike. Griechische Stadtstaaten wie Sparta oder Athen waren sich nicht zu schade, in Konflikten auch auf angeheuerte Piratenflotten zurückzugreifen. Der Makedonische König Philipp beschwert sich in einem Brief an die Athener so über einen von deren Verbündeten: Zitator Er hat alle Kaufleute, die nach Mazedonien segeln, als Feinde behandelt, gefangen genommen und als Sklaven verkauft. Und Ihr habt ihm dafür noch gedankt! Es würde keinen Unterschied machen, würdet offen zugeben, Krieg gegen mich zu führen. Denn als wir offen im Streit lagen habt Ihr ebenso Seeräuber gegen mich ausgesendet, Händler versklavt, meinen Feinden geholfen und meine Länder bedroht. Erzählerin Doch mit dem Weltreich von Philipps Sohn, Alexanders dem Großen, und später im Römischen Reich wird es für Piraten ungemütlicher: In diesen befriedeten Imperien sind sie bloß noch eine Bedrohung für Sicherheit und Handel. Immer wieder führen die Herrscher deswegen Feldzüge gegen die Seeräuber, der Politiker und Redner Cicero bezeichnet Piraten als „Feinde aller“ – als Feinde der Menschheit. Erzähler Doch wirklich sicher vor Piraten sind Seeleute und Küstenbewohner nie lange: Ob vor den Wikingern in ihren gefürchteten Drachenbooten, den Vitalienbrüdern um Gödeke Michels oder den Piratenflotten der sogenannten Barbareskenstaaten Nordafrikas, die vom 16. bis ins 19. Jahrhundert die Küsten Italiens, Spaniens und Portugals unsicher machten. Erzählerin Die Zeit jedoch, die unser Bild von Piraten entscheidend geprägt hat, beginnt Mitte des 17. Jahrhunderts und dauert weniger als hundert Jahre: Das „Goldene Zeitalter der Piraterie“. Erzähler Die Weltmeere waren damals zu geschäftigen Orten geworden. Aus der „neuen Welt“ – den Amerikas – brachten Schiffe Tabak, Holz, Zucker, Silber, Gold, und andere Reichtümer zu den Kolonialherren im alten Europa, aus Asien flossen Gewürze, Indigo, Seide, Salpeter und Tee. Aus Afrika wiederum brachten die Kolonialherren „menschliche Ware“ übers Meer: Verschleppt, um auf den Plantagen und in den Minen der neuen Welt zu schuften. Luxus und Gebrauchsartikel aus Europa und noch vieles mehr – Jedes Schiff war ein Vermögen wert, ein einziger Überfall konnte eine Crew zu reichen Männern machen. Erzählerin Eine Verlockung, der auch die europäischen Kolonialmächte selbst nicht widerstehen konnten. Um den eigenen Profit zu vergrößern und konkurrierende Nationen zu schwächen, gaben die Kolonialstaaten damals Kaperbriefe aus. Wer solch einen Brief besaß, durfte als „Freibeuter“ – als eine Art legaler Pirat – Schiffe feindlicher Nationen überfallen. Sir Francis Drake hatte es mit Angriffen auf die Spanische Silberflotte im 16. Jahrhundert zum Nationalhelden mit Ritterschlag gebracht. Ein Beispiel, dem viele Kaperfahren in der Folge nachzueifern suchten. Erzähler Doch was, wenn ein vielversprechendes Handelsschiff nun mal die „falsche“ Flagge hatte? Oder wenn ein neu geschlossener Friedensvertrag Schiffe einer Nation auf einmal Tabu machte? Vom ehrenhaften Freibeuter zum geächteten Piraten war es nur ein kleiner Schritt – den im goldenen Zeitalter eine ganze Reihe von Seeleuten wagten. Erzählerin Etwa Captain William Kidd. Eigentlich war der erfahrene Seefahrer von den Engländern als Piratenjäger engagiert worden: Er sollte die Piraterie im indischen Ozean eindämmen. Doch Kidd wurde selbst zum geächteten Piraten. Erzähler Kidds legendärer Schatz inspirierte Louis Stevensons berühmten Piratenroman „Die Schatzinsel“ und beflügelt auch heute noch die Fantasie von Glücksrittern. Erzählerin Noch viele weitere, bis heute legendäre Piraten, stammen aus dieser Zeit: Etwa Captain Henry Morgan, Bartholomew Roberts und Jack „Calico“ Rackham. Und natürlich auch er, der wohl berühmteste Pirat: Erzähler Blackbeard! Zitator Dieser Bart war schwarz, und ließ er denselben bis zu einer entsetzlichen Größe wachsen, dass seine ganze Brust davon bedeckt war, und derselbe ihm bis zu den Augen hinauf ging. Erzähler In den Kampf gezogen sein soll Blackbeard mit drei Paar Pistolen über der Brust und brennenden Lunten unter dem Hut. Zitator Dieser Aufzug, wenn man dazu die Gestalt seiner Augen hinzusetzet, deren Blicke von Natur wild und grausam waren, machten ihn so erschrecklich, das man keine Furie in der Höllen sich entsetzlicher einbilden kann als diese Gestalt. Seine Humeur und Neigungen kamen mit seiner barbarischen Gestalt wohl überein. Erzählerin So ist Blackbeard in dem Buch „A General History of Pirates“, das 1724 veröffentlicht wurde, beschrieben. Viel von dem, was wir heute über die Piraten des Goldenen Zeitalters zu wissen glauben, stammt daraus. Der Autor: ein Captain Charles Johnson – ein Pseudonym. Lange Zeit war die vorherrschende Meinung, dass Robinson Crusoe-Schöpfer Daniel Defoe dahinter stecke, aber auch der Journalist und ehemalige Seemann Nathaniel Mist gilt als möglicher Kandidat. Doch so ungewiss wie die Autorenschaft ist auch der Wahrheitsgehalt mancher Passagen in der „General History“ und vieler anderer Piratenlegenden aus dieser Zeit. Erzähler Heute gibt es ernsthafte Zweifel an vielen Schauergeschichten um den schrecklichen Schwarzbart: Erzählerin Etwa, dass er ganze vierzehn Mal geheiratet haben soll, und seine vierzehnte Frau, die 16-jährige Mary Ormond, in der Hochzeitsnacht zwang, auch seine Crew sexuell zu befriedigen. Belege dafür, dass Blackbeard überhaupt je verheiratet war, gibt es nicht. Und als Blackbeard das Schiff Concorde kaperte um es zu seinem neuen Flagschiff zu machen, was tat der grausame Seeräuber dem besiegtem Kapitän der Concorde da an? Kielholen? Über die Planke schicken? Erzähler Nein. Er gab ihm eines seiner eigenen zwei Schiffe und ließ ihn ziehen. Von anderen Piratenkapitänen gibt es dabei durchaus so viele Berichte von Grausamkeiten, dass sich nicht alle als Seemannsgarn abtun lassen. Etwa die vielen Gewaltexzesse des Captain Low, einem Londoner Kleinkriminellen, der es mit seiner Skrupellosigkeit in der rauen Welt der Piraten schnell bis zum Kapitän gebracht hatte. Einem Kapitän, der die Bordkasse seines Schiffs versenkt hatte, soll Low etwa die Lippen abgeschnitten haben, bevor er die gesamte Schiffsbesatzung ermordete. Erzählerin Den grausamen Ruf Captains Low‘s hatte auch der junge Fischer Philip Ahston im Kopf, als er 1722 in die Hände von Piraten fiel. Zitator Sie brachten mich auf die Brigantine, die keinem geringeren als dem berüchtigten Piraten New Low gehörte, mit einer 42 Mann starken Mannschaft, 2 Kanonen und 4 Drehbassen. Ihr mögt euch leicht denken können, wie ich schaute und mich fühlte, als ich mich, zu spät um es noch ändern zu können, in den Händen solch einer wahnsinnigen, tollen, boshaften Crew wiederfand. Erzähler Man kann davon ausgehen, dass manche Piraten die Macht, die sie über ihre Opfer hatten, genüsslich ausnutzten. Doch der Ökonom Peter Leeson glaubt, dass dies eher die Ausnahme war. Für ihn hat die berüchtigte Grausamkeit vieler Piraten vor allem ökonomische Gründe hatte, und kam oft dann zum Einsatz, wenn eine Besatzung sich nicht kampflos ergeben hatte: Ein Brief eines britischen Gouverneurs aus dem Jahr 1721 berichtet von so einem Fall in Bermuda: Zitator „Hartnäckig hielt das Schiff seine Verteidigung für vier Stunden aufrecht und tötete viele der Piraten, wurde dann aber doch überwältigt und musste sich ergeben. Männer, die die Piraten an Bord noch lebend antrafen, wurden mit verschiedenen grausamen Methoden hingerichtet.“ Erzähler Leeson argumentiert, dass die Piraten in solchen Fällen eine eindeutige Botschaft senden wollten: Leistete man gegen die Männer, die unter der schwarzen Flagge, der sogenannte „Jolly Roger“ segelten, Widerstand, so hatte man keine Gnade zu erwarten. Ergab man sich aber kampflos, konnte man unversehrt davonkommen – sogar, wenn man in die Fänge des berüchtigten Blackbeard geraten war, wie die Geschichte des Kapitains der Concorde zeigt. Und so, vermutet Leeson, befeuerten Piraten auch selbst gerne die Geschichten ihrer Grausamkeit und Unberechenbarkeit – es machte ihnen das Leben leichter. Und die Strategie ging wohl auf. Ein Zeitungsartikel aus jener Zeit berichtet, dass Seeleute sich weigerten, ihre Schiffe gegen Piraten zu verteidigen. Erzählerin Blackbeard, so glauben auch einige Historiker, könnte dieses piratische Image-Building bis zur Perfektion getrieben haben. So schrecklich war sein martialischer Auftritt und die Legenden, die sich um ihn rankten, dass er bis zu seinem letzten Kampf als Pirat wohl niemanden töten musste. Erzähler Leesons These ist nicht unumstritten. Doch, eines ist klar: Trotz Momenten der Großzügigkeit und Gnade waren Piraten zumeist einfach skrupellose Verbrecher. Auch, wenn manche von Ihnen es selbst nicht ganz so sahen. Laut Piratenchronist Charles Johnson soll Captain Sam Bellamy dem Kapitän eines gekaperten Bootes folgendes vorgehalten haben: Zitator Doch seid Ihr ein verschlagener Hund, genau wie alle, die sich den Gesetzen beugen, die reiche Männer für ihre eigene Sicherheit geschaffen haben. […] Sie verteufeln uns, die Schufte, wo doch der einzige Unterschied der ist, dass sie die Armen unter dem Deckmantel des Rechts ausrauben, während wir die Reichen plündern, nur unter dem Schutz unseres eigenen Mutes.” Erzählerin Hier kommt langsam das andere Piratenklischee ins Spiel, das vom Gentleman-Abenteurer und Rebellen, der in der Piraterie Freiheit und Gerechtigkeit sucht. Tatsächlich war einer der Spitznamen Sam Bellamy’s “Robin Hood der Meere”, seine Crew bezeichneten sich selbst als “Robin Hoods Männer”. Erzähler Doch dieser Vergleich hinkt. Die einzigen Bedürftigen, die von den Raubzügen des selbsternannten Robin Hood profitierten, waren er selbst und seine Männer. Denn Bellamy stammte aus ärmlichen Verhältnissen, häufte aber innerhalb nur eines Jahres ein immenses Vermögen an. Nach Schätzungen von Forbes erbeutete er Schätze im Wert von heute 120 Millionen Dollar und war damit der reichste Piraten aller Zeiten. Erzählerin Auch eine utopische Piratenrepublik eines Captain Mission, von der Piratenchronist Charles Johnson berichtet und in der Männer aller Nationen – schwarze ebenso wie weiße – frei und gleich zusammenlebten, gilt heute als widerlegt und frei erfunden. Erzähler Trotzdem sehen manche Historiker wie etwa der Amerikaner Marcus Rediker in Piraten Sozialrebellen oder sogar Proto-Sozialisten: Männer, die den Konventionen ihrer Zeit ein eigenes Ethos entgegensetzen, in dem gesellschaftlicher Stand, Nationalität oder Rasse keine Rolle mehr spielten. Denn während Matrosen eines Handelsschiffs damals oft unmenschliche Behandlung und die strenge Hierarchie an Bord ertragen mussten, herrschten an Bord eines Piratenschiffs demokratische Zustände: Erzählerin Piraten wählten ihren Kapitän und konnten diesen, wenn sie unzufrieden mit ihm waren, wieder abwählen: Auch über wichtige Entscheidungen wurde abgestimmt. Einige Rechte und Pflichten schrieben Schiffsbesatzungen in einem Kodex nieder, den jedes neue Mitglied unterschreiben musste. Einige dieser Piratenverfassungen sind überliefert. Die Artikel des Captain Low etwa wurden 1723 in einer Zeitung abgedruckt und regeln etwa, wie Beute aufgeteilt wird. Zitator Artikel I: Dem Kapitän stehen zwei volle Anteile zu; Dem Quartiermeister einer und ein halber; Dem Arzt, Maat, Kanonier und Bootsmann jeweils einer und ein Viertel. Erzählerin An Bord von Captain Low – dem grausamen Mann, der einem gefangenen Kapitän die Lippen abhackte – genoss man sogar eine Krankenversicherung: Zitator Artikel VI: Wer das Unglück haben sollte, im Kampf eine Gliedmaße zu verlieren, erhält die Summe von sechshundert Silbermünzen und darf an Bord bleiben, solange er es angemessen findet. Erzählerin Viele Artikel eines Piratenkodex dienten allerdings weniger der Sozialpolitik, sondern sollten vielmehr für ein Mindestmaß an Disziplin an Bord und beim Angriff auf Beute sorgen. Wer etwa beim Kampf betrunken oder feige war, durfte bestraft werden. Erzähler Das Bild, dass sich so zusammensetzt, ist ein vielschichtiges: Piraten waren Männer, die der strengen gesellschaftlichen Hierarchie der damaligen Zeit entflohen und ein alternatives Modell dazu lebten – doch gleichzeitig war ihr Ziel nicht soziale Revolution, sondern Bereicherung. Rebellen – ja. Doch auch skrupellose Verbrecher. Nirgendwo lässt sich diese Ambivalenz besser beobachten als bei Sklavenschiffen, die von Piraten gekapert wurden. Für einen Sklaven auf solch einem Schiff war beides möglich: Hatte er Glück, so konnte er sich der Piratencrew als gleichberechtigtes Mitglied anschließen. Hatte er Pech, sahen die Piraten ihn als Teil der Beute an und verkauften ihn im nächsten Hafen. Und auch beim Thema Frauen war es mit der Gleichberechtigung bei Piraten nicht weit her. Denn Frauen an Bord sind grundsätzlich absolut Tabu. Es gibt wenige Ausnahmen: Über die berühmten Piratinnen Mary Read und Anne Bonny berichtet auch schon Charles Johnson in seiner “General History”. Weniger bekannt, aber wohl die einflussreichste Seeräuberin aller Zeiten war die Piratenkönigin Ching Shih, die um 1800 das Südchinesische Meer unsicher machte. Erzählerin Ching Shih, eine ehemalige Prostituierte, heiratete damals einen einflussreichen Piraten und übernahm nach dessen Tod das Kommando. Ihre Flotte soll 1500 Schiffe und 80.000 Mann umfasst haben. Als die chinesische Regierung ihr schließlich eine Amnestie anbot, nahm sie an, und setzte sich mit ihrem neuen Ehemann zur Ruhe. Erzähler Solch ein versöhnliches Ende finden viele Piraten des goldenen Zeitalters, nicht: Sam Bellamy, der „Robin Hood der Meere“, sinkt mit seinem Schiff Whydah in einem Unwetter vor Cape Cod. Erzählerin William Kidd, der vom Piratenjäger selbst zum Piraten geworden war, wird in London angeklagt und gehängt. Beim ersten Mal reißt der Strick, erst der zweite Versuch tötet ihn. Kidds Leiche wird anschließend zur Abschreckung in einem Eisenkäfig über der Themse aufgehängt. Erzähler Und auch der berüchtigte Blackbeard findet ein gewalttätiges Ende. Der ehrgeizige Gouverneur von Virginia, Alexander Spotswood, rüstet eine Kommando-Operation ins benachbarte North Carolina aus, wo Blackbeard – mit bürgerlichem Namen Thatch – sich aufhalten soll. Die London Gazette veröffentlich 1719, was sich dann zugetragen haben soll: Zitator Am 22. November erspähten sie das Piratenschiff an der Küste North Carolinas und ruderten zu ihm hin. Thach selbst rief sie an und fragte, wer sie seien. Sie antworteten, dass er das an ihrer Flagge erkennen könnte. Daraufhin sagte er, dass er Schonung weder akzeptieren noch gewähren würde. Sie antworteten darauf, dass sie nichts dergleichen erwarteten noch geben würden. Erzähler Wie genau sich der folgende Kampf abgespielt hat, ist nicht eindeutig. Doch am Ende liegt Blackbeard tot da, von vielen Kugel und Schwertstreichen getroffen. Zitator Nachdem der Kampf vorbei war, befahl Lieutenant Maynard, Thatch den Kopf abzuschneiden und hing ihn unter den Bugspriet seines Schiffs. Auf diese Weise transportierte er ihn nach Virginia, wo die Piraten, die gefangen genommen worden waren, gehängt wurden. Erzählerin Das Goldene Zeitalter der Piraterie endet bald nach Blackbeards Tod. Anfang des 18. Jahrhunderts schlossen die Kolonialmächte untereinander Frieden und gaben bald keine Kaperbriefe mehr aus. Die Piraten, die die Karibik und die Handelsrouten der Weltmeere unsicher machten, konnten sich der wachsenden Verfolgung durch die Kolonialmächte und ihre stärker werdenden Seestreitkräfte nicht endlos entziehen. Erzähler Doch natürlich ist auch das Ende des goldenen Zeitalters nicht das Ende der Piraterie. Noch heute gibt es über hundert Piratenangriffe auf Schiffe weltweit. Die verwinkelten Inselnetzwerken Ostasiens oder „gescheiterten Staaten“ wie Somalia dienen den Piraten unserer Tage dabei als sichere Rückzugsorte, von denen aus sie ihre Kaperfahrten starten können. Erzählerin Was ist vom goldenen Zeitalter geblieben? Geschichten und Legenden natürlich – und mehr: Blackbeards ehemaliges Flaggschiff, die Queen Anne‘s Revenge, wurde 1996 vor der Küste North Carolinas gefunden. Zwei Jahre später entdeckte man den Rumpf von Sam Bellamy‘s im Sturm gesunkener Whydah vor Cape Cod. Auch die Quedagh Merchant, das Handelsschiff, dass von William Kidd überfallen wurde – ein Überfall, der ihn schließlich an den Galgen brachte – wurde mittlerweile entdeckt. Der legendäre Schatz Captain Kidds aber bleibt weiter verschollen. Wer weiß, ob die Geschichten von den sagenhaften Reichtümern, die irgendwo versunken oder vergraben liegen, nicht frei erfunden sind, oder zumindest maßlos übertrieben, wie vieles aus dieser Zeit? Die Phantasie jedenfalls beflügeln sie weiter.
Lange war das Reisen ein Privileg des Adels und der wohlhabenden Patrizier; die ihre Söhne nach der Schulausbildung auf die so genannte Grand Tour schickten. Eine strapaziöse Reise; mitunter auch gefährlich. Von Ulrike Beck (BR 2018) Credits Autorin: Ulrike Beck Regie: Martin Trauner Es sprachen: Thomas Birnstiel, Beate Himmelstoß, Heinz Peter Technik: Fabian Zweck Redaktion: Thomas Morawetz Im Interview: Dr. Holger Kürbis Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025 Besonderer Linktipp der Redaktion: WDR (2025): Kyllroth. Tödliche Heimkehr 1917 – Mystery-Crime-Serie Tief in der Eifel, umgeben von uralten Maaren, deren Nebel sich mit den Schatten der Wälder vermischen, liegt das abgeschiedene Dorf Kyllroth. Im Jahr 1917 erschüttert eine Serie von mysteriösen Todesfällen den Eifelort. Gerade aus dem Krieg zurück, sterben die Männer aus unerklärlichen Gründen. Ist die Maarhexe für die Toten verantwortlich? Eine Hörspiel-Serie in 8 Teilen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ZUM PODCAST [https://1.ard.de/kyllroth] Linktipps BR (2025): Das Recht auf Urlaub – Wie es zur bezahlten Freizeit kam Sommer ist Urlaubszeit. Aber das Recht auf bezahlte Freizeit zum Ausspannen und Erholen war besonders für Arbeiter und Arbeiterinnen lange die Ausnahme. Vorreiter waren Brauereimitarbeiter in Stuttgart, die sich 1903 einen der ersten Tarifverträge mit einem bezahlten Jahresurlaub erstritten - allerdings nur drei Tage. Autor: Georg Gruber (BR2025) JETZT ANHÖREN [https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:fd59ad75e3443b44/] rbb (2025): Früher war der Urlaub sonniger – Eine Reise durch die Jahrzehnte Von Fernreisen in exotische Länder über den Urlaub auf dem Bauernhof bis hin zu Strandferien an der Ostsee - jeder hat seine ganz eigenen Reiseerinnerungen. Der Film blickt zurück auf Urlaubstrends und Erlebnisse von den 1950ern bis in die 1990er Jahre, wie Camping, Kaffeefahrten, Survival-Urlaub oder Ballermann. JETZT ANSEHEN [https://www.ardmediathek.de/video/dokumentation-und-reportage/frueher-war-der-urlaub-sonniger-eine-reise-durch-die-jahrzehnte/rbb/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZG9rdS8yMDIyLTA2LTIxVDIwOjE1OjAwX2UzNGFhY2RhLTdlOWItNDA4OS04N2NjLTMzMmJhZGVjMWFhMC9mcnVlaGVyLXdhci1kZXItdXJsYXViLXNvbm5pZ2Vy] Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte: DAS KALENDERBLATT [https://www.ardaudiothek.de/sendung/das-kalenderblatt/5949906/]erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/5945518/]. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de [radiowissen@br.de]. Alles Geschichte gibt es auch in der ARD Audiothek: ARD Audiothek | Alles Geschichte JETZT ENTDECKEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-geschichte-history-von-radiowissen/82362084/]
Sie ist die längste Eisenbahnstrecke der Welt - die Transsibirische Eisenbahn. Ende des 19. Jahrhunderts will das Zarenreich mit ihr einen Traum wahrmachen: den Raum besiegen und Russland in die Moderne katapultieren. Von Elsbeth Bräuer (BR 2018) Credits Autorin: Elsbeth Bräuer Regie: Susi Weichselbaumer Es sprachen: Rainer Buck, Herbert Schäfer Technik: Susanne Herzig Redaktion: Thomas Morawetz Im Interview: Prof. Dr. Benjamin Schenk Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025 Besonderer Linktipp der Redaktion: MDR (2025): Weltgeschichte vor der Haustür Hans Christian Andersen liebte das Reisen – vor allem mit dem Zug. Er lernte das Osmanische Reich kennen, Portugal oder Großbritannien. Eine seiner ersten Reisen führte ihn 1831 nach Deutschland - der Anlass war eine unglückliche Liebe. Das Reiseziel Deutschland hatte mit seiner Vorliebe für Autoren wie E.T.A. Hoffmann, Ludwig Tieck oder Heinrich Heine zu tun. In die Sächsische Schweiz zog es ihn wegen seiner Schwäche für Berge, Felsen, Täler und Höhlen. Und die Stadt Dresden faszinierte ihn so sehr, dass er danach immer wieder zurückkehrte. ZUR FOLGE [https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:79db7e2b678cddeb/] Linktipps BR (2025): Glacierexpress Neben der Transsibirischen Eisenbahn ist die Fahrt mit dem Glacierexpress eine der berühmtesten Eisenbahnreisen der Welt. In acht Stunden erlebt man zwischen St. Moritz und Zermatt knapp 300 Kilometer Schweizer Alpenlandschaft in ihrer schönsten Form. Seit 88 Jahren gehört die Reise mit dem "langsamsten Schnellzug der Welt" zu einer der aufregendsten und bequemsten Möglichkeiten, die Alpen zu entdecken. Die dreiteilige Dokumentation gibt es in der ARD Mediathek. JETZT ANSEHEN [https://www.ardmediathek.de/video/eisenbahn-romantik/glacierexpress-von-st-moritz-in-die-rheinschlucht/br/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAyMVdPMDE3NzE2QTE] BR (2024): Die Geschichte der Eisenbahn in Deutschland – Vom Adler zum ICE Neun Minuten dauert die Jungfernfahrt der Lokomotive "Adler". Sie läutet 1835 auf den frisch verlegten Schienen zwischen Nürnberg und Fürth das Eisenbahnzeitalter ein. Seitdem hat sich viel getan in der Geschichte der Eisenbahn... Von Inga Pflug (BR 2020) JETZT ANHÖREN [https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:a90f5fefbce144fc/] Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte: DAS KALENDERBLATT [https://www.ardaudiothek.de/sendung/das-kalenderblatt/5949906/]erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/5945518/]. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de. Alles Geschichte gibt es auch in der ARD Audiothek: ARD Audiothek | Alles Geschichte JETZT ENTDECKEN [https://www.ardaudiothek.de/sendung/alles-geschichte-history-von-radiowissen/82362084/] Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript: MUSIK ZITATOR So versank gewissermaßen die europäische Welt hinter uns, und es gab keine Mittel und Wege, die Verbindung mit ihr wieder herzustellen. Aber eine ganz neue und kaum geahnte Welt stieg dafür vor uns auf und sprach in beredter Weise, mit lebhaften Bildern zu unseren Sinnen. Die Eisenbahn brachte durch den unendlich langen Einschnitt, den sie in den asiatischen Kontinent macht, überall neues Leben hervor. SPRECHER Sie ist eine Bahn wie keine andere. Die Transsibirische Eisenbahn, von der der deutsche Journalist Eugen Zabel schwärmt, ist längst ein Mythos. Über 100 Jahre später fasziniert sie immer noch Reisende und Russlandfans. Nicht nur für Eisenbahnromantiker ist es ein Traum: Einmal die große Reise von Moskau nach Wladiwostok antreten, über 9.000 Kilometer Schienen, während am Fenster eine endlose Schneelandschaft vorbeizieht, die Eisenbahn sanft rattert und es in den Gängen nach russischem Tee riecht. MUSIK SPRECHER Das Zarenreich im 19. Jahrhundert. Alexander III. herrscht über ein riesiges Imperium – von St. Petersburg im Westen bis zur Pazifikküste im Osten. Doch der Zar hat ein Problem. In den entfernten Gebieten kann er seine Herrschaft schlecht durchsetzen, der Handel mit Sibirien wird erschwert durch schlammige Straßen und unpassierbare Gebiete. Daher geistert jahrzehntelang eine Idee durch die russischen Ministerien. Ein „stählernes Band“ soll Russland wie einen Gürtel zusammenhalten – die Transsibirische Eisenbahn. Es wird die längste Eisenbahnstrecke der Welt werden, ein Viertel des gesamten Erdumfangs. Der Historiker Prof. Benjamin Schenk hat ein Buch darüber geschrieben: „Russlands Fahrt in die Moderne“. 1 O-TON Das war ein Zeitalter, wo man weltweit daran dachte, große Distanzen mithilfe dieser modernen Infrastruktur zu erschließen. Es war auch die Zeit der großen Verkehrsprojekte auf dem amerikanischen Kontinent, es war die Zeit, wo man den Suezkanal baute und Jules Verne sein Buch schrieb "In 80 Tagen um die Welt", und wo man davon träumte, dass man mithilfe dieses modernen Verkehrsmittels nun Raum und Zeit besiegen könne. SPRECHER Der Mann, der für diesen Traum kämpft, heißt Sergei Witte. Sein Herz schlägt für die Schienen. Der Manager berät den Zaren zu Eisenbahnprojekten, wird Verkehrs- und später Finanzminister – er will das Zarenreich moderner machen. In seinem Buch „Die Memoiren des Grafen Witte“ von 1921 beschreibt er, welch großen Stellenwert die Eisenbahn für ihn und den Zaren hat: ZITATOR Die Idee, das europäische Russland mit Wladiwostok zu verbinden, war einer der größten Träume von Alexander III. [...] In meiner Funktion [...] setzte ich mich hartnäckig für die Notwendigkeit ein, die große Sibirische Bahn zu bauen. So sehr die früheren Minister den Plan abwendeten, so wollte ich ihn durchführen, erinnere ich mich an mein Versprechen an den Kaiser. Als Finanzminister war ich in einer besonders guten Position dafür, denn was man für den Bau der Bahn am meisten brauchte, war Geld. SPRECHER Was die Eisenbahn angeht, hinkt Russland hinterher. Mit Neid blicken viele in die USA und nach Kanada: Dort schnaufen und rattern schon Züge quer über den Kontinent. Nun soll auch Russland mit einem großen Kraftakt in der Moderne ankommen. Doch wie jedes Großprojekt hat die Transsibirische Eisenbahn ihre Feinde. Bevor sie gebaut wird, wird um sie gestritten – über 30 Jahre lang. Zu teuer, sagen die Kritiker, größenwahnsinnig, ein Projekt, das sich nie lohnen wird. Und dann ausgerechnet Sibirien – das „Reich der Kälte“, groß, wild und unwegsam. 2 O-TON Sibirien war für Russen, aber auch für Menschen in Westeuropa ein Land, das sehr, sehr weit weg war und ein nicht sehr gut ausgebildetes System von Wegen und Straßen hatte und das wirklich schwer zugänglich war. Und ein Grund, warum man zum Beispiel Sibirien als einen Ort der Verbannung und des Gefängniswesens genutzt hatte, war, dass man nicht nur schlecht hinkam, sondern auch schlecht wegkam. Also es war ein Ort, der im Volksmund als das „größte Gefängnis der Welt“ galt. SPRECHER In diesem Gefängnis gibt es Land im Überfluss. Manche versprechen sich davon reiche Gewinne - im Ackerbau und der Viehwirtschaft. Doch die Produkte zu transportieren ist schwierig. Man fährt die Ware mit Schlitten über zugefrorene Wege, unbefestigte Straßen werden schnell mal zu gefährlichen Schlammlöchern. Besonders schlimm ist es im Frühjahr und Herbst. Im Russischen gibt es sogar ein eigenes Wort für diese „Zeit der Wegelosigkeit“: Rasputiza. Die Transsib soll ein kleines Wirtschaftswunder in Gang setzen - und die Regierung hofft, sich damit auch militärisch besser aufzustellen. Schließlich spricht Alexander III. im Jahr 1890 ein Machtwort für die Transsib: ZITATOR Es ist Zeit, allerhöchste Zeit. SPRECHER Im Mai 1891 tut Alexanders Sohn, der spätere Zar Nikolaus II., den ersten Spatenstich – und zwar im Pazifikhafen Wladiwostok, das heißt übersetzt „Beherrsche den Osten“. An gleich fünf Stellen gleichzeitig beginnen die Bauarbeiten. Doch die Verantwortlichen haben sich bei der Planung verschätzt. Die Eisenbahn kostet weit mehr als erwartet. Der russische Staat soll das Projekt finanzieren – doch der sitzt auf dem Trockenen. Also müssen Kredite aus dem Ausland her, und zwar schnell. Wie begeistert man Investoren und Touristen? Die Verantwortlichen setzen auf die Pariser Weltausstellung. Während in Sibirien die Schienen verlegt werden, läuft die Werbetrommel in der französischen Hauptstadt heiß. Die Weltöffentlichkeit soll Sibirien als Zukunftsprojekt kennenlernen. 3 O-TON Man kooperierte mit der internationalen Schlafwagengesellschaft und stellte in einen dieser Pavillons auf der Pariser Weltausstellung Waggons der Luxusklasse und die Besucher der Weltausstellung konnten nun diesen Waggon besuchen, sie konnten dort Platz nehmen und Tee trinken, und während sie dort saßen, ungefähr eine Stunde, wurde an den Fenstern dieses Zuges ein gewaltiges Landschaftspanorama vorbeigezogen, und dieses Landschaftspanorama sollte den Menschen, die in diesem Zug saßen, die Illusion erwecken, dass sie sich im Zug befinden und gerade durch Sibirien fuhren. Und als sie dann nach einer Stunde diesen Zug wieder verließen, wurden sie empfangen von Personal auf dem Bahnsteig, was nun chinesische Trachten trug, um diese Illusion perfekt zu machen, als hätte man in dieser Stunde im Kopf diese Distanz zwischen Moskau und Peking in diesem Zug der Luxusklasse zurückgelegt. SPRECHER Es ist ein genialer Marketing-Coup. Sibirien – das ist auf einmal nicht mehr dieses verschnarchte Hinterland mit seinen öden Landschaften und gefährlichen Sträflingen. Sibirien, das ist die Zukunft! Im Westen überschlägt man sich vor Begeisterung. In Paris werden Luxus-Reiseführer unter den Journalisten verteilt – auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch. Schon bald kaufen sich Reisende die ersten Zugtickets. Denn auch wenn sich der Bau noch bis 1916 hinzieht: Ab 1903 können die Touristen schon lange Teilstrecken zurücklegen. 4 O-TON Wenn man sich die westlichen Berichte anschaut, und wir haben vor allem westliche Berichte, weil in Russland wurde viel weniger darüber geschrieben und diskutiert, dann ist es tatsächlich dieser Traum, den wir auch bei Jules Verne finden. Diese Technik, die uns eben hilft, Raum und Zeit zu erobern und auch diese Faszination, dass dieses Russland, was lange Zeit als unterentwickeltes Land galt, dass Russland die Ressourcen und das Knowhow aufbringt, um dieses gewaltige Verkehrsprojekt zu realisieren. SPRECHER Auf der Strecke sind auch Luxuszüge einer belgischen Firma, der Compagnie Internationale des Wagons-Lits, unterwegs – sie bieten alle Annehmlichkeiten eines Vier-Sterne-Hotels. An Bord gibt es ein Klavier, eine kleine Bibliothek, in manchen Wägen sogar einen Raum mit Fitnessgeräten für die müde gesessenen Beinen. Im Speisewagen bringt einem das Personal im Frack und weißen Handschuhen ein mehrgängiges Menü. Auf der langen Reise haben die Touristen genug Zeit, um ihre Gedanken festzuhalten. Der Engländer Harry de Windt beschreibt 1901 seine Fahrt mit der Transsib in „From Paris to New York by Land“. Er ist erstaunt darüber, dass Sibirien ganz anders ist als angenommen: ZITATOR Klimatisch ist die Reise wunderbar in der Winterzeit, dann zeigt sich Sibirien von seiner besten Seite. Nicht das Sibirien des englischen Dramatikers, mit heulenden Schneestürmen, angeketteten Verurteilten, Wölfen und Peitschen, sondern ein lächelndes Land voller Versprechen und Fülle, sogar unter den endlosen Schneedecken. Die Landschaft ist natürlich öde, aber an den meisten Tagen ist der Himmel blau und wolkenlos und es scheint eine strahlende Sonne, die man so oft vergeblich an der Riviera sucht. SPRECHER Die Transsibirische Eisenbahn beschreibt De Windt als „fahrenden Luxuspalast“. Abends versammelt man sich ums Klavier, und die Stunden vergehen schnell, wenn man den russischen Frauen beim Singen und Spielen zuhört, Glinka und Tschaikowsky. In „From Paris to New York by Land“ beschreibt de Windt aber auch, dass es in der Transsib oft langweilig ist - und wie das auf die Stimmung drücken kann. ZITATOR Alles ist sehr traurig und deprimierend, vor allem, wenn man gerade frisch aus Europa kommt. Der Zug hat einen Vorteil, er rattert und knattert nicht, während er sich wie ein stilles Gespenst durch die desolaten Steppen stiehlt. Als Heilmittel gegen Schlaflosigkeit wäre er unschätzbar, und wir schlafen viel. 6 O-TON Das war natürlich kein ICE und auch kein TGV, das waren sehr langsame Geschwindigkeiten, die die Passagiere dort erlebten. Es ist auch sehr abhängig von den Zügen. Die Züge der höheren Klasse fuhren vielleicht maximal 80 Stundenkilometer, aber die meisten Züge waren noch viel langsamer unterwegs, weil auch die Gleise und das Gleisbett keine höhere Geschwindigkeit zugelassen haben, also man zuckelte relativ gemütlich durch die Landschaft. SPRECHER Mit den Reisenden ändert sich auch das Sibirienbild. 7 O-TON In Russland hat sich langsam dieses Bild von Sibirien als das Reich der Kälte und das größte Gefängnis der Welt verändert und wurde ersetzt durch ein Bild, das vergleichbar ist mit dem Wilden Westen in Amerika, also das war dann Russlands wilder Osten. Das heißt: Man träumte davon, dass dieses Sibirien, das ja so dünn besiedelt ist und wie ein weißes Blatt Papier daliegt, dass das ein Raum ist, wo ganz neue große Projekte zu realisieren sind und man darauf hoffte, dass Sibirien wirklich so dieses russische Zukunftsland wird. SPRECHER Doch für diesen Traum vom Zukunftsland müssen viele hart anpacken. Zum Höhepunkt des Baus 1895/96 arbeiten 80.000 Männer gleichzeitig an der Transsib. Beim Bau der Eisenbahn seien so viele Arbeiter gestorben, schreiben sowjetische Historiker, dass die Schienen geradezu auf Knochen verlegt seien. Das ist wohl übertrieben und sollte vor allem das Zarenreich in ein schlechtes Licht rücken. Doch ein raues Leben war es allemal. Die Arbeiter leben in Erdhütten, viele sterben an Krankheiten und Erschöpfung. 8 O-TON Die Arbeiter spielten kaum eine Rolle, das ist aber auch relativ typisch für diese großen Infrastrukturprojekte, dass man oft die Ingenieure der Eisenbahnbrücken feierte und die Administratoren, die verantwortlich waren, diese Entscheidungen zu treffen, aber über die Menschen, die wirklich die Arbeit gemacht haben, diese Bahn zu bauen, über die hat man sehr wenig gesprochen. SPRECHER Auf den Baustellen trifft man auf italienische Steinmetze, russische Bauern, Chinesen und Mongolen – und Sträflinge. 20.000 Gefangene arbeiten auf den Baustellen. Der Reisende Sir Henry Norman behauptet, zivilisierte Menschen trügen in der Gegend einen Revolver und Vorsichtige sogar zwei. Doch das ist nicht die einzige Gefahr. 9 O-TON Es gab Unfälle, das hatte auch damit zu tun, weil die Devise war: so schnell und so billig wie möglich diese Bahn zu bauen. Das heißt, man baute einspurig, das war eine einspurige Bahnlinie an vielen Strecken, und man baute mit sehr leichtem Material, und das führte natürlich zwangsläufig dazu, dass die Bahn nicht so sicher war wie Bahnlinien, die solider konstruiert waren. SPRECHER Für eine Baustelle hätte man sich kaum schwierigere Bedingungen aussuchen können: Tauende Permafrostböden, meterhohe Hochwasser, Erdrutsche und Temperaturen bis -50 Grad. Der Baikalsee ist eine besondere Herausforderung. Bis die Schienen entlang des Ufers so weit sind, transportiert man die Passagiere im Winter mit Pferdeschlitten übers Eis. Weil man beim Bau an Material spart, ereignen sich häufig Unfälle. Wenn die Züge wegen der Unfallgefahr langsamer fahren, dauert die Fahrt von Moskau nach Wladiwostok statt einer Woche schon mal einen Monat. MUSIK SPRECHER Nicht alle Reisenden fahren mit den Luxuszügen der Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Die meisten Passagiere nutzen die einfachen Züge der Russischen Staatsbahn. So auch die etwa drei Millionen Menschen, die mithilfe der Transsibirischen Eisenbahn umgesiedelt werden. Es sind bäuerliche Kolonisten aus der Ukraine, Weißrussland oder dem Westen der russischen Gouvernements. Der Reisende Richard Penrose beschreibt 1901 in „The Last Stand of the Old Siberia“ die Ausmaße dieser Migration: ZITATOR Die Zahl der Auswanderer steigt rapide, alle Züge und Boote sind überfüllt, und entlang der Flüsse sieht man viele Emigranten, die auf Flößen ihrem neuen Heim entgegentreiben, mit Familien, Pferden, Schweinen und ihrem ganzen Hausrat. SPRECHER Die Armut treibt die Auswanderer nach Sibirien. Sie erhoffen sich eine bessere Zukunft und eine neue Heimat. Nur gehört diese Heimat schon jemandem: der angestammten, nomadischen Bevölkerung, die oft vertrieben wird. 10 O-TON Es ging natürlich darum, diesen Raum, der als wild, als barbarisch und unzivilisiert beschrieben wurde, den zu erschließen, mit bäuerlichen Kolonisten aus dem Westen des Zarenreiches, und diese Kolonisten stellte man sich vor als Kulturbringer, die also die europäische Zivilisation in diese asiatischen Gebiete brachten, aber man nahm natürlich auch die Urbevölkerung dort wahr. Und die waren im russischen Diskurs ähnlich wie die „Indianer“ in Amerika, die galten als Wilde, galten als unzivilisiert, und die hoffte man mithilfe dieser modernen Technik und dieser ganzen Infrastruktur, die diese Technik auch bringt, auf ein höheres Zivilisationsniveau zu bringen im Duktus der damaligen Zeit. SPRECHER Der ganz große Handelsboom, den man sich von der Transsib verspricht, tritt nicht ein. Doch viele profitieren vom Handel. Besonders landwirtschaftliche Produkte laufen gut. Die Butter aus Sibirien ist legendär, sie wird mit speziellen Kühlwaggons auf die europäischen Großmärkte gebracht, darunter London. Mit der Eisenbahn kommt für viele Städte der Aufschwung. Einige werden ganz neu gegründet – zum Beispiel das heutige Nowosibirsk, das an der Kreuzung der Bahnlinie mit dem Fluss Ob liegt. 11 O-TON Das war erst mal eine Eisenbahnsiedlung, die aus wenigen Barracken bestand. 1891 begann man ja mit dem Bau und diese Stadt hatte 1900 bereits 18.000 Einwohner. Das heißt, wir sprechen hier von einem Städteboom in Sibirien, das zog sich entlang der Bahnlinie bis nach Wladiwostok fort, der vergleichbar ist mit der Urbanisierung und mit dem Explodieren der Städte auf dem nordamerikanischen Kontinent in der gleichen Zeit. Da erleben wir ähnliche Prozesse, wie Städte aus dem Bode schießen wie Pilze und das ist natürlich im Wesentlichen der Transsibirischen Eisenbahn zu verdanken. SPRECHER Aus halbvergessenen Orten werden über Nacht blühende Handelszentren. In vielen sibirischen Städten gibt es Zeitungen, Büchereien, Kinos, Schulen, Hospitäler und Museen. Doch die Transsib schafft nicht nur Gewinner. Manche bekommen von der Eisenbahn wenig mit. Die Verlierer, weit weg von den Bahnlinien, versinken langsam in der Bedeutungslosigkeit. 12 O-TON Das schönste Bild hat eigentlich Tschechow geschaffen mit seinem „Kirschgarten“, wo man dieses Bild hat von dieser Datscha des alten Russlands, die weit weg liegt von einer Eisenbahnlinie und man hört nur in der Ferne den Klang der Lokomotive und damit hat Tschechow eben deutlich gemacht, dass dort, wo die Zukunft und das Leben und die Dynamik ist, das ist da, wo die Eisenbahn ist, und in der russischen Provinz hat die Eisenbahn nicht hingefunden und das ist der Ort, wo das Leben langsam stillsteht. SPRECHER Die Transsibirische Eisenbahn soll nicht nur die Wirtschaft ankurbeln. Sie soll sich auch militärisch lohnen und Gebiete im Fernen Osten sichern. Doch der Plan geht nicht auf. Ein Teil der Eisenbahn führt über chinesisches Territorium, bis zum Gelben Meer – ein Gebiet, auf das die Japaner ein Auge geworfen haben. 13 O-TON Die Japaner haben das mit großem Argwohn gesehen, dass sich die Russen dort ausbreiten in der Region, und ein wesentlicher Anlass auch dieses Kriegs, der dann ausbrach – Japan überfiel ja dann Russland – ein wesentlicher Anlass war eben der Bau dieser Bahnlinie. Das heißt, man hatte eigentlich die Bahn gebaut, um diese Gebiete sicherer zu machen und letztendlich war der Bau dieser Bahn der Anlass für den Krieg, der für Russland fatale Folgen hatte. SPRECHER 1905 verliert Russland den Krieg mit Japan. Und noch ein Kalkül geht nicht auf: Die Eisenbahn soll die Herrschaft des Zaren stärken. Doch mit der Transsib transportiert man auch umstürzlerische Flugblätter, viele Eisenbahnarbeiter werden Revolutionäre: Sie rufen 1905 an vielen Orten in Sibirien unabhängige „Republiken“ aus. 1917 bricht die Revolution aus. Der letzte Zar, Nikolaus II., wird ein Jahr später von den Bolschewiki erschossen. Die Revolutionswirren wirken sich auch auf die Bahn aus. 14 O-TON Zunächst brach der Einstrom von westlichen Touristen auf der Bahnlinie komplett ein und die Bahn diente anderen Zielen, sie diente zum Beispiel auch dem Ziel, dass die Menschen, die aus Russland flohen, die alte Elite, dass die zum Teil auf der Transsibirischen Eisenbahn bis nach Wladiwostok fuhren oder weiter nach Schanghai, um dann ins Ausland zu kommen und sich vor den Bolschewiki zu retten, und es dauerte dann doch einige Zeit, bis man die Transsibirische Eisenbahn wieder in einen zivilen Zustand versetzte.

Bedømt til 4,7 stjerner i App Store
Begrænset tilbud
1 måned kun 9 kr.
Derefter 99 kr. / månedIngen binding.
Eksklusive podcasts
Uden reklamer
Gratis podcasts
Lydbøger
20 timer / måned