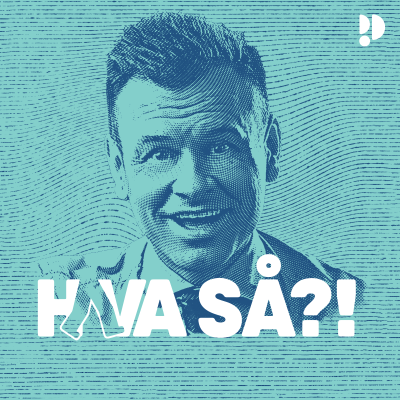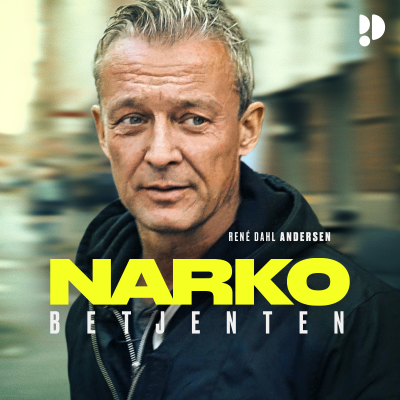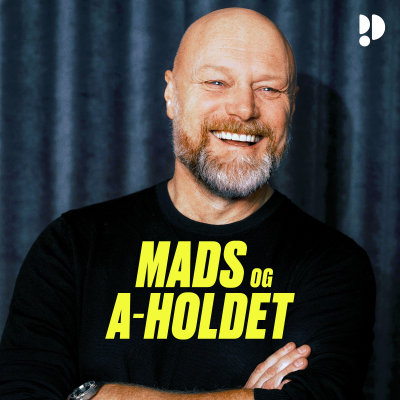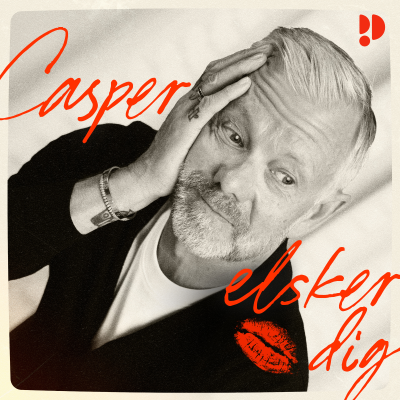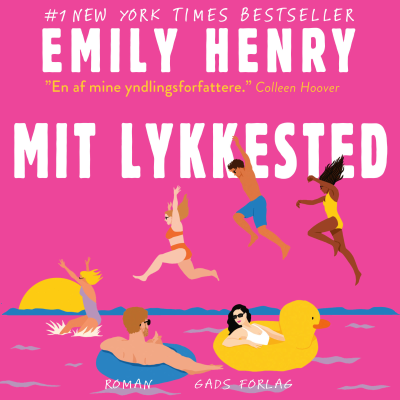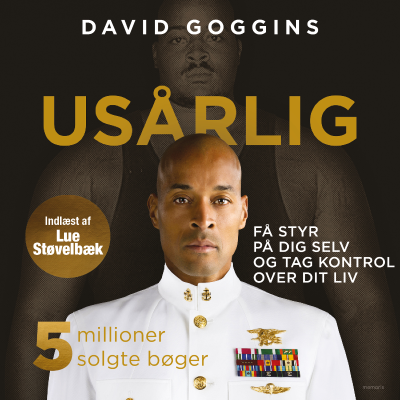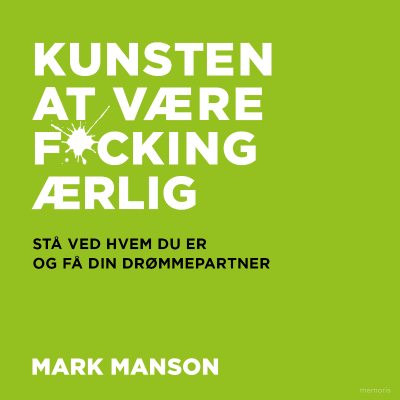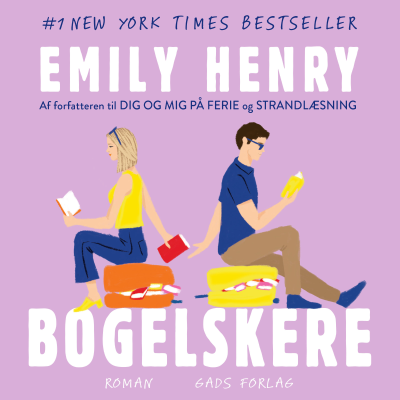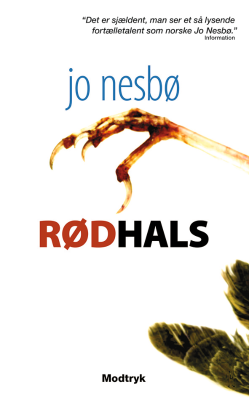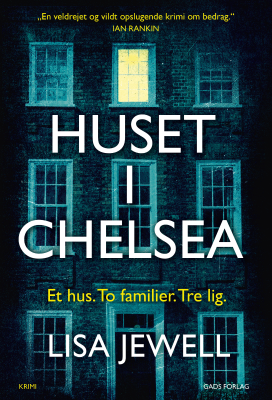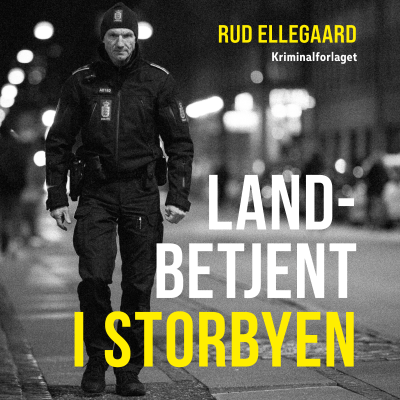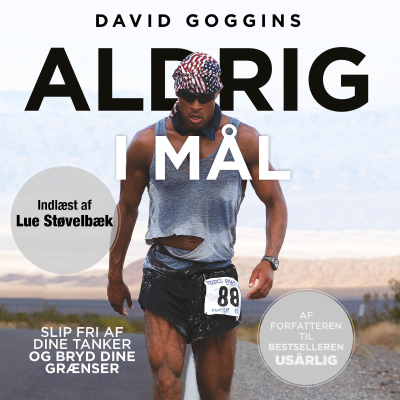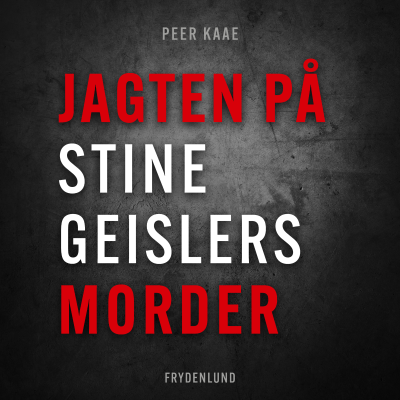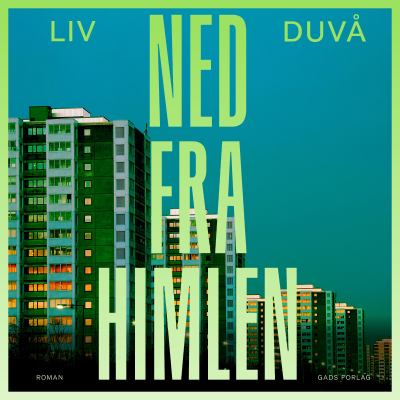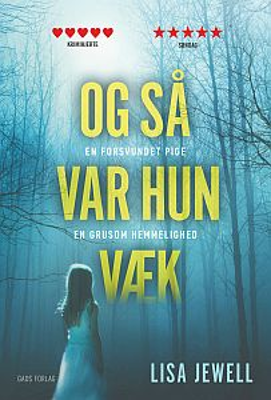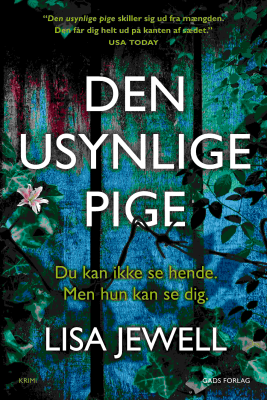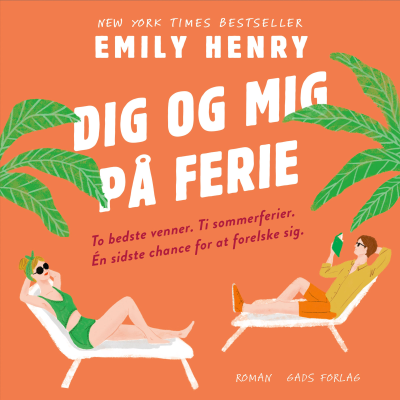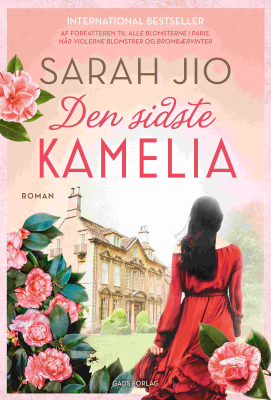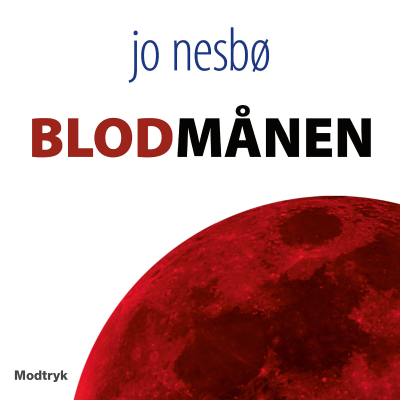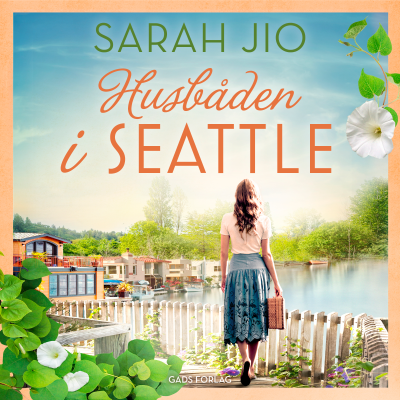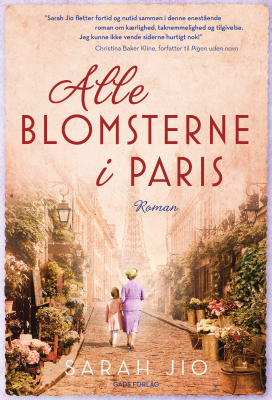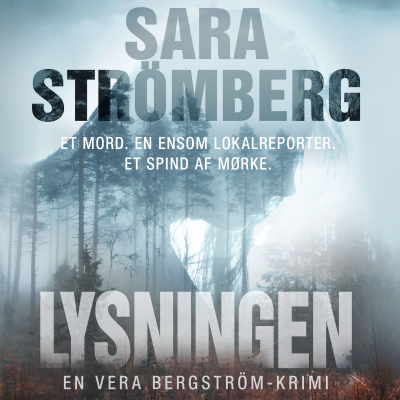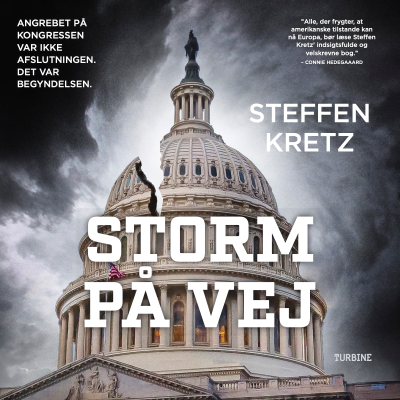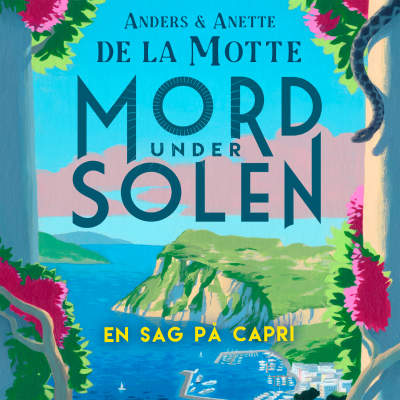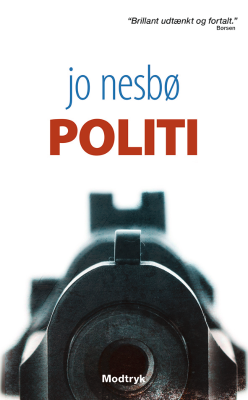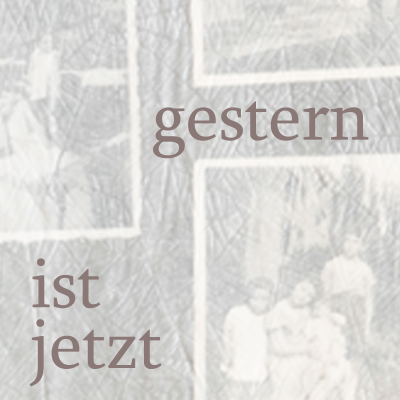
gestern ist jetzt
Podcast af Melanie Longerich, Brigitte Baetz
Prøv gratis i 7 dage
99 kr. / måned efter prøveperiode.Ingen binding.

Mere end 1 million lyttere
Du vil elske Podimo, og du er ikke alene
Rated 4.7 in the App Store
Læs mere gestern ist jetzt
Seit 75 Jahren ist der Nationalsozialismus Geschichte - und doch wirkt er bis heute weiter - im eigenen Leben, in den Familien. Der Podcast "gestern ist jetzt" erzählt von der Suche nach Antworten darauf, wie sich unsere eigenen Großväter im Nationalsozialismus verhalten haben. Und soll auch Dich bei Deiner Suche weiterbringen - dank der Unterstützung vieler Historiker, Sozialwissenschaftlerinnen, Psychologinnen und Archivare - aber und anderer recherchierender Enkel*innen, die schon viel weiter sind als wir. Wir, das sind Melanie Longerich und Brigitte Baetz - zwei Journalistinnen aus Köln.
Alle episoder
30 episoderVon Netzwerken, Verstrickungen und Freisprüchen Links und Hintergründe Unser Gast heute: die Historikerin Nele Maya Fahnenbruck [http://gesternistjetzt.de/nele-maya-fahnenbruck/], die vor zehn Jahren ihre Doktorarbeit zum Reiten im Nationalsozialismus [https://www.werkstatt-verlag.de/buecher/weitere-sportarten/reitet-fuer-deutschland-pferdesport-und-politik-im-nationalsozialismus] geschrieben hat und heute Geschäftsführerin am Mahnmal St. Nikolai [https://www.mahnmal-st-nikolai.de/] in Hamburg ist. Post von Angela Die Künstlerin und Autorin Angela Findlay aus Großbritannien hat uns eine Sprachnachricht geschickt und über ihre Suche nach ihrem Großvater erzählt, der bei der Wehrmacht Karriere machte. Ihre Recherche könnt ihr auf Angelas Blog [https://angelafindlay.blog/] begleiten oder ihre Geschichte auch auf unserer Webseite [http://gesternistjetzt.de/] nachlesen, wo wir die Geschichte von Euren Großeltern [http://gesternistjetzt.de/angela-findlay-gloucestershire/] sammeln. Sie hat darüber auch schon auf Englisch ein Buch [https://www.penguin.co.uk/authors/245472/angela-findlay] veröffentlicht, das demnächst auch auf Deutsch [https://www.europa-verlag.com/Autor/6566/AngelaFindlay.html] erscheint. Die Grundlagen Die Dienstvorschrift der Kavallerie von 1882 wurde im Nationalsozialismus zur sogenannten Reitvorschrift H.DV. 12 [https://de.wikipedia.org/wiki/Reitvorschrift_H.Dv.12] und beschäftigt sich - neben allgemeinen Vorschriften zur Durchführung des militärischen Dienstes - schwerpunktmäßig mit der Ausbildung von Reiter und Pferd. Nach 1945 floss sie in die Ausbildungsregeln des heutigen Dachverbandes für Reiter, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reiterliche_Vereinigung] ein. Ausschlussmechanismen Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ [https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/juedisches-leben-in-deutschland-304/7687/1933-1945-verdraengung-und-vernichtung/], kurz Berufsbeamtengesetz (BBG), heute auch bekannt als sogenannter „Arierparagraph“ [https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ausgrenzung/arierparagraph/] wurde nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 7. April 1933 erlassen. Bei dem Titel des Gesetzes handelt es sich um einen irreführenden Kampfbegriff. Ein gutes Beispiel, wie Hamburger Reitvereine mit jüdischen Mitgliedern umgingen, ist der jüdische Kaufmann und Springreiter Eduard Pulvermann [https://www.abendblatt.de/hamburg/article107512346/Pulvermann-die-letzten-Geheimnisse-eines-Reiters.html]. Er gestaltete 1920 den Parcours für das Deutsche Spring-Derby [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Spring_Derby] in Hamburg [https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg]-Klein Flottbek [https://de.wikipedia.org/wiki/Klein_Flottbek], eines der schwersten Springreitturniere der Welt. Das Hindernis Nr. 14 trägt den Namen Pulvermanns Grab. Er wurde er 1941 von der Gestapo verhaftet und starb 1944 im KZ Fuhlsbüttel [https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Fuhlsbüttel]. NSRK Das Nationalsozialistische Reiterkorps (NSRK) [https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistisches_Reiterkorps] war eng mit der SA verbandelt. Ab 1936 fungierte er als reiterlicher Dachverband. Die Kontrahenten: SA, SS und Wehrmacht Hier findet ihr mehr zum Chef der SS-Hauptreitschule [https://de.wikipedia.org/wiki/SS-Hauptreitschule_M%C3%BCnchen], Hermann Fegelein [https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Fegelein], der eine steile Karriere bei der SS machte, Kriegsverbrechen beging [https://www.welt.de/geschichte/article229426705/Nazi-Schund-Uniform-von-Hitlers-Schwager-ist-eine-Faelschung.html] und zum Schluss zu Hitlers engsten Vertrauten gehörte - genutzt hat es ihm trotzdem nichts, Hitler ließ ihn kurz vor Schluss ermorden, weil Fegelein ihn angeblich an die Rote Armee verraten wollte. Pferde in der Wehrmacht Anders als die Propaganda der Wehrmacht gerne verbreitete, war sie viel weniger motorisiert als die Legende erzählt, Pferde waren ihr Haupt-Fortbewegungsmittel. Das Bundesarchiv geht davon aus, dass insgesamt auf deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg 2.800.000 Pferde [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Virtuelle-Ausstellungen/Pferde-Im-Einsatz-Bei-Wehrmacht-Und-Waffen-Ss/pferde-im-einsatz-bei-wehrmacht-und-waffen-ss.html] eingesetzt wurden. Verstrickungen und Netzwerke Die Mitglieder der Reiter-SS [https://de.wikipedia.org/wiki/Reiter-SS] waren an vielen Kriegsverbrechen und dem Holocaust beteiligt Mit der Veröffentlichung von Nele Fahnenbrucks Doktorarbeit [https://www.perlentaucher.de/buch/nele-maya-fahnenbruck/reitet-fuer-deutschland.html], waren die Verstrickungen der Reiter in den Nationalsozialismus und Kriegsverbrechen auch in vielen Medien Thema. Hier eine Auswahl von Artikeln, mehr findet ihr auf unserer Webseite [http://gesternistjetzt.de/nele-maya-fahnenbruck/]. Werner Langmaack: „Die unrühmliche Nazi-Vergangenheit des Reitsports“ [https://www.welt.de/regionales/hamburg/article118865635/Die-unruehmliche-Nazi-Vergangenheit-des-Reitsports.html], Die Welt, 11.08.2013. „Der Reitsport war anfällig für die NS-Machthaber“ [https://www.deutschlandfunk.de/der-reitsport-war-anfaellig-fuer-die-ns-machthaber-100.html], Gespräch mit Nele Maya Fahnenbruck im Deutschlandfunk, 16.3.2013. https://www.deutschlandfunk.de/der-reitsport-war-anfaellig-fuer-die-ns-machthaber-100.html [https://www.deutschlandfunk.de/der-reitsport-war-anfaellig-fuer-die-ns-machthaber-100.html] Erik Eggers, Michael Wulzinger: „Brauner Herrenreiter. Turnierveranstalter Paul Schockemöhle benannte einen Nachwuchspreis nach Carl-Friedrich von Langen. Der Plympiasieger von 1928 war bekennender Nazi“ [https://www.spiegel.de/sport/brauner-herrenreiter-a-053918c2-0002-0001-0000-000091346593], „Von Langen, ein ‚brauner Herrenreiter" [https://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/von-langen-ein-brauner-herrenreiter-1623136966], Die Glocke, 7.3.2013 Der Spielfilm "…reitet für Deutschland" [https://de.wikipedia.org/wiki/%E2%80%A6_reitet_f%C3%BCr_Deutschland] von Regisseur Arthur Maria Rabelnalt [https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Maria_Rabenalt] verfilmt ganz im Sinne der nationalsozialsozialistischen Ideologie das Leben von SA-Sturmbannführer und Olympiasieger Carl-Friedrich von Langen [https://de.wikipedia.org/wiki/Carl-Friedrich_von_Langen], der 1934 nach einem Sturz bei einem Military-Wettkampf starb. Recherche Wem das jetzt zu schnell ging mit Nele Fahnenbrucks Recherchetipps, kann sie in Ruhe nochmals in ihrem Profil auf unserer Webseite [http://gesternistjetzt.de/nele-maya-fahnenbruck/] nachlesen.
Von Werdegängen bei der Wehrmacht und schwierigen Wahrheiten Links und Hintergründe Unser Gast heute: Archivdirektor Thomas Menzel [http://gesternistjetzt.de/thomas-menzel/]. Er leitet das Referat MA 5 im Militärarchiv in Freiburg [https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Freiburg-im-Breisgau/freiburg-im-breisgau.html], das zuständig ist für die gesamte schriftliche Überlieferung der preußisch-deutschen Streitkräfte zwischen 1849 und 1949. Im Freiburger Militärarchiv Hier gibt es einen guten Überblick, [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen.html] über die Bestände. So unterschiedlich wie die Einsätze und Einsatzorte der Soldaten fallen auch ihre zu Papier gebrachten Erfahrungen aus. Eine gute Einordnung findet ihr auf der [Seite der BpB](). NS-Militärjustiz Beim der Wehrmacht waren Kriegsgerichte jeder Division und dort dem jeweiligen Stab zugeordnet. Die 1918 abgeschafften Standgerichte wurden 1939 wieder eingeführt, als spontane Gerichte für Einzelfälle, aber zuständig für alle Delikte des Strafrechtes. Sie verurteilten Zehntausende beispielsweise wegen angeblichen „Kriegsverrats“ oder als Deserteure, Kriegsdienstverweigerer oder „Wehrkraftzersetzer“. Insgesamt 20 000 deutsche Soldaten wurden zum Tode verurteilt. Eine vermutlich ebenso große Zahl wurde in KZ, Straflager oder Strafbataillone gesteckt. Etwa 4000 von ihnen waren bei Kriegsende noch am Leben. Die, die nicht zum Tode verurteilt wurden, gelten lange als Kriegsverbrecher. Eine Entlastung durch die Bundesrepublik scheiterte lange an politischem Dissens, so dass Wehrmachtsdeserteure per Gesetz erst 2002 rehabilitiert [https://www.deutschlandfunkkultur.de/opfer-der-ns-militaerjustiz-langer-kampf-um-rehabilitierung-100.html] wurden. Der lang anhaltende Widerstand war vor allem aus den Reihen der Union gekommen. Grund für die späte Rehabilitation der Opfer der NS-Militärjustiz [https://www.welt.de/politik/deutschland/article4479688/Spaete-Rehabilitierung-von-Opfern-der-NS-Justiz.html] war zunächst jene Rechtfertigungsgesinnung, die der einstige NS-Marine-Richter und frühere baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Hans Filbinger [https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/ns-vergangenheit-die-affaere-filbinger] mit dem Satz offenbarte: „Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein.“ Filbinger, der selbst in Todesurteile verstrickt war, musste 1978 zurücktreten. Kriegsverbrechen Die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen [https://zentrale-stelle-ludwigsburg.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite] ist seit mehr als 60 Jahren damit beauftragt, Vorermittlungen zu nationalsozialistischen Verbrechen zu führen. Mit dem Ziel, auch heute noch lebende Täter und Gehilfen der massenhaften Morde ausfindig zu machen [https://www.deutschlandfunkkultur.de/zentrale-stelle-zur-aufklaerung-von-ns-verbrechen-100.html]. Seit einiger Zeit hat die Aufklärungsstelle ihr Aufgabengebiet erweitert [https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-02/ns-verbrechen-aufklaerung-ludwigsburg-erweiterung] und will auch Morde in Kriegsgefangenenlagern, speziell von sowjetischen Kriegsgefangenen, der Wehrmacht und der sogenannten Einsatzgruppen untersuchen. Recherchetipps Bei militärischen Unterlagen ist das für Laien manchmal etwas schwierig zu durchblicken, welcher Standort des Bundesarchivs überhaupt zuständig ist. Hier findet Ihr einen Überblick [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen.html], in dem erklärt wird, wieso es überhaupt zu den unterschiedlichen Zuständigkeiten kam. Hier findet ihr den Benutzungsantrag [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Downloads/Rechtliches/benutzungsantrag.pdf?__blob=publicationFile] und den "Auftrag für eine Recherche über Militärangehörige" [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Downloads/Benutzen/antrag-persbez-recherche-militaer.pdf?__blob=publicationFile] . Beides müsst Ihr ausfüllen und ans Bundesarchiv schicken, die e-Mailadresse findet ihr hier [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen.html]. Das Suchportal Invenio [https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/login.xhtml] ist nicht so einfach zu bedienen, mit einer simplen Stichwortsuche kommt man nicht weit. Wie man erfolgreicher sucht, sollte die Topps von Thomas Menzel befolgen - und sich etwas in den Aufbau des Archivs eindenken. Unterlagen im Ausland Während und nach dem Zweiten Weltkrieg brachten die Alliierten gefundene Akten des Deutschen Reiches in Sicherheit, viele davon wurden auch nach Russland gebracht. Während die Dokumente der Westalliierten nach und nach ans Bundesarchiv übergingen, befinden sich die russischen Sammlungen dieser sogenannten Trophäendokumente weiterhin in verschiedenen Föderalen Archiven der Russischen Föderation, wie zum Beispiel im Staatsarchiv der Russischen Föderation – GARF, im russischen Staatsarchiv für sozialpolitische Geschichte – RGASPI, im staatlichen Militärarchiv der Russischen Föderation – RGVA sowie dem Zentralarchiv des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation – CAMO. Seit 2011 läuft ein gemeinsames deutsch-russisches wissenschaftliches Projekt zur Digitalisierung der in Russland aufbewahrten deutschen Dokumente. Eine Auswahl findet ihr hier [https://germandocsinrussia.org/de/nodes/1-russisch-deutsches-projekt-zur-digitalisierung-deutscher-dokumente-in-den-archiven-der-russischen-foderation]. Die Zentralnachweisstelle (ZNS) [https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralnachweisstelle] in Aachen war eine Einrichtung des Bundesarchives und wurde Ende 2005 aufgelöst. Ursprünglich war sie dafür zuständig, Beschäftigungs- und Versicherungsnachweise für Angehörige von Wehrmacht und Waffen-SS, aber auch von Reichsarbeitsdienst [https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsarbeitsdienst] und Organisation Todt [https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ns-organisationen/organisation-todt.html] zu erstellen. Daneben stellte die ZNS Informationen für die Strafverfolgung von NS-Tätern zur Verfügung. Benjamin Haas - Der Rechercheur Benjamin Haas leitet seit 2008 seinen Recherchedienst von Freiburg aus, er ist spezialisiert auf militärische Werdegänge. Auf unserer Webseite [http://gesternistjetzt.de/benjamin-haas/] erfahrt ihr mehr über seine Arbeit, dort gibt's auch ein Video. Alle Archivdienste, mit denen das Bundesarchiv zusammenarbeitet, findet ihr hier [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/recherchedienste-beauftragen.html].
Wie lesen, wie interpretieren? Tipps vom Historiker Janosch Steuwer Links und Hintergründe Unser Gast heute: Janosch Steuwer [http://gesternistjetzt.de/janosch-steuwer/], Historiker und Tagebuchforscher von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er hat seine Doktorarbeit zu Tagebüchern zwischen 1933 und 1939 geschrieben. Und ist unter dem Titel „Ein Drittes Reich, wie ich es auffasse“. Politik, Gesellschaft und privates Leben in Tagebüchern 1933-1939 [https://www.wallstein-verlag.de/9783835330030-ein-drittes-reich-wie-ich-es-auffasse.html] auch im Wallstein Verlag erschienen und wurde mehrfach ausgezeichnet. Auf unserer Webseite [http://http://gesternistjetzt.de] erklärt Janosch auch in einem Video, worauf es beim Tagebuchlesen ankommt. Tagebuchschreibende im NS In der Nachkriegszeit setzte sich das Bild durch, dass Tagebuchschreiben in der NS-Zeit etwas sehr Gefährliches war, dass vor allem Regimekritiker*innen taten. Beeinflusst war diese Annahme von George Orwels' Buch "1984" [https://www.deutschlandfunkkultur.de/70-jahre-1984-george-orwells-dystopie-aktuell-und-100.html], wo das Tagebuch zum einzigen Rückzugsort in einer totalitären Überwachungsstart wird. In #8 [http://gesternistjetzt.de/8-nsdap/] und #9 [http://gesternistjetzt.de/9-nsdap-2/] haben uns es der Historiker Armin Nolzen [http://gesternistjetzt.de/armin-nolzen/] und der Politikwissenschaftler Jürgen Falter [http://gesternistjetzt.de/juergen-falter/] erklärt, wie die NSDAP und ihre Organisationen bis in die kleinsten gesellschaftlichen Verästelungen eindrangen und zum Bekenntnis aufforderten. Buchtipp: Johannes Hürter, Leiter der Forschungsabteilung München des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin hat 2021 Tagebücher und Briefe von Marta und Egon Oelwein herausgegeben, die das Paar zwischen 1939 und 1945 schrieben. "Im Übrigen hat die Vorsehung das letzte Wort…" [http://https://www.wallstein-verlag.de/9783835339514-im-uebrigen-hat-die-vorsehung-das-letzte-wort.html] zeigt das Leben einer nationalsozialistischen Familie im "Dritten Reich", die sich komplett der "Volksgemeinschaft" einfügte. Rezension [https://www.deutschlandfunk.de/johannes-huerter-u-a-im-uebrigen-hat-die-vorsehung-das-letzte-wort-dlf-1f97be34-100.html] von Melanie im DLF. Herausforderungen und Reaktionen Die DNVP, die Deutschnationale Volkspartei, [https://www.weimarer-republik.net/themenportal/personen-who-is-who-der-weimarer-republik/parteien/dnvp/] die auch Melanies Großvater bis 1933 wählte, war an einigen Regierungen der Weimarer Republik [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/18468/weimarer-republik/] beteiligt, obwohl sie deren Verfassung und auch den Versailler Vertrag [https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/18413/versailler-vertrag/] ablehnte. Die DNVP unterstützte die sogenannte Machtübernahme der NSDAP. Wer Lust hat auf mehr… schaut doch mal auf unsere Webseite [http://gesternistjetzt.de/eure-grosseltern/], da gibt es viele Geschichten von euch und euren Großeltern und unsere Profis [http://gesternistjetzt.de/profis/] geben viele Recherchetipps.
Die ehemalige WASt und ihre Unterlagen Links und Hintergründe #27 - Die Abteilung PA im Bundesarchiv (ehem. WASt) Unser Gast heute: Birgit Wulf, stellv. Referatsleiterin PA1 (Link) Die Deutsche Dienststelle (WASt) wurde zum 1. Januar 2019 in die Abteilung „Personenbezogene Auskünfte“ des Bundesarchivs in Berlin überführt. Bis 2023 soll der Umzug von Berlin-Reinickendorf [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Ueber-uns/Dienstorte/berlin-reinickendorf.html] nach Tegel komplett abgeschlossen sein. Personenbezogene Unterlagen Bei den Beständen [http://http://gesternistjetzt.de/wp-content/uploads/2022/12/2022_Bestaende-PA-Tegel.pdf] handelt es sich vor allem um sogenannte personenbezogene Unterlagen, das heißt, es müssen immer die Schutzfristen beachtet werden. Deshalb waren die Bestände auch lange nicht digitalisiert, aber es werden immer mehr, geplant ist, dass man mit einer speziellen Genehmigung des Archivs diese dann auch von Zuhause aus über das Suchportal Invenio [https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/login.xhtml] einsehen kann. Die wichtigsten Unterlagen, die Ihr dort finden könnt: Zentrale Personenkartei: Kernbestand für die Auskunftserteilung der Abteilung PA sind die in der WASt bzw. Deutschen Dienststelle gesammelten ca. 150 Millionen Verlustmeldungen einschließlich Vermisstmeldungen militärischer Einheiten und Sanitätsformationen sowie die ca. 100 Millionen Veränderungsmeldungen in den Erkennungsmarkenverzeichnissen aus den Jahren 1939 bis 1945. Bereits während des Krieges wurde zu jeder Einzelmeldung eine Karteikarte für die Zentrale Personenkartei (Z-Kartei) [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Ueber-uns/Aus-unserer-Arbeit/z-kartei-pa.html] angelegt, die heute Angaben zu mehr als 18,5 Millionen Angehörigen der ehemaligen deutschen Wehrmacht und anderer militärähnlicher Verbände enthält. Gräberkartei: Nach dem Krieg galt die Gräberkartei [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Ueber-uns/Aus-unserer-Arbeit/graeberkartei-pa.html] lange Zeit als verschollen, so dass die Deutsche Dienststelle mit allen Informationen, die sie finden konnte, eine sogenannte Ersatzgräberkartei aufbaute, die inzwischen auf etwa 4,5 Millionen Karten angewachsen ist. Nach dem Mauerfall fand sich die Originalkartei im Zentralen Staatsarchivs der DDR - und ist somit erhalten. Unterlagen über Kriegsgefangene: Nach Kriegsende wurden sämtliche Unterlagen beschlagnahmt, welche die WASt über all die Menschen geführt hatte, die in deutscher Kriegsgefangenschaft waren - um sie dann den jeweiligen Herkunftsländern der Kriegsgefangenen zu übergeben. Ab 1950 erhielt die Deutsche Dienststelle ihrerseits von den westlichen Siegermächten, d.h. aus Großbritannien, Frankreich, Belgien und den USA, Unterlagen über deutsche Kriegsgefangene und Internierte. Unterlagen über deutsche Kriegsgefangene und Internierte in sowjetischem Gewahrsam wurden der Deutschen Dienststelle hingegen nicht übergeben. Die liegen heute noch in den russischen Archiven. Ihr danach sucht, müsst Ihr Euch an den Suchdienst des DRK München [https://www.drk-suchdienst.de/wie-wir-helfen/suchen/zweiter-weltkrieg/kriegsgefangene-und-vermisste/] wenden. Vor dem Ukraine-Krieg standen deutsche und russische Archive allerdings im engen Austausch, derzeit aber ruht dieser. Weitere Archivbestände, ein Abkürzungsverzeichnis und die Nutzeranträge findet Ihr hier [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Ueber-uns/Aus-unserer-Arbeit/Textsammlung-Unterlagen-Abt-PA/unterlagen-abt-pa.html?chapterId=63002]. Der Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. [https://kriegsgraeberstaetten.volksbund.de/] wurde 1954 von der Bundesrepublik Deutschland damit beauftragt, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Der Volksbund hat eine frei zugängliche Onlinedatenbank mit fast fünf Millionen Datensätzen von gefallenen oder vermissten deutschen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges angelegt, die unter „Volksbund Gräbersuche online“ [https://www.volksbund.de/erinnern-gedenken/graebersuche-online] abgerufen werden können. Dabei handelt es sich v.a. um deutsche Militärangehörige, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind und für die eine Grablage auf einer deutschen Kriegsgräberstätte bekannt ist. Davon betreffen etwa eine Million Datensätze die Zeit des Ersten Weltkrieges. In den letzten Jahren kam zudem eine große Anzahl weiterer in den Jahren des Zweiten Weltkrieges gestorbener Militärangehöriger ohne bekannte Grablage sowie Vermisster hinzu. Bei der Ergänzung der Datensätze half die Deutsche Dienststelle [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Dienststelle_(WASt)] Berlin. Militärische Unterlagen - Standorte Hier findet Ihr einen guten Überblick über die Bestände zu militärischen Unterlagen der einzelnen Standorte [http://http://gesternistjetzt.de/wp-content/uploads/2022/12/2022_Personenbezogene-Unterlagen-1914-bis-1945.pdf] - damit Ihr wisst, wohin Ihr Euch wenden müsst. "Tessin" Die digitalisierte Version des Nachschlagewerks "Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS 1939–1945" [https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Militaerische-Verbaende-und-Einheiten/benutzen-speziell-milit-verbaende-einheiten-tessin.html] von Georg Tessin ist im Bundesarchiv einsehbar und bietet zwar keine lückenlosen, aber sehr umfangreiche Nachweise von Einheiten, Verbänden und Kommandobehörden und Angaben zu Unterstellungsverhältnissen. Grenzschutz Der Grenzschutz [https://www.zollgrenzschutz.de/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=105], oder genauer Zollgrenzschutz, war über die Finanzverwaltung organisiert und setzte sich überwiegend aus Beamten zusammen. Zu Beginn des Kriegs wuchs der Personalbedarf durch die Einsätze in den besetzten Gebieten stark an, sodass zunächst Hilfspersonal aus der nahen Grenzbevölkerung notdienstverpflichtet wurde. In den Folgejahren mussten junge Beamten und ehemalige Soldaten nach und nach an die Wehrmacht abgegeben werden. Die entstandenen Lücken wurden mit Notdienstverpflichteten aus immer älteren Jahrgängen aufgefüllt, so dass der Zollgrenzschutz in der letzten Hälfte des Krieges an der Basis kaum noch aus Beamten und gelernten Zöllnern bestand.
Links und Hintergründe # 26 - Displaced Persons Unsere Gäste heute: Florian Urbański, der uns heute von der Suche nach seinen Großeltern erzählt, die im Deutschen Reich Zwangsarbeit leisten mussten und in der Nachkriegszeit zu Displaced Persons, sogenannten "heimatlosen Ausländern", wurden. Die Historikerin Sarah Grandke [http://gesternistjetzt.de/sarah-grandke/] von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, forscht zu Displaced Persons mit Schwerpunkt Polen und Ukraine. Unfreiwilliger Neubeginn Nach ihrer Befreiung lebten die nach Deutschland deportierten Zwangsarbeiter*innen oft als "Displaced Persons" [https://www.bpb.de/themen/nationalsozialismus-zweiter-weltkrieg/ns-zwangsarbeit/227272/nach-1945-vergessene-opfer-vergessene-lager/#node-content-title-1] in Lagern und warteten auf ihre Repatriierung in ihre Heimatstaaten oder die Emigration ins westliche Ausland. Auf der Webseite des Arbeitskreises "Zukunft braucht Erinnerung" [https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/displaced-persons-im-besetzten-nachkriegsdeutschland/] gibt es einen guten Überblick mit weiterführender Literatur. Zwangsarbeit Florians Großmutter lebte ihm polnischen Łódź, als sie von den Nazis zu Zwangsarbeit verschleppt wurde. Sie arbeitete bis zum Kriegsende in unterschiedlichen Fabriken in Süddeutschland. Florians Großvater wurde aus der Kriegsgefangenschaft heraus in zivile Zwangsarbeit gezwungen. Offiziell war der Status von Kriegsgefangenen nämlich völkerrechtlich geregelt – und zwar in der Haager Landkriegsordnung [https://de.wikipedia.org/wiki/Haager_Landkriegsordnung] von 1907 und der Genfer Konvention [https://de.wikipedia.org/wiki/Abkommen_%C3%BCber_die_Behandlung_der_Kriegsgefangenen] von 1929. Danach mussten sie angemessen versorgt und nicht für sogenannte „unzuträgliche und gefährliche Arbeiten“ eingesetzt werden. Die Nazis aber argumentierten, dass der polnische Staat untergegangen, also kein Völkerrechtssubjekt [https://de.wikipedia.org/wiki/Völkerrechtssubjekt] mehr darstelle, und folglich wären die Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen auf sie nicht anzuwenden. Die polnischen Kriegsgefangenen verloren dadurch den zumindest völkerrechtlich geregelten Schutzbereich dieser Konvention, der vom Internationalen Roten Kreuz kontrolliert wurde, und waren aus NS-Sicht nur noch Zivilisten. 200.000 wurden anschließend als Zwangsarbeiter eingesetzt, die nach den rassistischen Polen-Erlassen [https://de.wikipedia.org/wiki/Polen-Erlasse] diskriminiert wurden. Mehr zum System Zwangsarbeit und zu den sogenannten Polen-Erlassen könnt Ihr übrigens nochmal in #25- Zwangsarbeit [http://gesternistjetzt.de/25-zwangsarbeit/] nachhören, da gibt Christine Glauning, Leiterin des Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin [http://gesternistjetzt.de/christine-glauning/] einen guten Überblick - auch über den langen Weg hin bis zur Entschädigung. Grundlagen Der Begriff Displaced Person (DP) wurde im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten geprägt. Als „DPs“ wurden in dieser Zeit Zivilpersonen bezeichnet, die sich kriegsbedingt außerhalb ihres Heimatstaates aufhielten und ohne Hilfe nicht zurückkehren konnten. Unmittelbar nach der Gründung der United Nations Relief and Rehabilitation Administration [https://de.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Relief_and_Rehabilitation_Administration] (UNRRA) wurde im November 1943 beschlossen, dass diese internationale Hilfsorganisation sich um Unterbringung, Versorgung und Rückführung in deren Heimat kümmern sollte, sobald die militärische Lage das zulassen würde. In DP-Lagern sollten Displaced Persons [https://de.wikipedia.org/wiki/Displaced_Persons] (DPs) nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs [https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg] vorübergehend in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien untergebracht werden. Hier [https://de.wikipedia.org/wiki/DP-Lager] hibt es einen guten Überblick über die einzelnen Lager. Mehr zum Thema jüdische Displaced Persons findet Ihr hier [https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/255388/juedische-displaced-persons/]. Die Schriftstellerin Natascha Wodin wurde Ende 1945 als Kind ukrainischer [https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/187210/ukrainische-displaced-persons-in-deutschland/] DPs in Fürth geboren, weil auch ihre Eltern aus Furch vor stalinistischer Verfolgung in Deutschland geblieben waren. In "Sie kam aus Mariupol" [https://www.rowohlt.de/buch/natascha-wodin-sie-kam-aus-mariupol-9783499290657] berichtet sie von ihrer Spurensuche nach der Herkunft ihrer früh verstorbenen Mutter, in "Irgendwo in diesem Dunkel" [https://www.deutschlandfunkkultur.de/natascha-wodin-ueber-ihr-vater-buch-der-mensch-gibt-das-100.html] von der noch ihrem Vater. Wer nochmal intensiver einsteigen will ins Thema DPs: Der Journalist Patrick Figaj erzählt in seinem Podcast "Tadschu" [https://www.tadschu.de/] die Geschichte seines Großvaters, der eine ähnliche Geschichte hat wie Florians Großvater. 1951 wurde das "Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer" [https://www.gesetze-im-internet.de/hauslg/BJNR002690951.html] in der Bundesrepublik verabschiedet. Nachdem fallen unter den Begriff "heimatlose Ausländer" [https://de.wikipedia.org/wiki/Heimatloser_Ausl%C3%A4nder] fremde Staatsangehörige oder Staatenlose [https://de.wikipedia.org/wiki/Staatenloser], die sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge und Verschleppte des NS-Regimes in der BRD und West-Berlin aufhielten. Zu Begriff und Kritik [https://www.spiegel.de/politik/behandelt-wie-ein-drittklassiges-pack-a-8e243274-0002-0001-0000-000014019660?context=issue] - hier lang. [https://de.wikipedia.org/wiki/Heimatloser_Ausl%C3%A4nder] Recherche Eine gute Anlaufstelle bei der Suche sind die Arolsen Archives [https://dpcampinventory.its-arolsen.org/] und auch das UN-Archiv [https://archives.un.org/content/unyivo-exhibition-displaced-persons] in New York. Sarah rät, sich immer auch an die Stadtarchive zu wenden, wo die Großeltern in DP-Lagern gelebt hatten. Meist wäre da nicht viel zu finden, weil die Materialien oft im Ausland sind, manchmal könnt Ihr trotzdem großes Glück haben. In Polen: Die Archive in Polen sind deutlich zentraler organisiert, gleichzeitig ist nicht immer sofort ersichtlich, wo welche Unterlagen liegen. Jede Wojwodschaft hat ein Staatsarchiv und auch jede Diözese hat ein Zentralarchiv. So gehen zum Beispiel nach 100 Jahren alle Kirchenbücher zentral an das Archiv der Diözese, regionale Unterlagen nach 100 Jahren an die Staatsarchive der Wojwodschaften. Außerdem gibt es noch diverse Spezial-Archive. Einen guten Überblick [https://www.dhi.waw.pl/fachinformation/historische-forschung-in-polen/archive/staatsarchive.html] bietet das Deutsche Historische Institut (DHI) in Warschau und die Seite mittelpolen.de. [https://www.mittelpolen.de/index.php/links] Was es in Polen nicht gibt, sind Stadt- und Regionalarchive. Man muss deshalb geduldig Schritt für Schritt recherchieren, wo welche Unterlagen liegen könnten, rät Florian. Auch die jeweils lokalen Standesämter sind immer noch eine Anfrage wert, wenn es um Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunden geht, die nicht älter sind als 100 Jahre. Noch ein Tipp von Florian zu polnischen Archiven: Er hat die Erfahrung gemacht, dass die deutlich bürokratischer sind als die deutschen. Es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man nachweisen kann, dass man mit der gesuchten Person direkt verwandt ist. Florian rät daher, dass man sich beim Standesamt sämtliche Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden, Familienbücher, kopieren lässt, die dann in der Summe das Verwandtschaftsverhältnis zwischen einem selbst und dem Gesuchten belegen. Und das dann in Polen einem beglaubigten Übersetzer vorlegt. Und das dann eben mit der Kopie des Originaldokumentes im entsprechenden Archiv einzureichen. Auch das Institut für Nationales Gedenken, IPN, [https://ipn.gov.pl/] eine gute Anlaufstelle, wenn man nach polnischen Opfern von Krieg und Kommunismus sucht. Das Zentrale Museum für Kriegsgefangene (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych) [https://www.cmjw.pl/zbiory/archiwalia/] in Oppeln/Opole, ist Museum und Archiv zugleich. Der Hintergrund ist, dass nach 1945 die gesamten deutschen Unterlagen über Kriegsgefangene an die jeweiligen Kriegsteilnehmer übergeben wurden, in dem Fall an die Volksrepublik Polen. Noch ein Tipp, wenn es um Kriegsgefangenschaft geht: Eine Anfrage beim Archiv der Internationalen Zentralstelle für Kriegsgefangene des Roten Kreuzes in Genf [https://www.redcrossmuseum.ch/]. Netz-Foren gibt es einige, zum Beispiel dpcamps.org, [www.dpcamps.org] in dem eine Nachkommin seit vielen Jahren die unterschiedlichsten Infos zu den verschiedenen Lagern sammelt. Hier erhaltet Ihr einen guten Überblick über einzelne Camps und könnt Euch vernetzen. Florian empfiehlt das forum.ahnenforschung.net [https://forum.ahnenforschung.net], weil es sehr breit aufgestellt ist und unter anderem eine eigene Kategorie zu Polen hat. Hier sind viele unterwegs, die schon länger suchen und auch Polnisch sprechen - und auch mal Vorlagen abgeben, bei Übersetzungen helfen. Die Seite Mittelpolen.de [https://www.mittelpolen.de/] hat zwar kein Forum mehr, aber stellt auf der Internetseite noch Tipps zur Verfügung. Ansonsten gibt es noch zahlreiche Internetseiten und Foren die sich teilweise speziell mit einzelnen polnischen Regionen befassen, da kann man aber auch bei Forum Ahnenforschung [https://forum.ahnenforschung.net] nachfragen. Für unsere Webseite [http://gesternistjetzt.de/eure-grosseltern/] hat Florian seine Suche nochmals aufgeschrieben. Hier findet Ihr auch die Geschichte anderer Enkelinnen und Enkel.

Rated 4.7 in the App Store
Prøv gratis i 7 dage
99 kr. / måned efter prøveperiode.Ingen binding.
Eksklusive podcasts
Uden reklamer
Gratis podcasts
Lydbøger
20 timer / måned