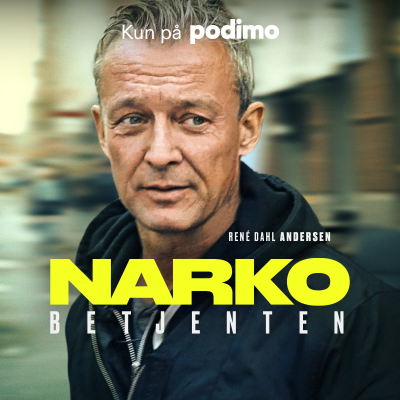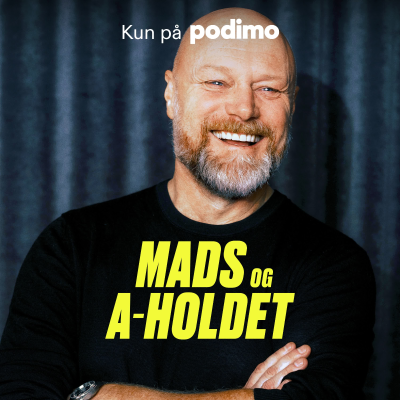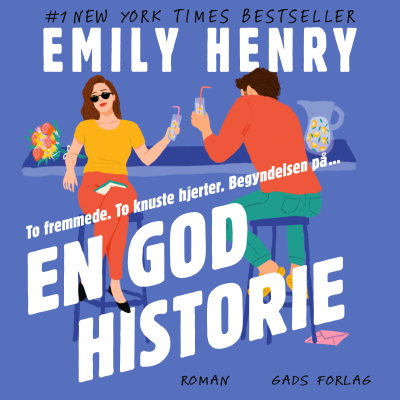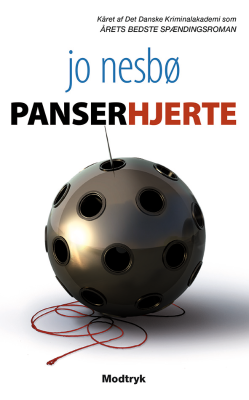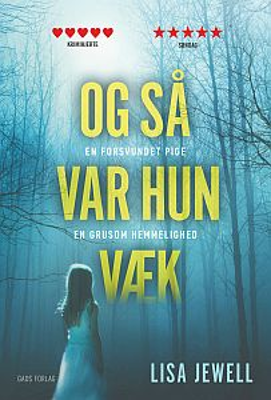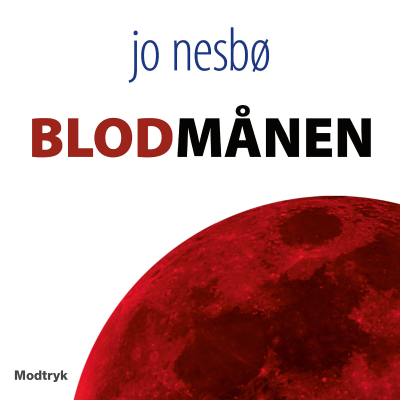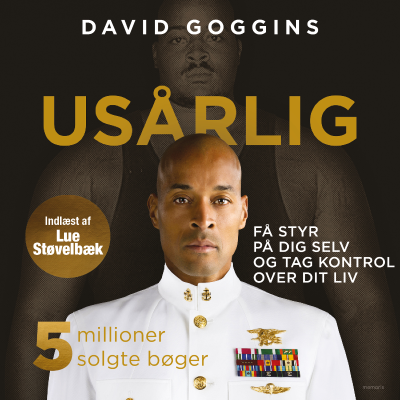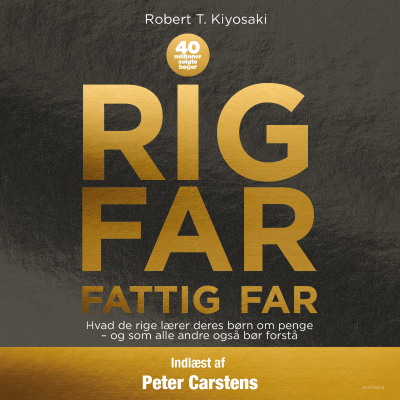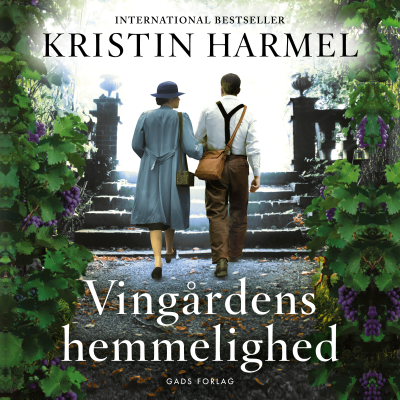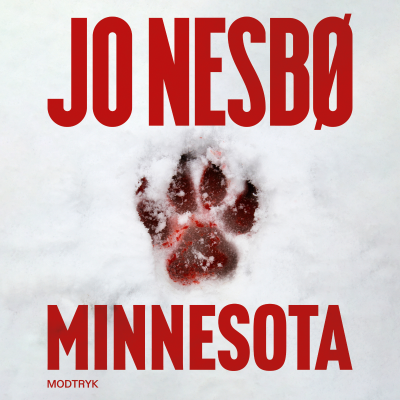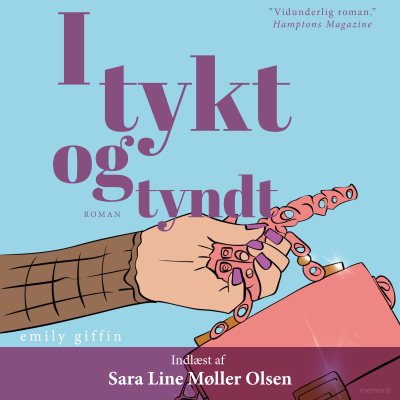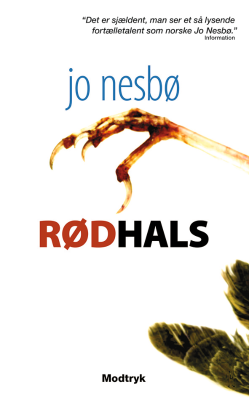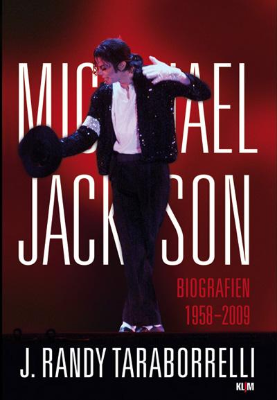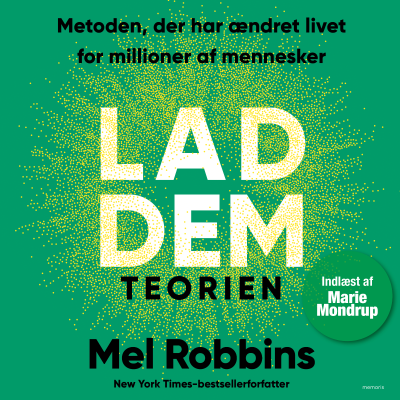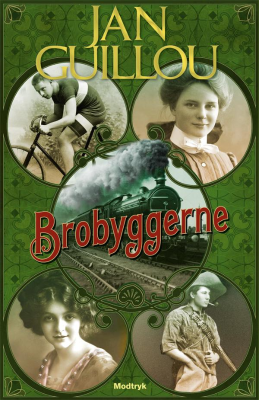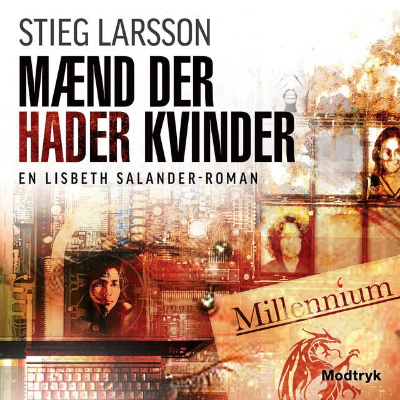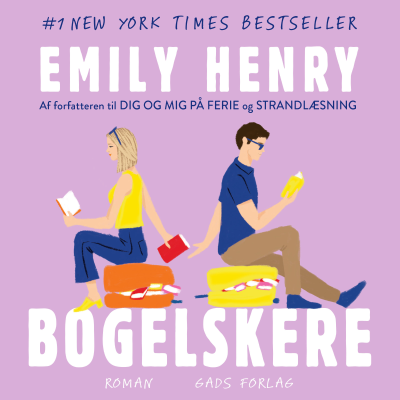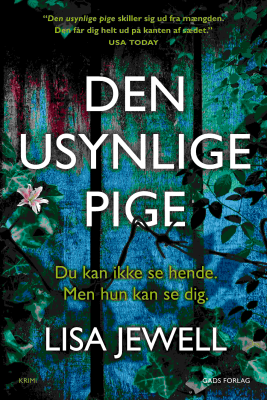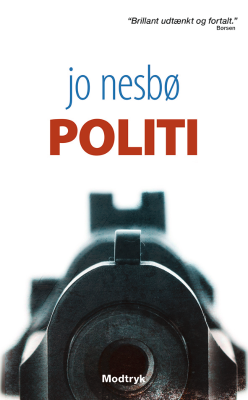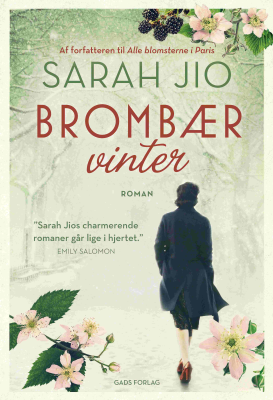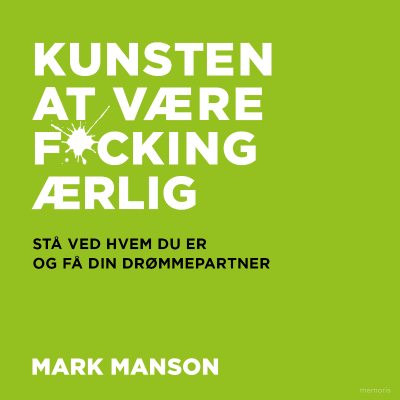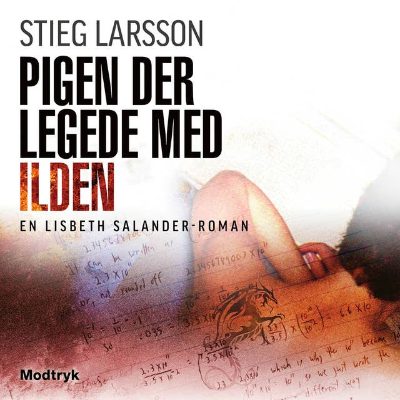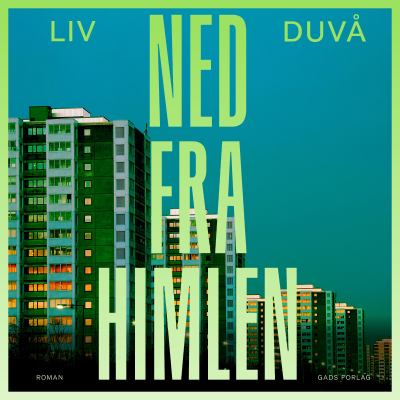F.A.Z. Künstliche Intelligenz
tysk
Business
Begrænset tilbud
1 måned kun 9 kr.
Derefter 99 kr. / månedOpsig når som helst.
- 20 lydbogstimer pr. måned
- Podcasts kun på Podimo
- Gratis podcasts
Læs mere F.A.Z. Künstliche Intelligenz
Im Podcast "Künstliche Intelligenz" sprechen Peter Buxmann und Holger Schmidt mit Gästen über Einsatzfelder der künstlichen Intelligenz in Unternehmen und die Entwicklung neuer datengetriebener Geschäftsmodelle. Peter Buxmann und Holger Schmidt erforschen am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik der Technischen Universität Darmstadt die Potenziale der künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit.
Alle episoder
56 episoder„Die Zeit der KI-Piloten ist vorbei“
Im internationalen KI-Vergleich tun sich deutsche Unternehmen oft schwerer als ihre internationalen Wettbewerber. Für Christine Rupp, Geschäftsführerin von IBM Deutschland und General Managerin für IBM Consulting in der DACH-Region, kommt es jetzt darauf an, Innovationen in die Umsetzung zu bringen: „Wenn ich KI nicht nutze oder zu spät nutze, entsteht ein struktureller Wettbewerbsnachteil. Die Zeit der Piloten ist vorbei“. In dieser Folge des KI-Podcasts der F.A.Z. Digitalwirtschaft kritisiert Rupp, dass Europa zwar viel experimentiert, der Schritt von der Innovation zur breiten Umsetzung aber andernorts schneller gelingt. Im internationalen Vergleich erkennt Rupp ein klares Muster: „In Europa sind wir enorm innovativ, wir sehen sehr kreative Pilotversuche. Wo andere uns jedoch voraus sind, ist die Geschwindigkeit der Skalierung“. Europa habe gute Ideen, aber häufig zu wenig Konsequenz in der Umsetzung, während in den USA oder Asien neue Technologien rasch großflächig eingeführt werden. Die Gründe dafür verortet sie auf drei Ebenen: „Der wichtigste Faktor ist Leadership. Das Thema ist wahrscheinlich eine der wichtigen und im Moment unterschätzten Dimensionen überhaupt“. Skalierung brauche klare Entscheidungen von ganz oben. Hinzu kämen komplexere Rahmenbedingungen und fehlende Investitionen, die Tempo und Reichweite neuer Vorhaben begrenzen. Damit Europa nicht weiter zurückfällt, fordert Rupp mehr Entschlossenheit. Für sie stehen weniger technische Hürden im Vordergrund als die Bereitschaft, KI wirklich ins operative Geschäft zu bringen. Alle Hindernisse ließen sich managen. Entscheidend sei, sie aktiv anzugehen. Rupp macht deutlich: „Momentan ist das Fenster vielleicht noch ein Stück weit offen, aber es ist sehr klar, dass alle Unternehmen dieser Welt KI zum Einsatz bringen werden“. Wer zögere, riskiere einen Rückstand und Wettbewerbsnachteil. Wie eine Umsetzung konkret aussehen kann, erklärt Rupp am Beispiel von IBM. Dort sei KI nicht nur ein Experimentierfeld, sondern Bestandteil der gesamten Unternehmenssteuerung. IBM hat KI in zentralen Bereichen eingeführt, mit messbaren Effekten: „3,5 Milliarden Euro Einsparungen konnten wir im vergangenen Jahr erzielen“. Die gewonnene Erfahrung nutze IBM, um Assets und digitale Assistenten aufzubauen, die Prozesse vereinheitlichen und Mitarbeitende entlasten. Für Rupp ist das ein wichtiges Signal an all jene, die noch zögern: „Das heißt, es ist machbar“. Parallel dazu betont sie die Bedeutung eines professionellen Umgangs mit Daten. Europäische Vorgaben seien anspruchsvoller, aber kein Hindernis: „Es gibt hervorragende Mittel und Wege, wie man mit Daten auch in Europa umgehen kann. Aber man muss es sauber durchdringen, sonst fehlen Vertrauen und Akzeptanz.“ Entscheidend sei, technologische Souveränität mit Offenheit und Vertrauen zu verbinden, durch klare Governance, Datensicherheit und offene Architekturen. Beim Blick auf Deutschland erkennt Rupp klare Vorteile: „Unsere Stärken liegen im Bereich der Daten. Das ist das Thema, das differenzierend sein wird für einen Standort wie Deutschland“. Während das globale Rennen um große Sprachmodelle weitgehend entschieden sei, liege Europas Chance in der sicheren, effizienten und intelligenten Nutzung von Unternehmensdaten. Für Rupp ist KI daher nicht nur ein Produktivitätsthema, sondern auch ein Hebel für Innovation, Leadership und kulturellen Wandel. Europa müsse seine Stärken jetzt ausspielen, um die nächste Innovationsphase aktiv mitzugestalten: „Da gibt es gar keine andere Option“, so Rupp. Die Folge ist Teil unseres Podcasts „Künstliche Intelligenz“. Er geht den Fragen nach, was KI kann, wo sie angewendet wird, was sie bereits verändert hat und welchen Beitrag sie in der Zukunft leisten kann. Hosts des Podcasts sind Peter Buxmann, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, und Digitalwirtschaft-Redaktionsleiter Holger Schmidt. Die Podcast-Folgen erscheinen jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Hören Sie unsere exklusiven Podcast-Folgen auf Apple Podcasts, FAZ.NET oder in der FAZ-App und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel: Testen Sie FAZ+ jetzt 3 Monate lang für nur 1 € im Monat – hier geht’s zum Angebot. [https://digitale-angebote.faz.net/start?campID=SONDER-ECa2500004185&product=O_JHOICT71N1B3CAU514] Mehr über die Angebote unserer Werbepartner finden Sie HIER. [https://cmk.faz.net/cms/articles/15603/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Klaus Müller: Warum wir weniger Angst vor KI-Regulierung haben sollten
Mit dem EU AI Act ist auch die Unsicherheit in die Unternehmen gekommen, welche KI-Anwendung in welche Risikoklasse fällt. Für Klaus Müller von der Bundesnetzagentur sind viele Ängste vor einer harten Regulierung aber übertrieben und die Aufregung oft größer als nötig. „Es gibt eine massive Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und dem, was der AI Act wirklich vorschreibt“, sagte Müller im KI-Podcast der F.A.Z. Digitalwirtschaft. Die Folge sei eine unnötige Zurückhaltung, häufig aus Sorge vor Fehlern und rechtlichen Konsequenzen. Dabei sei vieles weit weniger kompliziert als es scheine, sagte Müller. Oft fehle schlicht Orientierung, eine Stelle, die erklärt und durch neue Anforderungen führt. Seine Erfahrung zeige, dass diese Unsicherheit meist auf drei Gründe zurückgeht: „Mangelnde Zeit, fehlende Fachkräfte und die Rechtsunsicherheit“. Gerade die Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit dem EU AI Act sowie dem EU Data Act, zwei zentralen Bausteinen für Europas digitale Zukunft, sei häufig unbegründet. Müller erklärt: „Regulierung muss so gestaltet sein, dass sie Nutzung ermöglicht, statt sie zu blockieren“. Entscheidend sei außerdem, dass sie in der Praxis verständlich bleibe und Unternehmen Orientierung biete. Behörden wie die Bundesnetzagentur sollten dabei unterstützen, nicht verunsichern. Um mehr Klarheit zu schaffen, baut die Bundesnetzagentur derzeit ihre Beratungsangebote aus und setzt auf Aufklärung. Mit dem neuen KI-Service-Desk soll Unternehmen der Einstieg in den praktischen Einsatz von KI erleichtert und Unsicherheiten abgebaut werden. Müller formuliert das Ziel klar: „Die Bundesnetzagentur muss rund um den Data Act und den AI Act den Ruf eines Ermöglichers erlangen, wo man sich guten Gewissens hinwenden kann“. Auch bei der Bundesnetzagentur wird KI eingesetzt, zum Beispiel in der Stromnetzplanung, in Genehmigungsverfahren sowie im Verbraucherservice zum Einsatz. Besonders der neue Chatbot „Kai“ verdeutlicht, wie Verwaltung durch den gezielten Einsatz von KI effizienter gestaltet werden kann, ohne dabei an Sicherheit einzubüßen. Für Müller ist klar: Es geht nicht darum, Technik zu verhindern, sondern sie verantwortungsvoll zu nutzen. Im internationalen Vergleich hebt Müller hervor, dass Europa einen eigenen Weg gehe. Während die USA auf größtmögliche Freiheit und China auf strenge staatliche Kontrolle setzen, liege die europäische Stärke in klaren Regeln und verlässlichen Standards. „Unser Anspruch muss sein, die europäischen Regelungen zu einem Wettbewerbsvorteil zu entwickeln“. Vertrauen, Transparenz und klare Verantwortlichkeiten seien langfristig die besseren Erfolgsfaktoren. Dieses Ziel verfolgt Müller auch national: „Unser Bestreben ist es, vertrauenswürdige KI in Deutschland zu etablieren, zu einem Erfolgsmodell zu machen“. Sein Blick in die Zukunft bleibt optimistisch. Statt nach immer neuen Regeln zu rufen, setzt er auf Umsetzung, Kooperation und Vertrauen in die Innovationskraft. „Nicht alle Ängste, die es gibt, sind tatsächlich substantiiert“, sagt er mit Blick auf die aktuelle Debatte. Entscheidend sei, Wissen zu vermitteln und Vertrauen aufzubauen: „Das kann man nur durch Aufklärung tun und durch eine Regulierungsbehörde, die nicht Angst macht, sondern unterstützt“. Die Folge ist Teil unseres Podcasts „Künstliche Intelligenz“. Er geht den Fragen nach, was KI kann, wo sie angewendet wird, was sie bereits verändert hat und welchen Beitrag sie in der Zukunft leisten kann. Hosts des Podcasts sind Peter Buxmann, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, und Digitalwirtschaft-Redaktionsleiter Holger Schmidt. Die Podcast-Folgen erscheinen jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Hören Sie unsere exklusiven Podcast-Folgen auf Apple Podcasts, FAZ.NET oder in der FAZ-App und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel: Testen Sie FAZ+ jetzt 3 Monate lang für nur 1 € im Monat – hier geht’s zum Angebot. [https://digitale-angebote.faz.net/start?campID=SONDER-ECa2500004185&product=O_JHOICT71N1B3CAU514] Mehr über die Angebote unserer Werbepartner finden Sie HIER. [https://cmk.faz.net/cms/articles/15603/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
„Künstliche Intelligenz trifft eine Milliarde Entscheidungen – am Tag“
„KI ist eines der strategischen Elemente, um künftig Effizienz zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit der Kerngeschäfte zu sichern und zugleich Herausforderungen wie den Fachkräftemangel zu bewältigen.“ Sagt Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits, der Digital- und IT-Sparte der Schwarz Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland zählen. Bereits heute ist KI fester Bestandteil des Tagesgeschäfts bei der Schwarz Gruppe. „Wir treffen rund eine halbe Milliarde Entscheidungen am Tag mit KI, am Ende des Jahres werden es gut eine Milliarde sein“, so Schumann. Auch wenn diese Zahl unterschiedliche Anwendungsfelder umfasst, von Prognosen in der Logistik über die Regalplanung bis hin zum Kundenservice, zeigt sich ein klares Muster: KI übernimmt Routineaufgaben, beschleunigt Entscheidungen und stärkt so Effizienz, Nachhaltigkeit und Kundennähe. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den sogenannten Agenten. Für die Schwarz Gruppe sollen sie künftig eine Schlüsselrolle einnehmen, zum Beispiel zur Strukturierung von Prozessen, zur Systematisierung von Wissen und zur Erweiterung der Entscheidungsfähigkeit der Beschäftigten. Wissen und Erfahrung, die bisher nur wenigen Spezialisten vorbehalten waren, werden auf diese Weise für die gesamte Organisation nutzbar. Schumann betont: „Man schafft es, extrem wichtiges Expertenwissen und auch Erfahrung in die Breite zu bringen, unabhängig von Alter, Betriebszugehörigkeit oder Erfahrung“. Darin liegt für ihn ein entscheidender Fortschritt: „Mitarbeitende werden mit Hilfe von KI in die Situation gebracht, bessere und effizientere Entscheidungen zu treffen“. Ein weiteres zentrales Thema ist für Schumann die digitale Unabhängigkeit. Die Schwarz Gruppe investiert daher massiv in eigene Cloud- und Rechenzentren. Digitale Souveränität bedeutet für ihn jedoch nicht Abschottung, sondern die Fähigkeit, Partnerschaften bewusst einzugehen und sie ebenso klar zu beenden, wenn fundamentale Prinzipien verletzt werden: „Souveränität ist auch, jederzeit vom Tisch aufstehen zu können, wenn jemand gegen deine Werte geht“. Schließlich richtet Schumann den Blick auf Europa: „Bei den ganz großen Sprachmodellen haben wir den Zug verpasst“. Umso wichtiger sei es, die eigenen Stärken zu nutzen, vom industriellen Know-how über hohe Qualitätsstandards bis hin zu den zahlreichen Hidden Champions. „Wir müssen uns auf unsere Stärken fokussieren“, betont er, und nennt vor allem Domainwissen, Bildung und Wissen als Fundament. Während die USA und China auf Größe und Datenmengen setzen, sieht Schumann Europas Chance darin, KI mit Branchenexpertise, Qualität und einer starken Wertebasis zu verbinden. Die Folge ist Teil unseres Podcasts „Künstliche Intelligenz“. Er geht den Fragen nach, was KI kann, wo sie angewendet wird, was sie bereits verändert hat und welchen Beitrag sie in der Zukunft leisten kann. Hosts des Podcasts sind Peter Buxmann, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, und Digitalwirtschaft-Redaktionsleiter Holger Schmidt. Die Podcast-Folgen erscheinen jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Hören Sie unsere exklusiven Podcast-Folgen auf Apple Podcasts, FAZ.NET oder in der FAZ-App und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel: Testen Sie FAZ+ jetzt 3 Monate lang für nur 1 € im Monat – hier geht’s zum Angebot. [https://digitale-angebote.faz.net/start?campID=SONDER-ECa2500004185&product=O_JHOICT71N1B3CAU514] Mehr über die Angebote unserer Werbepartner finden Sie HIER. [https://cmk.faz.net/cms/articles/15603/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Vom Papier zum Chatbot: Wie KI die Verwaltung modernisiert
Christian Engelhardt ist seit 2015 Landrat des Kreises Bergstraße und zählt zu den ersten seiner Zunft, die Künstliche Intelligenz konsequent in die Verwaltung eingesetzt haben. Für Engelhardt steht fest: „KI macht Verwaltung moderner, erreichbarer, zukunftsfähiger“. Statt auf lange Abstimmungsprozesse zu warten, ermutigte er seine Mitarbeitenden früh, Sprachmodelle wie ChatGPT bei der Arbeit zu testen und Erfahrungen zu teilen: „Einfach mal auszuprobieren, das ist normalerweise nicht so die Stärke von uns Deutschen und das wollte ich ändern“. Gerade bei Routinetätigkeiten sieht Engelhardt in der KI ein großes Potenzial, die oft langsamen Verwaltungsprozesse grundlegend zu beschleunigen. Chatbots können Bürger jederzeit informieren, Anträge aufnehmen und an die zuständigen Stellen weiterleiten. Dadurch lässt sich der Übergang in die entsprechenden Fachverfahren beschleunigen und Entscheidungen werden effizienter getroffen. Für Engelhardt geht die Erneuerung aber noch einen Schritt weiter. „Manche Dinge wird die Behörde künftig vorausschauend selbst regeln“, hofft er. Wenn Ausweise ablaufen oder Fristen enden, solle nicht der Bürger aktiv werden müssen, sondern die Behörde automatisch reagieren. „Eine Behörde weiß ganz genau, wann der Personalausweis abläuft, also wieso wird das nicht umgedreht?“ fragt Engelhardt und sieht darin einen zentralen Schritt für einen serviceorientierten Staat, der mit dem Tempo digitaler und „klug aufgebauter“ Plattformen mithalten kann. KI als Antwort auf den Fachkräftemangel Gleichzeitig sieht Engelhardt in KI eine wichtige Antwort auf den Fachkräftemangel. Wo Routineprozesse automatisiert werden, bleibe mehr Zeit für zwischenmenschliche Aufgaben, beispielsweise in Beratung, Pflege oder Erziehung. „Die Arbeit wird nicht ausgehen, und es gibt sehr viele Ideen, in die man menschliche Empathie, Intelligenz und Kreativität investieren kann“, sagt Engelhardt. Es gehe nicht darum, Arbeitsplätze abzuschaffen, sondern darum, die knappen Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden: „Es gelingt uns ja jetzt schon nicht mehr, all die Fachkräfte, die wir brauchen, zu finden.“ KI verschiebe die Schwerpunkte und stelle sicher, dass Verwaltung trotz schrumpfender Belegschaften zuverlässig funktioniert „Wir als Staat müssen nicht nur erreichbar sein, sondern auch funktionsfähig bleiben“. Genau darin liegt für ihn die große Chance: Mit KI könne der Staat schneller, verlässlicher und bürgernäher arbeiten. Damit dieses Potenzial Wirklichkeit wird, brauche es jedoch klare politische Rahmenbedingungen. Engelhardt unterscheidet hier zwischen zwei Ebenen: Der Bund müsse Standards schaffen, Schnittstellen vereinheitlichen und Rechtssicherheit garantieren. Nur so könnten erfolgreiche Projekte bundesweit Wirkung entfalten. Gleichzeitig seien es die Länder, die Pilotprojekte ermöglichen sollen. Hessen beispielsweise habe durch sein Digitalministerium gezeigt, wie wertvoll finanzielle Förderung vor Ort sein kann. Kommunen erhalten dadurch Freiräume, Neues auszuprobieren, ohne das volle Risiko allein zu tragen: „Durch solche Modellprojekte schafft der Staat einen Erprobungsraum“, so Engelhardt. Gerade diese Förderung vor Ort sei für Kommunen sehr wertvoll, weil sie Mut mache, innovative Wege zu gehen und eine echte Fehlerkultur zulasse. Für Engelhardt ist klar: „Entbürokratisierung müssen wir künftig immer mitdenken“, denn nur wenn Gesetze und Regeln Automatisierung zulassen, entfaltet KI ihr volles Potenzial. Die Folge ist Teil unseres Podcasts „Künstliche Intelligenz“. Er geht den Fragen nach, was KI kann, wo sie angewendet wird, was sie bereits verändert hat und welchen Beitrag sie in der Zukunft leisten kann. Hosts des Podcasts sind Peter Buxmann, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, und Digitalwirtschaft-Redaktionsleiter Holger Schmidt. Die Podcastfolgen erscheinen jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Hören Sie unsere exklusiven Podcast-Folgen auf Apple Podcasts, FAZ.NET oder in der FAZ-App und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel: Testen Sie FAZ+ jetzt 3 Monate lang für nur 1 € im Monat – hier geht’s zum Angebot. [https://digitale-angebote.faz.net/start?campID=SONDER-ECa2500004185&product=O_JHOICT71N1B3CAU514] Mehr über die Angebote unserer Werbepartner finden Sie HIER. [https://cmk.faz.net/cms/articles/15603/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
„Die Bankenwelt erlebt Revolution in einem Tempo, das viele vielleicht überfordert“
Künstliche Intelligenz wird die Bankenwelt grundlegend verändern, erwartet Florian Rentsch, Vorsitzender des Verbands der Sparda-Banken. In der neuen Folge des F.A.Z. KI-Podcasts spricht er über Chancen, Grenzen und regulatorische Herausforderungen des KI-Einsatzes im Finanzsektor: „Wir sind da in einer ganz neuen Welt angekommen.“ Damit diese Transformation gelingt, brauche es aber kluge Rahmenbedingungen, nicht lähmende Regulierung aus Prinzip. Rentsch beschreibt: „Wir erleben gerade Revolution in einem Tempo, das für viele fordernd, vielleicht auch überfordernd ist.“ KI sei dabei längst mehr als ein technisches Hilfsmittel: Sie werde die innere Struktur unserer Organisationseinheiten und damit das traditionelle Geschäftsmodell vieler Banken verändern. Ein zentrales Anwendungsfeld sieht er im datengestützten, personalisierten Vertrieb: Früher sei mit der „Schrotflinte“ gearbeitet worden, heute machen es KI-Systeme möglich, den Kunden passgenaue Angebote zu machen, etwa für die Geldanlage. Die Beratungsqualität könne damit enorm verbessert werden. Auch auf Kundenseite sorge KI für Veränderung, auf die sich Banken einstellen müssen: „Kunden sind viel schneller in der Lage, sich auf Sachverhalte einzustellen, weil KI Informationen sehr viel schneller zusammenfasst und vergleicht“. Neben der Kundenberatung verändert der Einsatz von KI zunehmend auch die tägliche Arbeit in den Banken, vor allem in der Wissensarbeit: „Denken und Wissensvermittlung lassen sich heute technologisch in einem Ausmaß unterstützen, das wir vorher nie hatten.“ Für Rentsch ist das nicht nur ein Effizienzversprechen, sondern auch ein Führungsauftrag: „Wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden ausprobieren, dazulernen, offen sind.“ Entsprechend setzt der Sparda-Verbund auf Schulungen, sichere KI-Umgebungen und eine breite Verfügbarkeit der Tools. Doch wie gelingt Innovation in einem hochregulierten Umfeld? Rentsch sieht hier ein grundlegendes Problem, vor allem beim Blick auf die europäische Gesetzgebung. Den EU AI Act kritisiert er deutlich: „Wir schaffen durch solche Regulierung ein Mindset, das defensiv ist.“ Statt über Chancen zu sprechen, liege der Fokus zu stark auf potenziellen Risiken. Regulierung werde „als Selbstzweck forciert“ und sei teils nicht wissenschaftlich basiert. Das Ergebnis: ein lähmendes Regelwerk, hohe Compliance-Kosten und Wettbewerbsnachteile gegenüber innovationsfreudigeren Weltregionen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Rentsch optimistisch: „Ich glaube, die Mutigen werden am Ende belohnt.“ Der Wandel sei in vollem Gange, angetrieben auch von einer neuen Generation, für die der Einsatz von KI selbstverständlich ist. Jetzt komme es darauf an, die Chancen aktiv zu gestalten. Denn: „Wir erleben eine Revolution der bisherigen Arbeitsweise – und wer sie nicht mitgeht, wird im Markt deutliche Nachteile erhalten.“ Die Folge ist Teil unseres Podcasts „Künstliche Intelligenz“. Er geht den Fragen nach, was KI kann, wo sie angewendet wird, was sie bereits verändert hat und welchen Beitrag sie in der Zukunft leisten kann. Hosts des Podcasts sind Peter Buxmann, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, und Digitalwirtschaft-Redaktionsleiter Holger Schmidt. Die Podcastfolgen erscheinen jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Uns gibt’s auch zum Lesen: Finden Sie hier Ihr passendes F.A.Z.-Abo. [https://abo.faz.net/?campID=INT-IPe2400001542] Mehr über die Angebote unserer Werbepartner finden Sie HIER. [https://cmk.faz.net/cms/articles/15603/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Vælg dit abonnement
Begrænset tilbud
Premium
20 timers lydbøger
Podcasts kun på Podimo
Gratis podcasts
Opsig når som helst
1 måned kun 9 kr.
Derefter 99 kr. / måned
Premium Plus
100 timers lydbøger
Podcasts kun på Podimo
Gratis podcasts
Opsig når som helst
Prøv gratis i 7 dage
Derefter 129 kr. / month
1 måned kun 9 kr. Derefter 99 kr. / måned. Opsig når som helst.