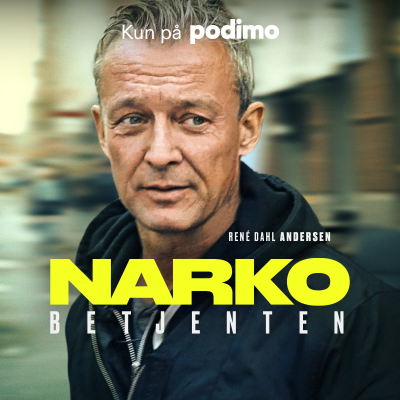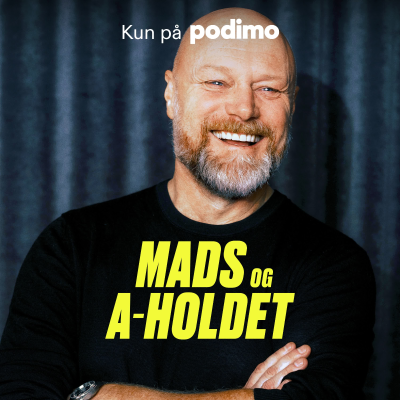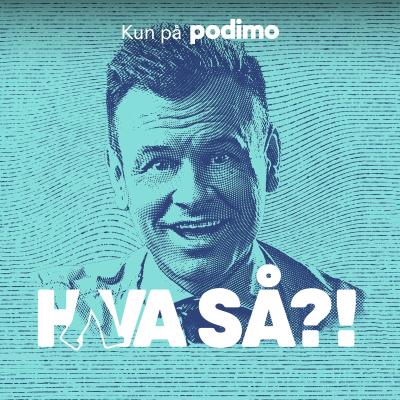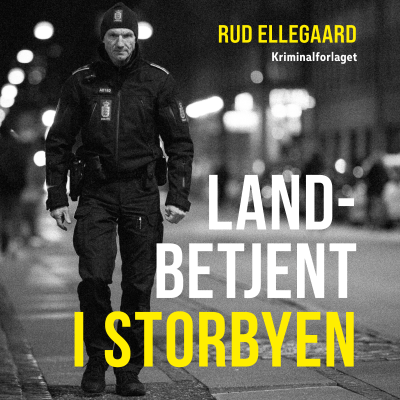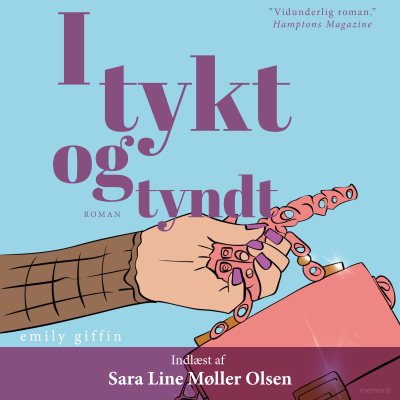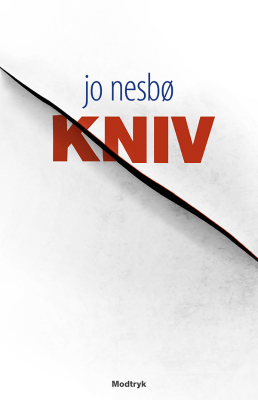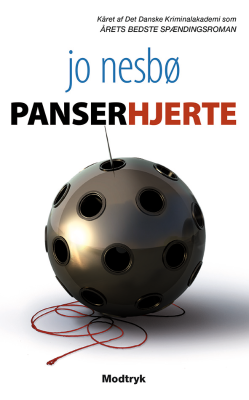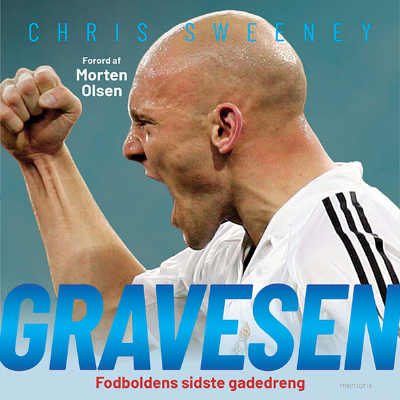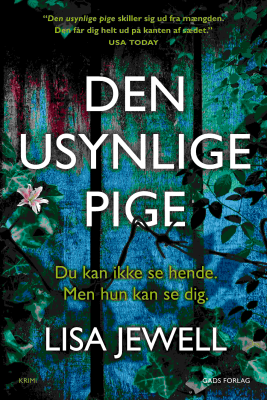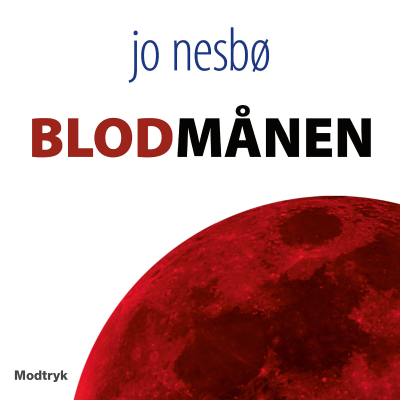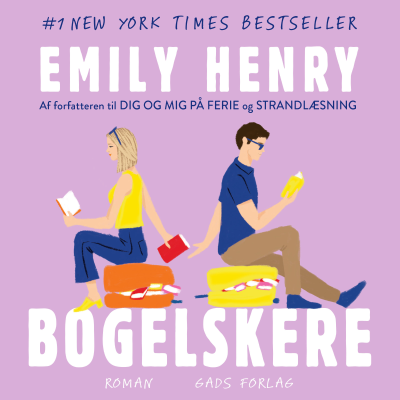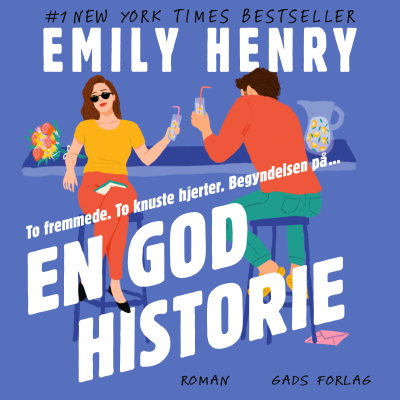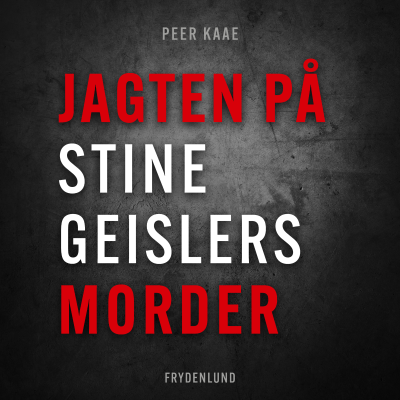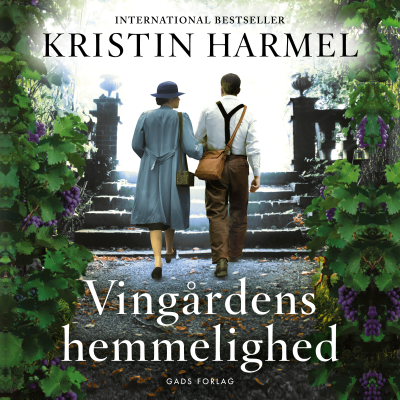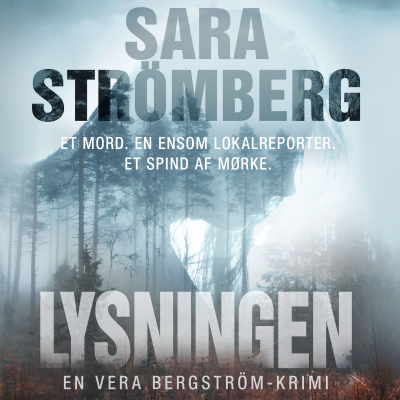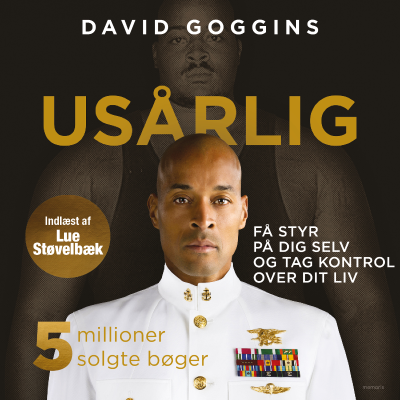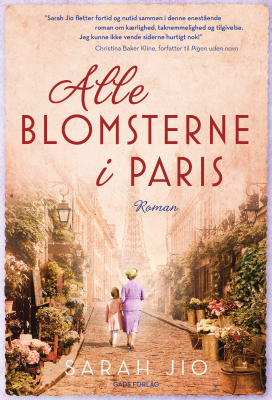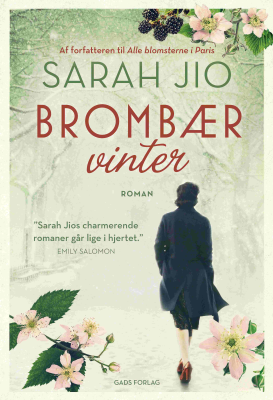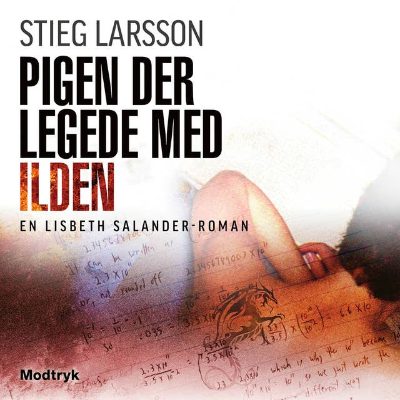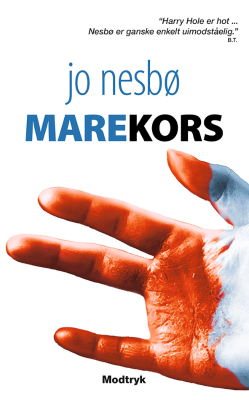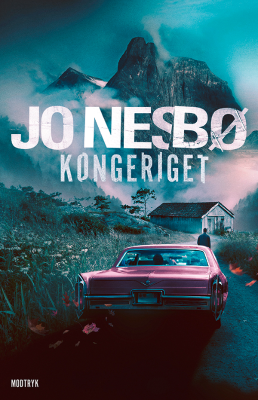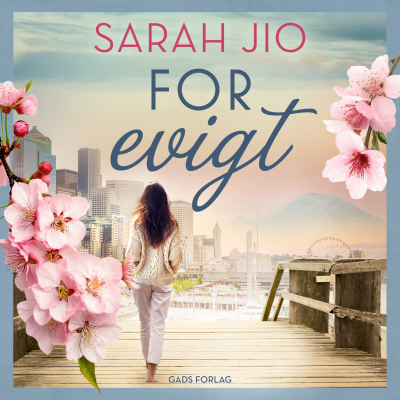SWR2 Kultur Aktuell
tysk
Personlige fortællinger & samtaler
Begrænset tilbud
1 måned kun 9 kr.
Derefter 99 kr. / månedOpsig når som helst.
- 20 lydbogstimer pr. måned
- Podcasts kun på Podimo
- Gratis podcasts
Læs mere SWR2 Kultur Aktuell
Welche Bücher sind neu, was läuft im Kino, wie sieht die Festivalsaison aus und worüber diskutieren Kulturwelt und Kulturpolitik? Im Podcast SWR Kultur Aktuell widmen wir uns täglich den Nachrichten, mit Hintergründen, Gesprächen, Kritiken und Tipps. Damit Sie nichts Wichtiges mehr verpassen! Zur Sendung in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/swr2-kultur-aktuell/12779998/
Alle episoder
10216 episoderTheater für alle - barrierefreie Angebote im Jungen Staatstheater Karlsruhe
Das Junge Staatstheater Karlsruhe bietet immer mehr Produktionen an, die möglichst vielen Besucher*innen zugänglich sind. Dabei testet es neue Formate, um den Zugang besonders für sehbehinderte und gehörlose Kinder und Jugendliche leichter zu machen. So wird zum Beispiel die Inszenierung von „Robin Hood“ oder dem Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“ auch mit Audiodeskription, Gebärdensprachendolmetscher*innen und Übertiteln angeboten. Barrierefreiheit wird im Jungen Staatstheater als langfristiges Ziel verstanden, das man auf allen Ebenen umsetzen möchte. Dazu gehören bauliche Maßnahmen genauso dazu, wie behindertengerechte Arbeitsplätze, barrierefreie Zugänge zum Ticketkauf und kreative Lösungen für inklusive Produktionen.
250 Jahre Jane Austen – Was die Autorin zeitlos macht
Sechs Liebesromane, einige Fragmente und eine Sammlung von Briefen – mehr hat Jane Austen literarisch nicht hinterlassen. Geboren am 16. Dezember 1775, starb die britische Schriftstellerin mit nur 41 Jahren. Dennoch gehört sie bis heute zu den populärsten Autorinnen der Weltliteratur. Zum 250. Geburtstag ist Jane Austen präsenter denn je: Ihre Romane erscheinen als aufwendig gestaltete Schmuckausgaben, Netflix arbeitet an einer neuen Serienverfilmung von Stolz und Vorurteil, und auf TikTok wird Austen von jungen Leserinnen als Vorläuferin der Young-Adult-Literatur gefeiert. Ihre anhaltende Aktualität erklärt Marion Gymnich, Anglistin an der Universität Bonn, mit Austens ungewöhnlicher Art, Liebesbeziehungen zu erzählen. Sie habe Partnerschaften dargestellt, „die auf Augenhöhe funktionieren, die auf gegenseitigem Respekt basieren und ein Kennenlernen voraussetzen – was zur damaligen Zeit nicht unbedingt üblich war“. Besonders Austens Frauenfiguren bieten laut Gymnich bis heute ein hohes Identifikationspotenzial, vor allem für junge Leserinnen. Es seien „sehr selbstbewusste junge Frauen, die es in ihrer Umgebung oft nicht leicht haben, auf die viel Druck ausgeübt wird – und die trotzdem ihren eigenen Weg gehen“. Genau diese Mischung aus gesellschaftlicher Analyse und persönlicher Selbstbehauptung macht Jane Austens Werk auch 250 Jahre nach ihrer Geburt erstaunlich gegenwärtig.
Grandioses Filmdebüt: „Sorry, Baby“ erzählt von der Schockstarre nach einer Vergewaltigung
DUNKLER SCHATTEN ÜBER EINEM WIEDERSEHEN Die unbeschwerte College-Zeit der beiden Freundinnen Agnes und Lydie ist lange her. Lydie ist weggezogen, Agnes inzwischen Professorin für Literatur. Sie hat jetzt „seine“ Stelle und „seinen“ Raum. Und weil „er“ nicht namentlich genannt wird, liegt eine dunkle Ahnung über dem fröhlichen Wiedersehen. Im Rückblick deutet der intensive Film an, was passiert ist. Ihr Literaturprofessor hat Agnes, seine beste Studentin, zur Besprechung ihrer Masterarbeit zu sich nach Hause eingeladen. Die Kamera zeigt das gediegene Backsteingebäude am späten Nachmittag, die Sonne geht unter, drinnen geht das Licht an. IN „SORRY, BABY“ ZERBRICHT EIN SICHER GEGLAUBTES WELTBILD Das Treffen dauert schon beim Zuschauen dieser vollkommen statischen Einstellung viel zu lange. Dann stolpert Agnes aus der Tür, ihre Schuhe in der Hand. Später wird sie ihrer Freundin die Vergewaltigung mit grausamer Sachlichkeit schildern. „Sorry, Baby“ handelt davon, wie ein sicher geglaubtes Weltbild zerbricht. Im Rückblick versucht Agnes zu begreifen, was ihr passiert ist. REGISSEURIN UND HAUPTDARSTELLERIN EVA VICTOR VERARBEITET EIGENES ERLEBNIS Eva Victor, die in dem Film ein eigenes Erlebnis verarbeitet, spielt Agnes in den unterschiedlichen Phasen der Erstarrung. Mit äußerster Selbstbeherrschung versucht sie ihre Identität zu bewahren. Das Trauma bricht in Panikattacken durch. Bei einer Autofahrt muss ihr ein Sandwichverkäufer aus dem Wagen helfen. Wunderbar warmherzig hört John Carroll Lynch der verstörten jungen Frau zu. KEIN AUFMERKSAMKEIT FÜR DEN TÄTER Dem Täter gönnt Eva Victor keine Aufmerksamkeit. Der Professor hatte schon vor dem Treffen mit Agnes seine Stelle gekündigt, wissend, welche Konsequenzen seine Tat haben würde. Etwas holzschnittartig wirken die Gespräche mit den Institutionen, einem Arzt im Krankenhaus oder den Angestellten der Univerwaltung. Grandios vermittelt der Film die Schwankungen der Gefühle. Die fundamentale Verunsicherung der Studentin, deren Texte ihr Professor noch mit „herausragend“ kommentiert hatte. Und die ersten Versuche, aus der Schockstarre wieder in die Bewegung zu finden. Die Farben changieren zwischen kühlen Blau- und warmen Brauntönen. Naomie Ackie als Agnes Freundin spielt die zugewandte Gesprächspartnerin, die Agnes schenkt, was sie verloren, hat: Vertrauen. Sehr zart, sehr nuanciert, manchmal mit sarkastischem Humor erzählt Eva Victor nicht etwa von einer Heilung. Aber doch von dem Beginn einer Rückkehr in ein anderes Leben. TRAILER „SORRY, BABY“ AB 18.12. IM KINO
Gelebte Utopie im Journalismus: Die Reportergemeinschaft Zeitenspiegel im Porträt
Mit den ersten Kindern kam die Kitagründung Der Fotograf Uli Reinhardt arbeitet seit Mitte der 1970er-Jahre für nationale und internationale Medien. Er hat in Afrika, Afghanistan und auf dem Balkan den Krieg gesehen und in Deutschland den Terror der RAF. Heute betreut er Kollegen, die in Krisengebieten arbeiten. Doch um ihn zu sprechen, muss man erst mal warten, bis er mit dem Kochen für den Kindergarten fertig ist. „Heute habe ich Reis mit Gemüse gemacht und vorneweg einen Tomatensalat mit bestem Balsamico. Da lecken die den Teller ab“, erzählt Uli Reinhardt an einem sonnigen Spätherbstmittag in Weinstadt-Endersbach. PRAKTISCHE SOLIDARITÄT IN DER REPORTER-AGENTUR Hier im Remstal ist der Kindergarten „Zeitenspiel“ zuhause, ein Ableger der Reporter-Agentur „Zeitenspiegel“, die Uli Reinhard vor 40 Jahren mitgegründet hat. Dass Journalisten eine Kita betreiben, findet er kurios, aber pragmatisch. „Das war reine Notwendigkeit, weil zeitgleich sechs Mitglieder Kinder bekommen haben“, sagt Reinhard. „Wenn diese Personen plötzlich zwei Jahre weg sind, dann sind die raus aus dem Geschäft.“ ÜBER DIE LÖHNE GEMEINSAM ENTSCHEIDEN Um ein solches Loch im sozialen Netz zu stopfen, war die Gründung der Kita nur eine weitere Variante praktischer Solidarität – die schon immer das Fundament von Zeitenspiegel ist. In den allerersten Jahren warfen Reinhardt und Mitstreiter einfach alle Honorare in einen Topf und zahlten sich ihre Gewinne zu gleichen Teilen aus. Mittlerweile gibt es ein festes Grundgehalt, und alles darüber hinaus ist immer noch sehr speziell geregelt. „Einmal im Jahr schauen wir uns die Zahlen an: Wie viel hat jeder verdient, was brauche ich zum Leben, wie viel kann ich der Gemeinschaft geben. Und dann stimmen alle ab“, sagt Zeitenspiegel-Geschäftsführerin Rike Uhlenkamp. VIEL SPOTT AN DEN „HIPPIES AUS DEM SÜDEN“ Das funktioniert ohne großes Gezerre, und ist nach wie vor gefragt. Zeitenspiegel wächst. Derzeit leben und arbeiten rund 80 Prozent der 21 Mitglieder mit diesem Solidar-Modell, die jüngste ist gerade einmal 26 und der Agenturgemeinschaft erst vor kurzem beigetreten. Aber natürlich kennt Rike Uhlenkamp auch Hohn und Spott. „Die Hippies aus dem Süden, oder?“ Für viele sei es unvorstellbar, dass einige weitaus mehr Geld verdienen könnten, würden sie alles für sich behalten. „Das ist im Journalismus nicht so verbreitet.“ Wie begegnet Uli Reinhardt der Häme? „Indem ich mir an der Qualität der Arbeit nichts zu schulden kommen lasse. Die muss stimmen, die muss top sein.“ STIPENDIEN UND EIN SCHÜLERWETTBEWERB Zeitenspiegel geht weit über normalen Qualitätsjournalismus hinaus. Die kleine Agentur gibt selbst ein Magazin heraus, Titel: Mut. Konzept: nicht nur Probleme, sondern auch deren Lösungen zeigen. Daneben realisiert die Reportergemeinschaft jährlich den Hansel-Mieth-Preis [https://www.swr.de/kultur/gesellschaft/hansel-mieth-preis-2025-reportage-ueber-missstaende-in-fluechtlingsunterkunft-berlin-tegel-100.html]für gesellschaftlich relevante Reportagen in Text und Bild. Außerdem bietet sie Stipendien für Reportage-Ideen, und – Uli Reinhardts persönliches Favoriten-Projekt – einen Schülerwettbewerb in Südtirol. „Da beschäftigen sich junge Erwachsene mit ihrer Heimat, lernen dabei, wie Journalismus funktioniert, wie man wahr und unwahr unterscheidet.“ ZEITENSPIEGEL IST GELEBTE UTOPIE IM JOURNALISMUS Ein Vierteljahr lang arbeiten die jungen Leute an ihren Reportagen, bekommen währenddessen fünf Mal Input durch Workshops mit erfahrenen Zeitenspieglern. Den Gewinnern winken 1.000 Euro und und vor allem ein Praktikum beim „Stern“ in Hamburg. „Ein Schüler hat mal im gedruckten Stern sechs Doppelseiten gekriegt mit einer Reportage, die er selber fotografiert und geschrieben hat“, sagt Reinhardt. Zeitenspiegel, diese gelebte Utopie von gutem Journalismus und besserem Miteinander, würde seine Schülerförderung gerne ausdehnen von Hamburg und Südtirol aufs Heimatländle – also dann: Hallo Kultusministerium in Stuttgart, bitte übernehmen!
Anne Brorhilker: Steuerklau erschüttert Vertrauen in den Staat
FINANZMÄRKTE VOR STEUERKLAU SCHÜTZEN Seit 2024 ist Brorhilker Vorständin in der Bürgerbewegung, die sich für fair gestaltete Finanzmärkte einsetzt. Im Dezember 2025 wurde die Ex-Ermittlerin für ihren Einsatz mit dem Stuttgarter Friedenspreis ausgezeichnet. Den Abschied vom Staatsdienst habe sie nicht bereut, sagt Brorhilker im Gespräch mit SWR Kultur. Steuerstraftäter vor Gericht zu bringen sei ein Kraftakt. Die Behörden würden unter schwerwiegenden strukturellen Mängeln leiden. „Das kann ich aber jetzt verändern“, sagt Brorhilker mit Blick auf ihre Tätigkeit für die Bürgerbewegung Finanzwende. Mit einer Kampagne habe man bereits verhindert, die Aufbewahrungsfristen für wichtige Geschäftsunterlagen zu verkürzen. POLITIK HÖRT AUF DIE ZIVILGESELLSCHAFT Allein aus Cum-Cum-Steuerdiebstählen könne man noch 30 Milliarden Euro zurückholen. Die Verkürzung des Aufbewahrungsfristen wäre daher „fatal gewesen“. Es sei ein gutes Zeichen, dass die Politik in diesem Falle auf Stimmen aus der Zivilgesellschaft gehört habe. Würden Steuern lediglich bei denen eingetrieben, die sich nicht wehren könnten, entstehe der Eindruck, dass der Staat mit zweierlei Maß misst. Das könne „das Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Institutionen erheblich gefährden“. Vor allem „radikale Kräfte“, so Brorhilker, beriefen sich darauf, „dass der Staat nicht richtig funktioniert“. Im November 2025 erschien ihr Buch „Cum/Ex, Milliarden und Moral“, in dem sie Steuerraub-Modelle und das nachlässige Agieren der Finanzbehörden beschreibt.
Vælg dit abonnement
Begrænset tilbud
Premium
20 timers lydbøger
Podcasts kun på Podimo
Gratis podcasts
Opsig når som helst
1 måned kun 9 kr.
Derefter 99 kr. / måned
Premium Plus
100 timers lydbøger
Podcasts kun på Podimo
Gratis podcasts
Opsig når som helst
Prøv gratis i 7 dage
Derefter 129 kr. / month
1 måned kun 9 kr. Derefter 99 kr. / måned. Opsig når som helst.