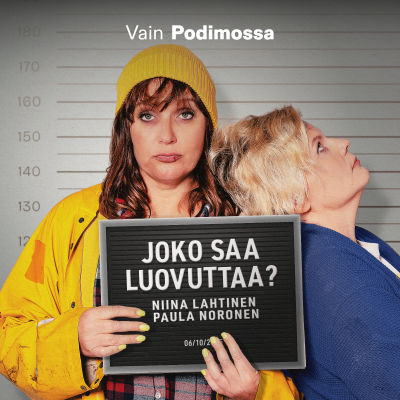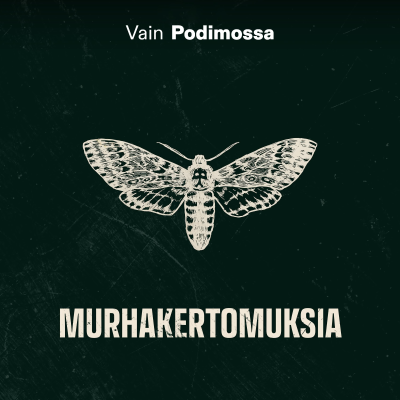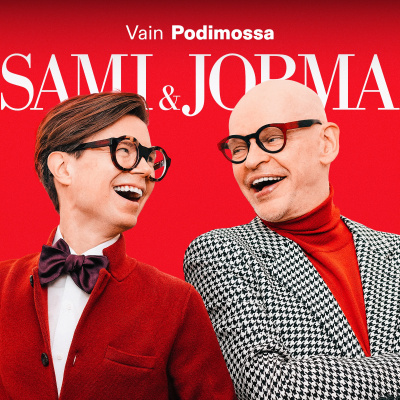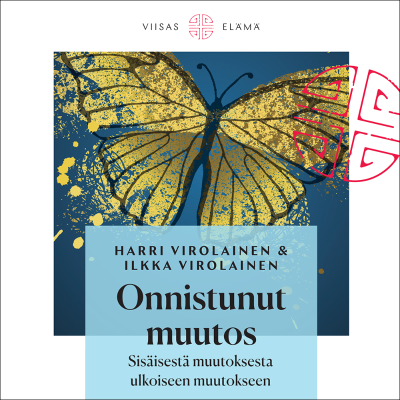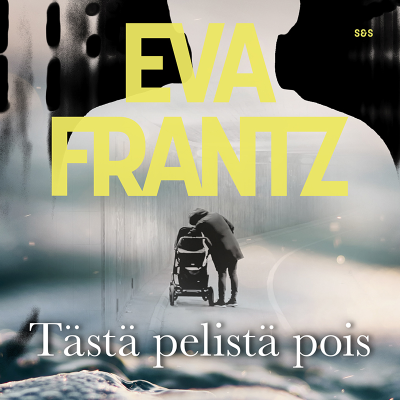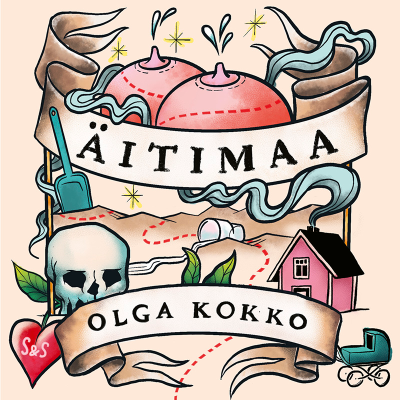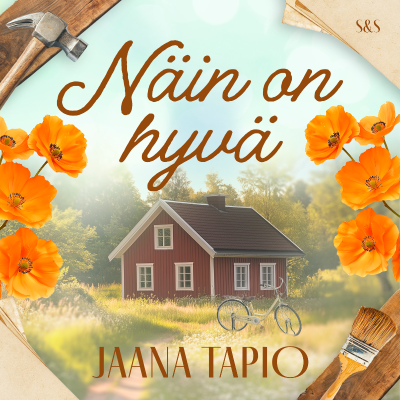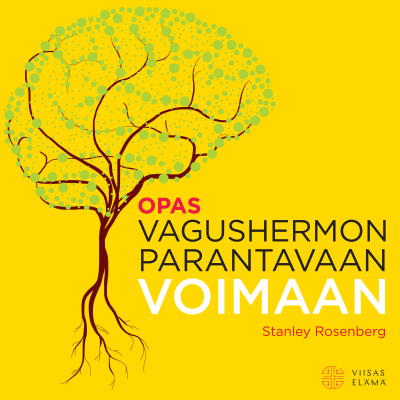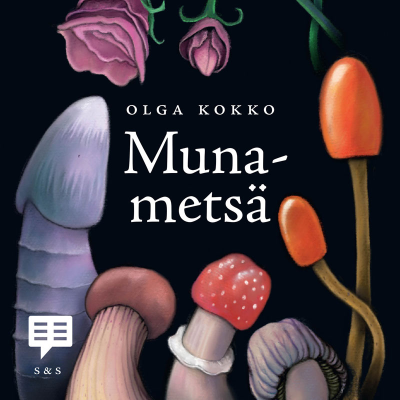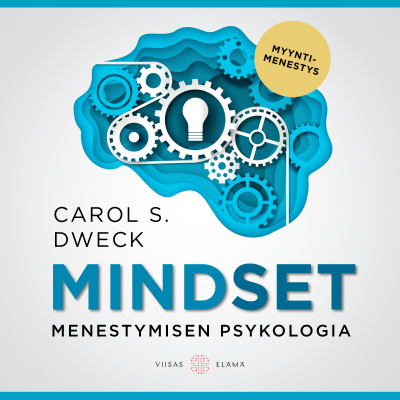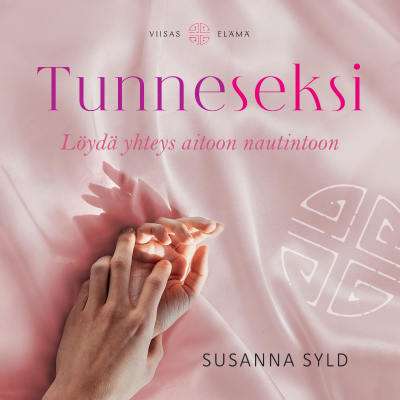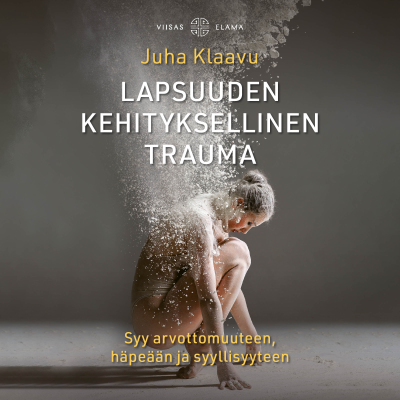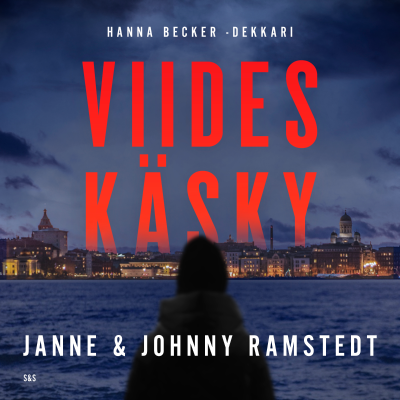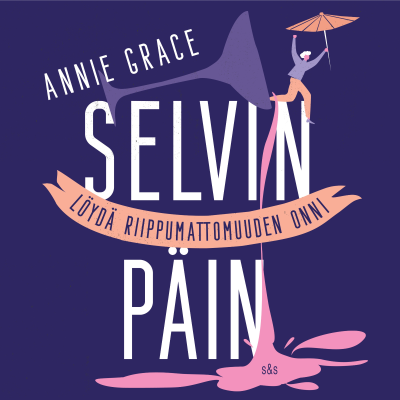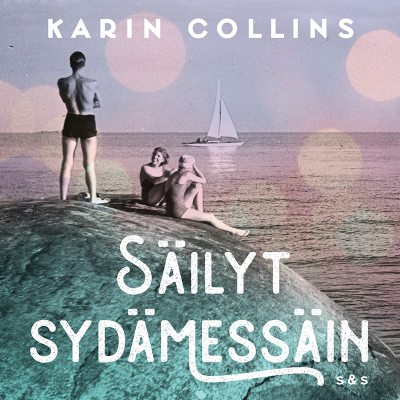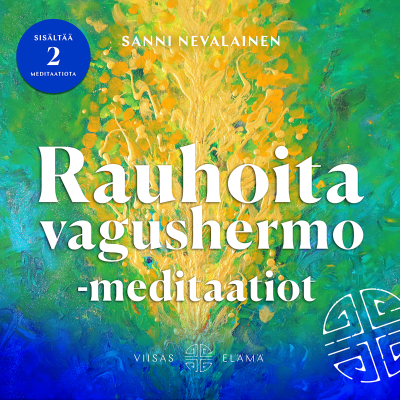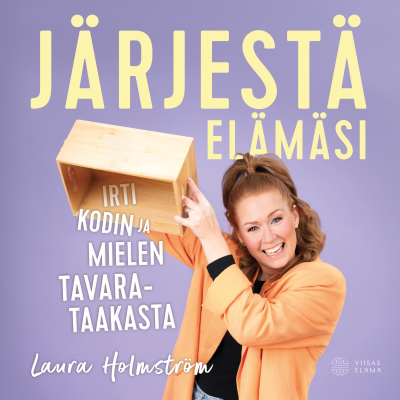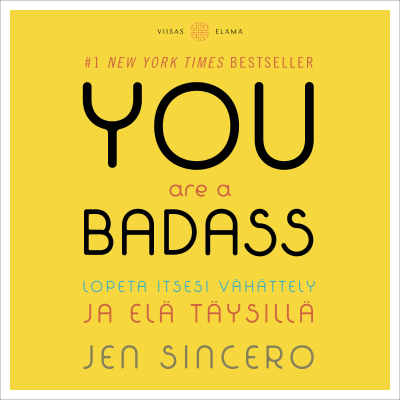NachDenkSeiten – Die kritische Website
saksa
Uutiset & politiikka
Rajoitettu tarjous
2 kuukautta hintaan 1 €
Sitten 7,99 € / kuukausiPeru milloin tahansa.
- Podimon podcastit
- Lataa offline-käyttöön
Lisää NachDenkSeiten – Die kritische Website
NachDenkSeiten - Die kritische Website
Kaikki jaksot
4713 jaksotLisa Fitz – Geschichte ist die Politik von gestern
Geschichte war gestern. Und es lohnt sich, bissl Rückschau zu halten … Weil Geschichte ist ja die Politik von gestern, die zum Heute geführt hat. Heute gibt’s überall Alarm! Ganz Europa ist müde. Müde vom Denken, vom Erinnern, vom eigenen Dasein. Von Lisa Fitz. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Die nächsten Auftritts-Termine und das aktuelle Programm von Lisa Fitz erfahren Sie stets auf der Website lisa-fitz.de [https://www.lisa-fitz.de].
Die Amis sind mitten unter uns – aber Merz und Co. schwadronieren von einem „zerrütteten transatlantischen Verhältnis“
In einem Bericht der „Tagesschau” zur Münchner Sicherheitskonferenz hieß es, Merz gehe auf Distanz zu den USA. Siehe Anlage 1. Der Berliner Tagesspiegel fragt: Haben Deutschland und Europa ohne die USA eine Chance? Siehe Anlage 2. Offensichtlich ist es höchste Zeit für eine Einladung an den Bundeskanzler nach Rheinland-Pfalz und nach Nordbayern. „In der Kaiserslautern Military Community [https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserslautern_Military_Community] leben rund 52.000 US-Amerikaner [https://de.wikipedia.org/wiki/Ramstein_Air_Base]“ … Ramstein ist ein Drehkreuz. Von hier aus „bedienen“ die USA Europa und Afrika. Seit 1945 sind sie hier. Das sind rund 80 Jahre. Und es gibt keinerlei Hinweise und Ansatzpunkte dafür, dass sie unser Land und unsere Region verlassen würden. Noch wichtig in diesem Zusammenhang: Mit finanzieller Unterstützung unseres Landes bauen die USA in Weilerbach das größte Militärkrankenhaus außerhalb der USA. Albrecht Müller. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Das hier ist eine Karte, die einen Überblick verschafft über militärische Einrichtungen der USA, der NATO, von Großbritannien und Frankreich in Deutschland: [https://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/260216-US_military_bases_in_Germany.jpg]https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4ndische_Milit%C3%A4rbasen_in_Deutschland#/media/Datei:US_military_bases_in_Germany.png Quelle: wikipedia – „Ausländische Militärbasen in Deutschland“ [https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4ndische_Milit%C3%A4rbasen_in_Deutschland] / 36ophiuchi / wikicommons [https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4ndische_Milit%C3%A4rbasen_in_Deutschland#/media/Datei:US_military_bases_in_Germany.png] / CC BY-SA 3.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0] Das ist eine Karte auf dem Stand von 2019. Seitdem wurde vermutlich wenig verändert. Diese Karte zeigt: Weitere militärische US-Basen in Rheinland-Pfalz gibt es in Spangdahlem, in Baumholder, in Pirmasens, in Miesau, in Germersheim und in Landstuhl. Eine große Bedeutung haben auch die Militärbasen in Wiesbaden, in Stuttgart und im nordbayerischen Grafenwöhr – ein Truppenübungsplatz. Die südlichen Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern sind also offensichtlich auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch eine Art Besatzungsgebiet. Das hat sich offensichtlich noch nicht bis zum Sauerland, dem Heimatland des Herrn Bundeskanzler, rumgesprochen. Eigentlich müsste er nur mal googeln. Dort steht zu lesen: > „Deutschland ist ein zentraler Stützpunkt für das US-Militär in Europa mit rund 37.000 bis 39.000 Soldaten (Stand Anfang 2026). Hauptstandorte sind die Ramstein Air Base [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/ramstein-die-air-base-ramstein-der-wichtigste-stuetzpunkt-ausserhalb-der-usa-dossier-100.html] (Luftwaffe) und Grafenwöhr [https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/us-streitkraefte-in-bayern-wo-in-der-region-us-soldaten-leben-und-arbeiten-karte-05-02-113125363] (Heer/Übungsplatz). Die Präsenz ist essenziell für die NATO-Verteidigung, dient als Logistikdrehkreuz und hat große wirtschaftliche Bedeutung für die Standortregionen. > > Die US-Armee [https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army] unterhält über 40 Militärstützpunkte [https://en.wikipedia.org/wiki/Military_base] in Deutschland [https://en.wikipedia.org/wiki/Germany], von denen zwei geschlossen werden sollen. Über 220 weitere wurden bereits stillgelegt, die meisten nach dem Ende des Kalten Krieges [https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War] in den 1990er Jahren. Viele waren strategisch günstig gelegen, um im Falle eines Krieges gegen die UdSSR [https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union] als vorgeschobene Stützpunkte zu dienen.“ ---------------------------------------- Anlage 1: Münchner Sicherheitskonferenz [https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/merz-muenchner-sicherheitskonferenz-100.html] Merz geht auf Distanz zu den USA [https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/merz-muenchner-sicherheitskonferenz-100.html] Stand: 13.02.2026 15:36 Uhr Das zerrüttete transatlantische Verhältnis stand im Mittelpunkt der Eröffnungsrede von Bundeskanzler Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Europa müsse ein „selbsttragender Pfeiler“ der NATO werden – etwa mit einem europäischen Atomschirm. Bundeskanzler Friedrich Merz ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf Distanz zum langjährigen Verbündeten USA gegangen. Europa müsse sich aus seiner selbst verschuldeten Abhängigkeit von den USA befreien und „eine neue transatlantische Partnerschaft begründen“, sagte der CDU-Politiker zum Auftakt der Konferenz. ---------------------------------------- Anlage 2: Tagesspiegel Haben Deutschland und Europa ohne die USA eine Chance? Die Münchner Sicherheitskonferenz ist vorbei, nun beginnt die Nachlese der Expertinnen und Experten. Sie können dabei mitmachen: Bei unserem heutigen digitalen „High Noon“-Talk von 12 bis 13 Uhr geht es um Amerikas Kurswechsel und Europas unbequeme Zukunft. Melden Sie sich hier an. [https://nl.tagesspiegel.de/r.html?uid=F.hqJfY80Da6JfbAGiX23OABY6rqJfcs4AATJ6ol9zzmmSpMiiX3XOAqzGVg.Kc0cwxUCxn9yeC4VO-370hkjpa-VIN9QSyxelwKrfUD0jjwwmd_g4ShJkrYzoGEioVNllvNdTjsTF0DOS2_f6Q&stc=VAxa1WuYDdLyysFT6VfKxTyg] ---------------------------------------- Titelbild: 36ophiuchi / wikicommons [https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4ndische_Milit%C3%A4rbasen_in_Deutschland#/media/Datei:US_military_bases_in_Germany.png] / CC BY-SA 3.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0]
Hat Deutschland überhaupt eine China-Strategie?
Mit unserem derzeit größten Handelspartner China haben wir viel Porzellan zerschlagen. Das liegt eher an der „Partner-Rivale“-Weltanschauung unserer Spitzenpolitiker als an China selbst. Seit dem Rückzug der USA als Partner hat sich die Situation eher verschärft. Andere Regierungschefs sind da pragmatischer. Wie geht es nun weiter mit unseren Beziehungen zu China? Ein Artikel von Stephan Ossenkopp. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Die deutsche Politik tut sich derzeit sichtlich schwer mit China, vor allem, da es sich mittlerweile um ein ökonomisch und geopolitisch überaus erfolgreiches Land handelt. Als die Bundesregierung im Jahr 1972 diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik aufnahm, war die chinesische Wirtschaft schwach und das Land innerlich zerrissen. Größere Handelsbeziehungen bestanden kaum. Der damalige FDP-Außenminister Walter Scheel, der die Dokumente in Peking unterzeichnete, stieß im Namen der deutsch-chinesischen Völkerfreundschaft voller Optimismus mit dem kommunistischen Ministerpräsidenten Zhou Enlai an. Er konnte allerdings nicht ermessen, wie rasant sich das Reich der Mitte in den folgenden fünf Jahrzehnten entwickeln würde. Die Bundesrepublik hat seitdem enorm von Chinas Aufstieg profitiert – von seinen Produktionskapazitäten und seinem Markt. In der Folge siedelten sich Tausende deutsche Unternehmen in China an. Autobauer wie Volkswagen errangen schnell den Status einer Legende und begründeten Deutschlands exzellenten Ruf unter allen Chinesen. Schon kurz nach Beendigung der irrigen Kulturrevolution setzte Deng Xiaoping, der Urheber der Reform- und Öffnungspolitik, auf die Ausbildung von Fachkräften, um das Land aufzubauen. Dann machte China den nächsten logischen Schritt und wollte in den modernsten Technologien und Industrien der entwickelten Welt gleichziehen. „Made in China” sollte weltweit genauso für Qualität stehen wie „Made in USA” oder „Made in Germany”. Als China im Jahr 2015 seine Strategie „Made in China 2025” vorstellte, reagierte man im Westen verschnupft, so nach dem Motto: „China als verlängerte Werkbank des Westens, das geht in Ordnung, aber China als ebenbürtiger Partner?” Da hört der Spaß auf. Man bezeichnete das Land schon bald wechselweise als Bedrohung für die nationale Sicherheit (Nationale Sicherheitsstrategie der USA, 2017) oder als „Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen” (Bundesverband der Deutschen Industrie, 2019). Auch alle bis dahin sachlich berichtenden deutschen Zeitungen und Sender änderten ihre Berichterstattung. „China-Strategie“ der Ampel Im Sommer 2023 veröffentlichte die deutsche Ampel-Koalition dann eine erste China-Strategie, die den Wettbewerb und die systemische Rivalität mit China noch stärker betont. Darin heißt es, man betrachte „mit Sorge“ die „Bestrebungen Chinas, die internationale Ordnung entlang der Interessen seines Einparteiensystems zu beeinflussen und dabei auch die Grundfesten der regelbasierten Ordnung zu relativieren”. Solche und ähnliche Kritik gehört seitdem zum China-Kanon eines jeden westlichen Politikers. Die damalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die diese Strategie gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und dem Wirtschaftsministerium ihres grünen Parteikollegen Robert Habeck entwickelt hatte, reiste im April 2023 nach Tianjin und Peking, um dort vor allem moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Das kam erwartungsgemäß nicht gut an. Im September desselben Jahres tauchte sie in den USA auf und bezeichnete Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping in einem Live-Interview gar als Diktator. Damit fielen die deutsch-chinesischen Beziehungen quasi in die Gefriertruhe, aus der sie sich bis heute nicht ganz befreit haben. Wadephuls Fiasko Nach dem Regierungswechsel im Jahr 2025 zur Großen Koalition hatten viele vielleicht auf einen Neustart unter dem nunmehr CDU-geführten Auswärtigen Amt gehofft. In seiner Regierungserklärung vom 14. Mai hatte sich der neue Bundeskanzler Friedrich Merz noch in sehr diplomatischer Sprache geübt. China werde „ein wichtiger Partner Deutschlands und der Europäischen Union bleiben“, auch wenn es „in Chinas außenpolitischem Handeln zunehmend Elemente systemischer Rivalität“ gebe. China müsse mithelfen, den Ukrainekrieg zu beenden, mahnte Merz. Als der neue Außenminister Johann Wadephul im August 2025 nach Japan reiste, passierte jedoch ein Fiasko, das dem Gebaren Baerbocks in nichts nachstand. Denn der deutsche Chefdiplomat teilte in Tokio ordentlich gegen China aus, während er für Japan fast schon unangenehm schmeichlerische Worte fand. Er lobte Japan dafür, dass es seine Verteidigungsausgaben bis 2027 verdoppeln und seine Nationale Sicherheitsstrategie überarbeiten wolle. Indem Wadephul erklärt, es dürfe „nie wieder aggressive Eroberungswut“ geben, stellt er die Argumentation auf den Kopf. In seiner Darstellung sind sowohl Japan als auch Deutschland „starke Demokratien“ und „Verfechter der regelbasierten internationalen Ordnung“, die sich gegen „Gewalt, wie Russlands Angriffskrieg in der Ukraine“, „nordkoreanische Raketentests“ und „Chinas zunehmend aggressives Auftreten“ im Südchinesischen Meer oder gegenüber Taiwan zur Wehr setzen würden. Wusste er wirklich nicht, wie das in Peking ankommen würde – zu einer Zeit, in der gerade zum 80. Mal dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den mehr als 30 Millionen chinesischen Opfern der japanischen Aggression gedacht wird? Wadephuls für den 27. Oktober 2025 geplante Chinareise wurde schließlich abgesagt, da angeblich keine Termine mit hochrangigen chinesischen Politikern vereinbart werden konnten. Ob Terminkonflikte – denn am 28. Oktober begann in Südkorea der heiß erwartete APEC-Gipfel – oder die Verärgerung über Wadephuls Aussagen der Hauptgrund waren, darüber mag man streiten. Vom 8. bis 9. Dezember 2025 holte Minister Wadephul seine Chinareise nach. Er traf Vizepräsident Han Zheng und natürlich seinen Amtskollegen Wang Yi. Dieser erwähnte den verspäteten Start ihrer Beziehungen und zitierte einen chinesischen Sinnspruch, der in etwa der deutschen Volksweisheit „Was lange währt, wird endlich gut“ entspricht. China machte klar, dass es an guten Beziehungen zu Deutschland auf allen Ebenen interessiert ist, wenn nicht Differenzen, sondern gemeinsame Ziele im Vordergrund stünden und Deutschland Kerninteressen wie das Ein-China-Prinzip anerkennt. Chinesische Kommentatoren schrieben, dass Europa sich bewusst geworden sei, dass es die internationalen Turbulenzen nicht ohne Austausch mit China bewältigen könne. Dazu gehöre aber auch „das korrekte Verständnis von China“. Genau an diesem korrekten Verständnis und an echter China-Kompetenz mangelt es derzeit in deutschen Spitzenpositionen. Dort soll die Welt mehr denn je in ein Partner-Rivale-Schema gepresst werden, in ein dualistisches Weltbild des Kampfes zwischen Demokratien und Autokratien. Weltanschauung von Klingbeil und Merz Diese Endkampf-Weltanschauung zeigte sich in jüngster Zeit insbesondere bei zwei Anlässen: In der Rede von Finanzminister Lars Klingbeil zum Start der Diskussion über ein neues SPD-Grundsatzprogramm am 7. Februar 2026 und in der Regierungserklärung von Friedrich Merz vom 29. Januar 2026. Beide Reden standen natürlich unter dem starken Eindruck der dramatischen außenpolitischen Neuausrichtung der US-Regierung in Richtung eines globalen Leviathans, dem die viel beschworene „regelbasierte Ordnung“ und das Völkerrecht eher egal sind. Der außenpolitisch erfahrene Klingbeil wirkte geradezu bis ins Mark erschüttert, sprach von einer Dystopie und der „Vernichtung der Demokratie“ durch die Neuordnung der Welt in Machtzentren. Europa müsse der quasi einzig verbleibende Ort der Freiheit, Prosperität und Kultur sein. Über China sagte Klingbeil: „China zeigt mit seinen Großmachtsambitionen, mit Drohgebärden, mit aggressiver Handels- und Industriepolitik, was sie vorhaben.“ Was genau sie vorhaben, blieb jedoch unbeantwortet. Er wetterte gegen „hochsubventionierte chinesische Produkte, die unsere Märkte überschwemmen, und das entgegen aller Regeln der Welthandelsorganisation“. Dabei war Klingbeil im November 2025 selbst in China, gab ein gemeinsames Kooperationspapier für mehr Zusammenarbeit im Finanzsektor heraus und leitete den strategischen Dialog mit der internationalen Abteilung der KPCh (Kommunistische Partei Chinas). Sein Besuch wurde in China positiv aufgenommen. Zu Beginn seiner Regierungserklärung Ende Januar sprach Merz vom Aufkommen einer „Neuen Weltordnung“, ein Begriff, den YouTube normalerweise als Verschwörungsbegriff kennzeichnet. Seit dem De-facto-Rückzug Donald Trumps aus der Bewaffnung und Finanzierung der Ukraine und vor allem seit dessen Angriff auf Venezuela sowie den Drohungen einer Annexion Grönlands ist dieser Begriff jedoch offenbar salonfähig geworden. Der Kanzler will nun laut seiner Rede mit den „aufstrebenden Demokratien mit offenen und wachsenden Märkten“ zusammenarbeiten. „Wir sind nämlich auf der Welt auch eine normative Alternative zu Imperialismus und Autokratie.“ Er erwähnt China nicht wörtlich, aber das weltanschauliche Gerüst des guten Europas als Bollwerk im Kampf gegen das Böse der Welt ist unübersehbar. Vom 24. bis 27. Februar wird Bundeskanzler Friedrich Merz schließlich China besuchen. Welchen Ton wird er anschlagen? Merz wird als erster aus der aktuellen Regierung sicherlich den Staatspräsidenten Xi Jinping und wohl auch den Premierminister Li Qiang treffen. Das Gewicht dieser Begegnungen wird alles übertreffen, was es bislang an Austausch zwischen beiden Seiten seit dem Regierungsantritt im vergangenen Mai gegeben hat. Neue Ära des Pragmatismus? Wird der Bundeskanzler den Chinesen sagen, dass sie unsere Rivalen sind und wir lieber mit Indien und Japan zusammenarbeiten? Die Realitäten sind andere. Im Jahr 2025 war China unser wichtigster Handelspartner. Allein im Dezember importierten wir Waren im Wert von knapp 16 Milliarden Euro aus China, darunter viele Zulieferprodukte für die heimische Industrie, von denen wir uns nicht einfach abkoppeln können. Deutsche Unternehmen wollen in China mehr investieren, wie die deutsche Außenhandelskammer in Beijing jüngst feststellte. Das trifft natürlich nicht nur auf Deutschland zu. Auch andere Regierungschefs haben dies bereits erkannt und sind früher als Merz nach China aufgebrochen: So landete Emmanuel Macron mit einer Delegation von über 80 Personen, darunter mehrere Minister und fast 40 CEOs großer französischer Unternehmen, in Chinas Hauptstadt. Mit dem finnischen Premierminister Petteri Orpo verabschiedete man einen „Joint Action Plan” für die Jahre 2025 bis 2029, der eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich Innovation vorsieht. Keir Starmer war der erste britische Premierminister seit acht Jahren, der China besuchte. Sein Besuch eröffnete laut China Daily ein „neues Kapitel der pragmatischen Zusammenarbeit zwischen China und Großbritannien“. Und Kanadas Premierminister Carney hat ein Abkommen mit China geschlossen, das seiner Meinung nach „den Geist einer neuen Partnerschaft, einer neuen Ära“ widerspiegelt. Der Begriff einer „neuen Ära“ zieht sich wie ein roter Faden durch all diese Besuche. Es wurde betont, dass die Visiten den Beginn einer erneuerten, langfristig orientierten Partnerschaft markieren. Ob diese Entwicklung vor allem auf die Abkehr von den USA als transatlantischem Partner oder eher auf die Anerkennung der neuen Realität einer dauerhaft starken Industrie- und Technologienation China mit dem wichtigsten Markt der Welt zurückzuführen ist, darüber lässt sich diskutieren. Deutlich wird, dass eine neue Unvoreingenommenheit und ein aktiver Pragmatismus gegenüber Beijing Einzug gehalten haben, um sich in der aktuellen Situation zurechtzufinden. Deutschland verfügt über ausreichend Erfahrung aus über 50 Jahren diplomatischer Beziehungen. Darin Chancen für Kooperationen trotz unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle zu sehen, könnte auch für Berlin das Gebot der Stunde sein. Sowohl von Chinas wirtschaftlichem Aufstieg als auch von seinem Plan, Spitzenreiter bei modernster Technik und Infrastruktur zu werden, könnte das eher gelähmte Deutschland sogar stark profitieren. Wirtschaftlich gesehen ist Deutschland nämlich eher gichtkrank, und das Märchen von unserer „normativen Macht“ nimmt uns ohnehin niemand mehr ab. Titelbild: FatihYavuz / Shutterstock
Das Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit (XXII) – „Moskau dem Erdboden gleichmachen“, „Nachhaltigkeit (neu definiert)“, „Ökosystem“ und „nukleare Gerechtigkeit“
Vokabelkritik ist zu Kriegszeiten das Gebot der Stunde. Ich veröffentliche, nicht zuletzt aus hygienischen Gründen, in unregelmäßigen Abständen eine Sammlung teils verharmlosender, teils lügenhafter Wörter oder Formulierungen, deren Sinn und Funktion es ist, unsere Gesellschaft – uns alle – an das Undenkbare zu gewöhnen und möglichst geräuschlos in Richtung „Kriegstüchtigkeit“ umzukrempeln. Von Leo Ensel. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Mittelstand Defense Forum [https://www.mission2044.com/copy-of-sydney] „Das Mittelstand Defense Forum konzentriert sich auf die zentrale Rolle kleiner und mittlerer Unternehmen sowie Familienunternehmen bei der Stärkung der deutschen und europäischen Verteidigung und Widerstandsfähigkeit.“ – „Mittelstand Defense Forum“: Klingt nach einem Gründerkongress für Schraubenhersteller, ist aber ein Netzwerktreffen für Aufrüstung mit Heimatgefühl. Wo früher Familienbetriebe Gartenzwerge, Küchen oder Kurbelwellen bauten, geht es jetzt um Drohnen, Sensoren und „Resilienz“. Der Mittelstand als Rückgrat der Nation – jetzt auch fürs Bombengeschäft. (vgl. „Mission 2044“) mitgestalten [https://www.welt.de/politik/deutschland/article256298278/bundeskanzler-merz-warnt-muessen-befuerchten-dass-russland-den-krieg-ueber-die-ukraine-hinaus-fortsetzen-wird.html] Kann Deutschland, laut Friedrich Merz, „aus seinen Bündnissen heraus die Entwicklung der Welt in den kommenden Jahren“. Und dafür gibt es eine doppelte Voraussetzung: „Wir brauchen zugleich Stärke und Verlässlichkeit, nach innen und nach außen.“ – Das Ergebnis dieser deutschen Mitgestaltung der Welt – natürlich mit der „stärksten konventionellen Armee Europas“ – sollte man sich besser nicht vorstellen … (By the way: Was sollen eigentlich Stärke und Verlässlichkeit nach innen bedeuten?!) Momentum [https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-und-die-sicherheitsgarantien-cindy-wittke-hohlfeld-leibniz-institut-100.html] „Ich glaube, die Akteure wollen gerade die aktuelle Dynamik nutzen, die wieder in den Verhandlungsprozess hineingekommen ist und auch Trumps signalisierte Willigkeit, dass die USA doch eine gewisse Rolle auch bei der militärischen Absicherung eines wie auch immer gearteten Abkommens spielen könnte.“ Erklärte uns, sämtliche Keywords zu einem vollständigen Satz kombinierend, Professorin Cindy Wittke-Hohlfeld von der Universität Regensburg am 20. August 2025 im Deutschlandfunk. Conclusio: „Es gilt also hier, aus einer Dynamik ein Momentum zu machen.“ – Oder nicht vielleicht doch aus dem „Momentum“ eine „Dynamik“? Wer weiß … (vgl. „Reifemoment“ – By the way: Warum eigentlich nicht „Reifemomentum“?) Moskau dem Erdboden gleichmachen [https://www.berliner-zeitung.de/news/belgiens-verteidigungsminister-theo-francken-dann-werden-wir-moskau-dem-erdboden-gleichmachen-li.10003138] Kündigte vollmundig am 27. Oktober 2025 Theo Francken, seines Zeichens Verteidigungsminister Belgiens, für den Fall an, dass Putin eine konventionelle Rakete auf Brüssel abfeuert. Wörtlich: „Dann trifft er das Herz der NATO, und dann werden wir Moskau dem Erdboden gleichmachen. Er weiß: Wenn ich [Theo Francken] Atomwaffen einsetze, wird Moskau von der Landkarte gewischt. Dann ist das Ende der Welt nahe.“ So wedelt der Schwanz mutig mit dem Hund. Und was dem Führer vor über 80 Jahren nicht gelang, das schafft jetzt der belgische Verteidigungsminister. Im Alleingang! Mut, Konsequenz, Augenmaß [https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/der-staat-und-seine-pflicht-wie-sicher-ist-deutschland-noch-li.2355823] „Ja, wir müssen die Bundeswehr wieder fit machen, aber alles bitte mit dem notwendigen Augenmaß.“ – Klingt das nicht moderat und vernünftig? Außerdem: „Augenmaß“. Wer denkt da nicht sofort an Max Webers berühmte Politikdefinition vom „starken und langsamen Bohren harter Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“? Drei Absätze später steigert Immo von Fallois in der Berliner Zeitung seinen maßvollen Satz folgendermaßen: „Fassen wir also das Sicherheitspotenzial Deutschlands zusammen – sei es im Hinblick auf die innere Ordnung oder die äußere Verteidigungsfähigkeit: Es bleibt noch viel zu tun. Was es jetzt braucht, sind Mut, Konsequenz, Augenmaß [leider fehlt die Max Weber‘sche „Leidenschaft“!] – und endlich eine offene, ehrliche Kommunikation mit den Menschen, die mit ihren Steuern das Fundament unserer Sicherheit finanzieren.“ Ergo – offen und ehrlich, mutig und konsequent: Betreiben wir Aufrüstung mit Augenmaß. Fünf Prozent vom BIP reichen! (vgl. den anderen betörend schönen Hattrick vom „anregendsten Philosophen Europas“: „offen, öffentlich und offensiv“) Nachhaltigkeit (neu definiert) [https://weltwoche.de/daily/nachhaltigkeit-neu-definiert-warum-gruene-fonds-immer-mehr-in-ruestungstitel-investiere/] „Nachhaltigkeit neu definiert: Warum grüne Fonds immer mehr in Rüstungstitel investieren“, titelte die Schweizer Weltwoche im September 2025. Aktueller Trend: „Grüngefärbte Aktienfonds investieren zunehmend in Unternehmen aus der Rüstungsbranche – darunter Airbus und Rheinmetall. Besonders auffällig ist der Zuwachs bei Produkten mit Anlageschwerpunkt Deutschland, die nun in Unternehmen wie Airbus und Rheinmetall anlegen können. Grund ist ein überarbeitetes Regelwerk der Finanzindustrie, das seit Dezember 2024 gilt.“ – Blattgrün meets Oliv. Und grüne Spitzenpolitiker vererben ihren Sprösslingen nun ethische Portfolios mit lukrativen Anlagemöglichkeiten für die nachhaltige [https://overton-magazin.de/top-story/keine-satire-ruestungsindustrie-ist-nachhaltig/] klimaneutrale Aufrüstung. Was gibt es schließlich „Nachhaltigeres“ als den Tod? (vgl. „Ökosystem“) Nachsteuerungsbedarf [https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-10/bnd-praesident-reale-gefahr-russland-krieg-andgriff-militaer] „Europa soll von Furcht und Handlungsstarre gelähmt in die Selbstaufgabe getrieben werden“, klärte der neue BND-Chef Martin Jäger am 13. Oktober 2025 die deutsche Öffentlichkeit über das Kalkül Russlands auf. „So rechnet man sich in Moskau realistische Chancen aus, die eigene Einflusszone nach Westen auszuweiten und das wirtschaftlich vielfach überlegene Europa in die Abhängigkeit von Russland zu bringen.“ Logische Konsequenz: Angesichts dieser Risiken forderte der BND-Chef – Putin sei Dank! – weitere Befugnisse für den Bundesnachrichtendienst. „Hier sehen wir erheblichen Nachsteuerungsbedarf.“ – Halten wir fest: Der Bedarf ist da. Ob vor oder nach Steuern. (Einen gewissen Zweifel können wir uns dennoch nicht verkneifen. Wie schrieb bereits die Tagesschau [https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bnd-jaeger-100.html]? „2013 wurde er deutscher Botschafter in Kabul. Er verkaufte den deutschen Einsatz in Afghanistan als Erfolg, der er am Ende nicht war.“) neue Einsatzmöglichkeiten [https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw23-de-regierungsbefragung-1002264] Nach „neuen Einsatzmöglichkeiten an der russischen Grenze“ befragte am 5. Juni 2024 Philipp Krämer (Bündnis 90/Die Grünen) unseren Kriegstüchtigkeitsminister im Bundestag. Und erhielt postwendend die beruhigende Antwort: „Alles, was aus Deutschland geliefert wird und Ziele im russischen Hinterland angreift, kann eingesetzt werden.“ Mit seinem polnischen Amtskollegen, so Pistorius, sei er regelmäßig im Austausch über die Unterstützung zum Schutz der Ostflanke. Und dann: „Wir sind nicht Kriegspartei, soweit wir es in der Hand haben. Wir wollen und werden nicht Kriegspartei sein.“ Schob er in Richtung Gesine Lötzsch (Die Linke) noch nach. neu erfinden [https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Zeitungsbeitraege/2025/251019-Appell-der-Praesidenten.html] „In der geopolitischen Zeitenwende, die wir erleben, muss Europa sich neu erfinden.“ So unisono die deutschen und österreichischen Bundespräsidenten Steinmeier und Van der Bellen. (Merkwürdigerweise hatten sie ihren unmittelbar zuvor in die Welt gesetzten „doppelten Epochenbruch“, der erheblich besser gepasst hätte, bereits wieder vergessen.) Und das bedeutet – hätten Sie‘s gewusst? – „Wir Europäer müssen selbst für unseren Schutz sorgen, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung glaubhaft stärken. Für dieses Ziel müssen und werden wir als Europa einen größeren Beitrag leisten.“ – Natürlich „proaktiv“! Und zwar mit „außereuropäischen Wertepartnern“. neuer verteidigungspolitischer Pragmatismus Den forderte innovativ am 16. November 2025 Luisa Meier frühmorgens um 6:05 Uhr im Deutschlandfunk. Klingt nach nüchterner Vernunft – und meint: „Wir haben uns an das Fünf-Prozent-Ziel längst gewöhnt!“ nicht mehr im kompletten Frieden [https://www.n-tv.de/politik/Pistorius-Wir-sind-nicht-mehr-im-kompletten-Frieden-article26056734.html] Die Worte, Begriffe und Phrasen, deren Ziel es ist, die klare Grenze zwischen Krieg und Frieden zu verwischen und uns, mental benebelt, – jeden Tag ein bisschen mehr – in den Krieg hineinzuziehen, sind Legion. Es begann mit dem flott-verwaschenen Wörtchen „hybrid“ über diverse „Grauzonen“ oder „graue Kriege“ – und nähert sich langsam, aber sicher einer immer deutlicheren Aussage. – „Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden. Wir werden attackiert, hybrid, mit Desinformationskampagnen und eben durch Drohneneindringen.“ Verkündete am 25. September 2025 Boris Pistolius auf Schloss Ettersburg bei Weimar. Um ganze fünf Tage später bereits von seinem Chef persönlich überholt zu werden: „Ich will‘s mal mit einem Satz sagen, der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schockierend ist, aber ich mein‘ ihn genau, wie ich ihn sage: Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.“ So Friedrich Merz [https://www.stern.de/politik/deutschland/friedrich-merz-und-der-krieg--der-schockierende-satz-des-kanzlers-36092458.html] beim „Ständehaus Treff“ der Rheinischen Post in Düsseldorf. Pistorius‘ beschwichtigendes Wörtchen „komplett“ kam schon gar nicht mehr vor. Demnächst wird Merz sich auch noch die verdruckste Einleitung sparen – bis es irgendwann schlicht heißt: „Wir sind im Krieg!“ (Übrigens war ein Stephan Bierling [https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/aussenpolitik/id_100789382/trump-und-die-nato-kann-sich-der-westen-auch-ohne-die-usa-verteidigen-.html] – es ist wie der Hase und der Igel – schon schneller. Bereits am 24. Juni 2025 konstatierte der Politologe im Videointerview mit t-online [https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/aussenpolitik/id_100789382/trump-und-die-nato-kann-sich-der-westen-auch-ohne-die-usa-verteidigen-.html] trocken: „Die NATO ist schon im Krieg mit Russland.“ – Aber auch er war nicht der Erste: The winner is – eine gewisse werteorientierte Ex-Außenministerin mit dem Klassensprecher*innen-Habitus! Die verkündete bereits zweieinhalb Jahre zuvor, am 24. Januar 2023, in unmissverständlichem Deutsch: „We are fighting a war against Russia“ [https://www.berliner-zeitung.de/news/ukraine-krieg-aussenministerin-annalena-baerbock-we-are-fighting-a-war-against-russia-li.310974]. Der Avantgardestatus der GRÜNEN ist halt unschlagbar!) (vgl. „dämmrige Übergangszeit“, „irgendwas dazwischen“) nukleare Gerechtigkeit [https://www.icanw.de/wp-content/uploads/2023/12/ICAN-Deutschland-2023-Nukleare-Gerechtigkeit-Deutsch.pdf] Diesem nach „Geschlechter-“ und „Generationengerechtigkeit“ drittwichtigsten Thema hat, strahlend naiv, ausgerechnet die Internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen (ICAN) eine ganze Broschüre gewidmet. Alles völlig überflüssig. Schließlich gibt es auf diesem Planeten keine größere Gerechtigkeit als die nukleare: Wenn es knallt, erwischt es alle. Ausnahmslos. Gender-, generationen- und sonstwiegerecht! nuklearer Schutzschirm Verknüpft in klassisch Orwell’scher Manier die größtmögliche Gefahr mit dem beschwichtigenden Wort „Schutz“. Die insinuierte Logik: Atombomben schützen vor Atombomben: ‚Ihre‘ und ‚unsere‘ Bomben („Plus“ plus „Minus“ – Abrakadabra – gleich „Null“!) neutralisieren sich glücklicherweise. – Für einige Menschen auch noch mit einer besonderen Konnotation versehen: Welch gläubiger Katholik denkt hier nicht unwillkürlich an das jahrhundertealte Kirchenlied „Maria, breit den Mantel aus [https://de.wikipedia.org/wiki/Maria,_breit_den_Mantel_aus]/ Mach Schirm und Schild für uns daraus/ Lass uns darunter sicher stehn/ Bis alle Stürm‘ vorüber gehn“. (In der Logik der NATO bzw. des sich „selbstenthauptenden Europa“ wäre „Maria“ wahlweise durch „Donald“ bzw. „Emmanuel“ zu ersetzen.) nuklear unterfüttern [https://www.zeit.de/politik/2025-10/atomwaffen-atombombe-claudia-major-donald-trump-europa] „Russland hat diesen Krieg selbst nuklear unterfüttert.“ Verkündete, unterfüttert von einem – nichts könnte den Ernst der Lage eindrücklicher demonstrieren – martialischen Schwarz-Weiß-Video aus inferiorer Perspektive: Claudia Major in ZeitOnline. (Hoffentlich wird uns der Kreml demnächst nicht auch noch nuklear überfüttern!) Ökosystem [https://www.deutschlandfunk.de/spahn-fuer-sofortigen-aufbau-von-abwehr-102.html] „Statt mit Kampfjets auf Drohnen zu schießen, benötige man ein verzahntes und agiles technologisches Ökosystem, mit dem man sofort reaktionsfähig sei. Jetzt – und nicht erst in fünf Jahren!“ Forderte der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn punktgenau zum 35. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung. – Nach „Greening the armies“, der „neu definierten Nachhaltigkeit“, dem „Grünbuch“ oder der „nachhaltigen Wehrhaftigkeit“ ein weiterer Schritt zur ‚Ökologisierung des Militärs‘. (Bis noch vor Kurzem hätte man statt von „Öko-“ von einem „Verbundwaffensystem“ gesprochen.) Die ins Olive gewendeten GRÜNEN werden es dem Christdemokraten danken. Gemeinsames Motto für die übermorgige schwarz-grüne Koalition: „Krieg – im Einklang mit Mutter Natur!“ (wird fortgesetzt) Titelbild: arvitalyaart / shutterstock.com ---------------------------------------- Mit freundlicher Genehmigung von Globalbridge [https://globalbridge.ch/das-woerterbuch-der-kriegstuechtigkeit-xxii-moskau-dem-erdboden-gleichmachen-nachhaltigkeit-neu-definiert-oekosystem-und/]. Alle bisher erschienenen Folgen der Serie „Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit“ von Leo Ensel können Sie in dieser Übersicht finden [https://www.nachdenkseiten.de/?tag=woerterbuch-der-kriegstuechtigkeit] und diese auch einzeln darüber aufrufen.
Medien, Moral und Maßstäbe: Warum Venezuela anders bewertet wird (Serie zu Venezuela, Teil 5)
Wenn deutsche Leitmedien über Venezuela berichten, geschieht dies seit Jahren mit einer auffälligen sprachlichen und moralischen Eindeutigkeit. Begriffe wie „Diktatur“, „Regime“ oder „Failed State“ strukturieren die Berichterstattung und prägen nachhaltig die Wahrnehmung politischer, wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungen. Sie erscheinen dabei weniger als erklärungsbedürftige Zuschreibungen denn als feststehende Deutungen, die kaum noch erläutert oder hinterfragt werden. Von Detlef Koch. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Den ersten Teil der Serie finden Sie unter diesem Link [https://www.nachdenkseiten.de/?p=144907], den zweiten unter diesem Link [https://www.nachdenkseiten.de/?p=145231], den dritten unter diesem Link [https://www.nachdenkseiten.de/?p=145598] und den vierten unter diesem Link [https://www.nachdenkseiten.de/?p=145939]. Die oben genannten Begriffe entfalten ihre Wirkung nicht allein durch ihre Häufigkeit, sondern durch ihre Funktion. Sie ordnen ein Land moralisch ein, delegitimieren politische Akteure und begrenzen den Raum dessen, was als erklärungsbedürftig, vergleichbar oder diskussionswürdig gilt. Wer als „Regime“ beschrieben wird, erscheint nicht mehr als Akteur innerhalb eines politischen Konflikts, sondern als dessen Ursache. Wer als „Failed State“ gilt, muss nicht mehr verstanden, sondern verwaltet werden. Dabei steht außer Frage, dass Venezuela sich seit Jahren in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise befindet. Die entscheidende Frage ist nicht, ob diese Krise real ist, sondern wie sie medial gedeutet wird. Auffällig ist, dass deutsche Leitmedien Venezuela mit einer Konsequenz moralisch delegitimieren, die in der Berichterstattung über andere Staaten mit vergleichbarer oder teils deutlich schlechterer Menschenrechtslage so nicht zu beobachten ist. Während dort häufig von „Stabilität“, „Reformen“ oder „strategischer Partnerschaft“ die Rede ist, dominiert im Fall Venezuelas ein nahezu geschlossenes Negativnarrativ. Diese Asymmetrie verweist auf die Funktionsweise medialer Frames. Berichterstattung bildet politische Realität nicht einfach ab, sondern wählt aus, gewichtet und kontextualisiert. Bestimmte Aspekte werden hervorgehoben, andere marginalisiert oder ausgeblendet. Durch Wiederholung verfestigen sich Deutungen, bis sie als selbstverständlich erscheinen. Auf diese Weise entstehen narrative Strukturen, die politische Konflikte nicht nur beschreiben, sondern vorstrukturieren. Besonders deutlich wird dies dort, wo vermeintliche moralische Eindeutigkeit analytische Offenheit ersetzt. Komplexe Ursachenketten werden verkürzt, Verantwortung externalisiert, alternative Perspektiven an den Rand gedrängt. Politische Akteure erscheinen entweder als legitime Vertreter von Demokratie oder als illegitime Machthaber jenseits des akzeptablen Diskurses. Diese binäre Logik erleichtert Orientierung, erschwert jedoch ein vertieftes Verständnis politischer Zusammenhänge. Damit berührt die Berichterstattung über Venezuela eine grundsätzliche Frage demokratischer Öffentlichkeit. Leitmedien reklamieren für sich, Macht zu kontrollieren, Interessen offenzulegen und politische Entscheidungen kritisch zu begleiten. Wo Berichterstattung jedoch primär exekutive Narrative reproduziert und moralische Deutungen verabsolutiert, verschiebt sich diese Rolle. Medien werden dann weniger zu Instanzen kritischer Kontrolle als zu Akteuren der Stabilisierung bestehender Deutungsrahmen. Venezuela ist in diesem Zusammenhang kein Sonderfall, aber an ihm lässt sich exemplarisch zeigen, wie Framing wirkt, wie selektive Empörung entsteht und welche Folgen dies für politische Urteilsfähigkeit hat. Nicht die Verteidigung oder Verurteilung eines Staates steht im Zentrum, sondern die Frage, wie viel demokratische Offenheit eine mediale Öffentlichkeit zulässt – und wo sie sich selbst begrenzt. I. Was „Framing“ ist Medien berichten nicht einfach über Ereignisse. Sie entscheiden, was gezeigt wird, wie es benannt wird und in welchem Zusammenhang es erscheint. Genau dieser Deutungsrahmen wird in der Kommunikationswissenschaft als „Framing“ bezeichnet. Ein Frame (zu deutsch: „Rahmen“) ist dabei weder Kommentar noch offene Meinungsäußerung, sondern die strukturierende Perspektive, innerhalb der Informationen präsentiert und verstanden werden. Framing beginnt oft unscheinbar: mit der Wortwahl in Überschriften, mit wiederkehrenden Begriffen, mit der Auswahl von Bildern oder Gesprächspartnern. Ob von einer „Regierung“ oder einem „Regime“ die Rede ist, ob ein Staat als „Partner“ oder als „Problemfall“ erscheint, beeinflusst die Einordnung politischer Entwicklungen – häufig, noch bevor Leserinnen und Leser sich bewusst mit den Inhalten auseinandersetzen. Wichtig ist: Framing bedeutet nicht, dass Medien lügen. Die berichteten Fakten können durchaus korrekt sein. Der Effekt entsteht allein durch Gewichtung, Kontextualisierung und Wiederholung. Bestimmte Aspekte werden kontinuierlich hervorgehoben, andere treten in den Hintergrund oder verschwinden vollständig aus dem Blickfeld. Auf diese Weise entsteht ein konsistentes Gesamtbild, das mit der Zeit als selbstverständlich wahrgenommen wird. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht diese Wirkung: Wird über ein Land überwiegend in Begriffen wie „Krise“, „Chaos“, „Notstand“ oder „Diktatur“ berichtet, entsteht der Eindruck eines dauerhaften Ausnahmezustands. Politische Konflikte erscheinen dann nicht mehr als Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Akteuren und Ursachen, sondern als Ausdruck eines grundsätzlich gescheiterten Systems. In einem solchen Deutungsrahmen wirken Wörter wie Sanktionen, Isolation oder externe Eingriffe schnell plausibel – unabhängig von der tatsächlichen Situation. Framing entfaltet ja seine besondere Macht gerade deshalb, weil es selten als Bewertung wahrgenommen wird. Es tarnt sich als unauffällige Normalität der Berichterstattung. Wer diesen Rahmen nicht bewusst reflektiert, übernimmt ihn häufig unbemerkt – nicht aus Zustimmung, sondern aus Gewöhnung. Für eine demokratische Öffentlichkeit ist das von erheblicher Bedeutung. Medien sollen eigentlich nur informieren, einordnen und politische Macht kritisch begleiten. Wenn Framing jedoch bestimmte Deutungen dauerhaft und unbemerkt festschreibt und alternative Perspektiven systematisch ausblendet, verengt sich der Raum eigenständigen Urteilens. Die Frage ist dann nicht mehr nur, was berichtet wird, sondern vor allem auch, was nicht berichtet wird. In der politischen Berichterstattung entscheidet daher nicht allein, welche Fakten genannt werden, sondern in welchem sprachlichen und narrativen Zusammenhang sie stehen. Wortwahl, Metaphern, wiederkehrende Zuschreibungen und die Auswahl politischer Akteure strukturieren die Wahrnehmung politischer Realität und prägen langfristig öffentliche Deutungsmuster. Diese Muster entstehen nicht punktuell, sondern – wie bereits erwähnt – durch Wiederholung über Zeit und Medien hinweg. Sie verfestigen sich zu Hintergrundannahmen, vor denen politische Ereignisse interpretiert und bewertet werden. Im Fokus stehen dabei nicht einzelne Beiträge oder journalistische Entscheidungen, sondern stabile Darstellungsweisen, die sich in Überschriften, Teasern, Bildunterschriften und der Gewichtung von Stimmen wiederfinden. Vergleiche mit der Berichterstattung über andere Staaten machen solche Muster sichtbar. Sie erlauben es, zu prüfen, ob vergleichbare politische oder menschenrechtliche Sachverhalte mit unterschiedlichen Maßstäben beschrieben werden und welche Deutungsrahmen dabei dominieren. Es geht dabei nicht um die Gleichsetzung politischer Systeme, sondern um die Vergleichbarkeit journalistischer Rahmung. Diese Perspektive versteht Medienkritik als Bestandteil demokratischer Öffentlichkeit. Sie fragt nicht nach Absicht oder Schuld, sondern nach der Wirkung etablierter Darstellungsweisen – und danach, welche politischen Vorannahmen sie nahelegen, ohne ausdrücklich benannt zu werden. Framing in deutschen Leitmedien In der Berichterstattung deutscher Leitmedien über Venezuela lassen sich wiederkehrende Framing-Muster erkennen, die sich auf drei Ebenen beschreiben lassen: * die Gestaltung von Überschriften und Anmoderationen, * die verwendete Wortwahl sowie * die moralische Zuschreibung politischer Akteure und Prozesse. Diese Ebenen strukturieren nicht nur Information, sondern prägen – oft unauffällig – den Deutungsrahmen, in dem politische Entwicklungen wahrgenommen werden. Besonders deutlich treten diese Mechanismen in boulevardnahen Medien zutage. Springer-Titel wie BILD oder WELT fungieren dabei als zugespitzter Verdichtungsfall. Bereits in Überschriften und Anmoderationen kommen dort häufig stark konnotierte Begriffe und eskalierende Motive zum Einsatz, die politische Prozesse früh auf Bedrohung, Ausnahmezustand oder moralische Eindeutigkeit zuschneiden. Wortwahl und Zuschreibung greifen eng ineinander und erzeugen ein geschlossenes, emotional aufgeladenes Deutungsangebot. Diese Zuspitzung ist Teil eines publizistischen Modells, das weniger auf analytische Offenheit als auf klare Positionierung zielt. Entscheidend für die hier verfolgte Fragestellung ist jedoch die Berichterstattung öffentlich-rechtlicher und anderer sogenannter Qualitätsmedien. Auch dort strukturieren Überschriften und Anmoderationen die Wahrnehmung Venezuelas häufig als dauerhaften Krisen- und Problemfall. Zwar fällt die Sprache insgesamt moderater aus, doch der wiederkehrende Rahmen eines politisch dysfunktionalen Sonderfalls bleibt bestehen. Bereits auf der Einstiegsebene wird damit ein Interpretationsrahmen gesetzt, der alternative Vergleichs- oder Erklärungsperspektiven begrenzt. Auf der Ebene der Wortwahl dominieren auch in diesen Medien Begriffe wie Krise, Instabilität oder autoritäre Herrschaft. Diese Begriffe sind nicht per se falsch, entfalten jedoch durch ihre kontinuierliche Wiederholung eine normalisierende Wirkung. Politische Konflikte erscheinen dadurch weniger als Ergebnis komplexer historischer, ökonomischer und externer Ursachenketten, sondern als Ausdruck eines grundsätzlich defizitären Systems. Hinzu kommt die Ebene der moralischen Zuschreibung. Einzelereignisse, politische Entscheidungen oder institutionelle Defizite werden häufig so eingebettet, dass sie über den konkreten Anlass hinaus die politische Ordnung Venezuelas insgesamt charakterisieren. Diese Form der Rahmung reduziert analytische Offenheit zugunsten moralischer Eindeutigkeit. Differenzierungen, Vergleichsperspektiven oder konkurrierende Erklärungsansätze treten in den Hintergrund. Der zentrale Unterschied zwischen Boulevard-, „Qualitäts“- und öffentlich-rechtlichen Medien liegt damit weniger im grundlegenden Deutungsrahmen als in seiner sprachlichen Ausgestaltung. Während boulevardnahe Medien bestehende Frames emotional verdichten und zuspitzen, reproduzieren öffentlich-rechtliche Medien ähnliche Rahmungen in eher zurückhaltenderer, sachlicherer Form. Gerade darin liegt ihre besondere Wirkung: Der Deutungsrahmen erscheint weniger als Zuspitzung, sondern als selbstverständliche Beschreibung politischer Realität. II. Vergleichende Perspektive Ein vergleichender Blick auf Venezuela und andere Staaten zeigt, dass mediale Empörung nicht proportional zur dokumentierten Schwere von Menschenrechtsverbrechen verteilt wird. Um diese Asymmetrie sichtbar zu machen, werden im Folgenden identische forensische Maßstäbe angelegt. Entscheidend ist dabei nicht politische Einordnung oder Systemvergleich, sondern die konkrete, belegte Praxis staatlicher Gewalt und Repression. Venezuela – Folter, Misshandlung und Repression In Venezuela dokumentieren Human Rights Watch [1] und Amnesty International systematische Folter, Misshandlung und andere inhumane Praktiken im Kontext staatlicher Repression. Laut dem Bericht wurden nach der Präsidentenwahl 2024 über 2.000 Personen im Zusammenhang mit Protesten, oppositioneller Aktivität oder Menschenrechtsarbeit festgenommen. Viele der Betroffenen wurden ohne Zugang zu Rechtsbeistand oder Kontakt zu Angehörigen inhaftiert. Human Rights Watch berichtet von körperlicher und psychologischer Folter, darunter schwere Schläge, elektrische Schocks, herbeigeführte Atemnot mit Plastiktüten, lang anhaltende Einzelhaft sowie weitere Praktiken, die nach internationalem Recht als Folter oder grausame, unmenschliche Behandlung gelten. Zusätzlich dokumentiert Amnesty International [2] mindestens 15 Fälle von erzwungenem Verschwindenlassen seit Juli 2024. In mehreren Fällen wurden die Betroffenen über Wochen oder Monate ohne bestätigten Aufenthaltsort festgehalten. Angehörige erhielten keinerlei verlässliche Auskunft über ihr Schicksal – ein Vorgehen, das Amnesty als schwere Menschenrechtsverletzung und als Verletzung des absoluten Folterverbots einstuft. Venezolanische Menschenrechtsorganisationen wie Provea [3] berichten ergänzend von Hunderten dokumentierten Fällen grausamer, erniedrigender oder entwürdigender Behandlung in Haft. Saudi-Arabien – Todesstrafe, Folter und staatliche Repression In Saudi-Arabien dokumentiert Amnesty International [4] eine der weltweit höchsten Zahlen staatlich vollstreckter Todesurteile. Im Bericht „Death Sentences and Executions 2024“ weist die Organisation mindestens 345 bestätigte Exekutionen allein im Jahr 2024 aus – ein historischer Höchststand seit Beginn der systematischen Erfassung. Ein erheblicher Teil dieser Hinrichtungen erfolgte wegen Drogendelikten, vielfach nach Verfahren, die grundlegenden rechtsstaatlichen Mindeststandards widersprechen. Amnesty International [5] belegt zudem, dass Todesurteile regelmäßig auf Geständnissen beruhen, die unter Folter oder Misshandlung erzwungen wurden, und dass Angeklagten der Zugang zu wirksamer Verteidigung systematisch verwehrt wird. Besonders betroffen sind ausländische Arbeitsmigranten, die einem erhöhten Risiko willkürlicher Strafverfolgung und extremer Strafen ausgesetzt sind. Darüber hinaus dokumentieren Amnesty International und Human Rights Watch die Inhaftierung politischer Dissidenten, Journalisten und Menschenrechtsverteidigern allein aufgrund friedlicher Meinungsäußerung, langjährige Haftstrafen wegen Social-Media-Posts sowie umfassende Einschränkungen der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Ägypten – Masseninhaftierung, Folter und Todesurteile In Ägypten dokumentiert Amnesty International eine anhaltende und systematische staatliche Repressionspraxis gegen politische Opposition, Zivilgesellschaft und unabhängige Medien. Im Länderbericht „Egypt: Human Rights in 2024“ [6] beschreibt die Organisation die fortgesetzte willkürliche Inhaftierung von zehntausenden politischen Gefangenen, darunter Oppositionspolitiker, Journalistinnen, Anwälte, Menschenrechtsverteidiger und Aktivisten. Amnesty International und Human Rights Watch [7] berichten übereinstimmend von der systematischen Anwendung von Folter, Misshandlung und erzwungenem Verschwindenlassen. Betroffene werden häufig über Wochen oder Monate ohne Kontakt zu Angehörigen oder Rechtsbeistand festgehalten. Unter Zwang erlangte Geständnisse dienen regelmäßig als Grundlage für Anklagen und Verurteilungen. Darüber hinaus setzt der ägyptische Staat weiterhin die Todesstrafe nach grob unfairen Massenverfahren ein. Auch 2024 wurden Todesurteile verhängt und vollstreckt, häufig nach Verfahren vor Sonder- oder Militärgerichten, ohne rechtsstaatliche Mindestgarantien und unter Verwertung erzwungener Geständnisse. Weitere dokumentierte Tatkomplexe umfassen die Kriminalisierung friedlicher Meinungsäußerung, massive Einschränkungen der Presse- und Versammlungsfreiheit sowie den systematischen Einsatz von Anti-Terror-Gesetzen zur Unterdrückung legitimer Opposition. Israel / Palästina (Gaza) – Vertreibung, Tötungen, Hunger, Zerstörung und Folter Im Gaza-Krieg dokumentiert Human Rights Watch [8] die gewaltsame Vertreibung von rund 1,9 Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern, also von über 80 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens. In ihrem Bericht „Hopeless, Starving, and Besieged“ (2024) bewertet HRW diese Praxis als völkerrechtswidrige Zwangsvertreibung, auch als „ethnische Säuberung“ bekannt. Parallel dazu berichten UN-Organisationen [9] über ein Ausmaß tödlicher Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, das in der jüngeren Konfliktgeschichte ohne Vergleich ist. Nach Angaben von UN-OCHA und UNICEF wurden bis zum 23. Dezember 2025 mindestens 20.179 Kinder getötet. Diese Zahl bezieht sich ausschließlich auf identifizierte Todesopfer und schließt eine unbekannte Zahl von Kindern, die unter Trümmern verschüttet oder bislang nicht registriert wurden, ausdrücklich nicht ein. Darüber hinaus dokumentieren UN-Organisationen, Human Rights Watch und Amnesty International weitere klar belegte Tatkomplexe: * Hunger als Kriegswaffe [10], umgesetzt durch die systematische Belagerung des Gazastreifens, massive Einschränkungen humanitärer Hilfe und die Zerstörung der lokalen Nahrungsmittelversorgung; * die Abriegelung von Wasser-, Strom- und Gesundheitsinfrastruktur, die von den Vereinten Nationen als kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung eingeordnet wird; * die weitgehende Zerstörung ziviler Infrastruktur, darunter Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und Wohngebiete, wodurch grundlegende Lebensbedingungen dauerhaft zerstört wurden; * Folter, Misshandlung und inhumane Behandlung von Palästinenserinnen und Palästinensern in israelischer Haft, einschließlich Incommunicado-Haft ohne Kontakt zu Rechtsbeistand [11] oder Angehörigen, systematischer Misshandlung durch Hunde und Menschen während Verhören sowie Todesfällen in Gewahrsam, wie von Amnesty International, dem UN-Menschenrechtsbüro und israelischen Menschenrechtsorganisationen dokumentiert. Vergleicht man diese Befunde entlang identischer menschenrechtlicher Kriterien, zeigt sich keine Entsprechung zwischen der dokumentierten Schwere und Systematik der Verbrechen und der Intensität, Wortwahl und moralischen Zuspitzung westlicher Medienberichterstattung. Diese Diskrepanz lässt sich nicht mit Unkenntnis, fehlenden Informationen oder mangelnder Quellenlage erklären. Die relevanten Befunde sind seit Monaten öffentlich dokumentiert, international zugänglich und journalistisch verwertbar. Entscheidend ist daher nicht das Ob der Berichterstattung, sondern das Wie: welche Befunde hervorgehoben, welche relativiert, welche kontextualisiert und welche sprachlich zugespitzt werden. Die unterschiedliche Intensität medialer Empörung verweist damit auf strukturelle Muster der außenpolitischen Berichterstattung selbst. Sie legt nahe, dass moralische Rahmung weniger aus der Schwere dokumentierter Verbrechen entsteht als aus der politischen Einordnung der betroffenen Akteure innerhalb westlicher Macht-, Bündnis- und Ordnungslogiken. IV. Warum diese Selektivität kein Zufall ist Die beobachtete Selektivität medialer Empörung ist kein Zufall. Sie entsteht aus einem Zusammenspiel struktureller Zwänge und bewusster redaktioneller Entscheidungen, in denen journalistisches Wissen über Sprache, Framing und Wirkung gezielt eingesetzt wird. Insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik greifen gut erforschte Mechanismen der politischen Berichterstattung, die Deutungsräume ordnen, gewichten und begrenzen. Diese Mechanismen wirken jedoch nicht abstrakt oder automatisiert, sondern durch konkret handelnde Akteure in Redaktionen, die politische Relevanz und Legitimität sprachlich herstellen, stabilisieren oder in Frage stellen. Strukturen wirken dabei nicht als Zwang, sondern als Rahmen und Anreizsysteme journalistischen Handelns – sie erklären Entscheidungen, heben Verantwortung jedoch nicht auf. Ein für Journalisten entlastender und zentraler Erklärungsansatz ist die sogenannte Indexing-Hypothese. [12] Sie beschreibt ein wiederkehrendes Muster: In außenpolitischen Fragen orientieren sich Leitmedien häufig an dem Spektrum von Positionen, das innerhalb der politischen Entscheidungseliten als akzeptabel gilt. Je geschlossener der Konsens zwischen Regierung, Ministerien und etablierten Parteien, desto enger fällt in der Regel auch der mediale Deutungsrahmen aus. Fundamentale Kritik bleibt dann selten – nicht, weil sie objektiv unrealistisch oder politisch unverantwortlich wäre, sondern weil sie außerhalb jenes Rahmens liegt, den mächtige Akteure definieren und dessen Akzeptanz für journalistischen Zugang, Exklusivität und Nähe funktional ist. Journalismus steht in diesem Feld nicht außerhalb der Macht, sondern in einem symbiotischen Verhältnis zu ihr. Politische und militärische Entscheidungsträger gewähren Informationen, Hintergrundgespräche und exklusive Einblicke; Medien verschaffen im Gegenzug Reichweite, Deutungshoheit und öffentliche Präsenz. Dieses Austauschverhältnis begünstigt die Übernahme diplomatischer Deutungsrahmen und sicherheitspolitischer Sprachmuster, etwa wenn Menschenrechtsverletzungen als Teil komplexer Interessenlagen eingeordnet oder relativiert werden, und begünstigt so eine Berichterstattung, die zentrale Prämissen der Macht nicht grundsätzlich infrage stellt. Im Gegenteil – es überlässt damit faktisch den politischen Akteuren die Definitionsmacht darüber, was als „verantwortbar“, „realistisch“ oder „alternativlos“ gilt. Ein weiterer Faktor liegt in der sozialen Struktur journalistischer „Eliten“ selbst. „Spitzenjournalismus“ rekrutiert sich überwiegend aus akademischen, bürgerlichen Milieus und bewegt sich in sozialen Räumen, die jenen politischer und wirtschaftlicher Entscheidungsträger ähneln. [13] Gemeinsame Bildungswege, ähnliche kulturelle Selbstverständlichkeiten und geteilte Ordnungsvorstellungen prägen Wahrnehmung und Bewertung politischer Konflikte. Medienorganisationen tendieren daher dazu, journalistische Karrieren zu fördern, deren politische und kulturelle Selbstverständlichkeiten mit den Erwartungen politischer und wirtschaftlicher Eliten kompatibel sind. Diese Kompatibilität ist daher als das Ergebnis struktureller Passung zwischen sozialer Herkunft, professionellem Habitus und den „Anforderungen“ außenpolitischer Berichterstattung zu betrachten. Zusammengenommen entsteht so ein System, in dem bestimmte Deutungen wahrscheinlicher werden als andere, weil sie im bestehenden Gefüge aus Quellenabhängigkeit, professionellen Routinen und sozialer Nähe Resonanz finden. Selektive Empörung ist also kein bloßes Nebenprodukt struktureller Zwänge, sondern das Ergebnis bewusster journalistischer Entscheidungen innerhalb dieser Strukturen, die sich am Maßstab des eigenen Berufsethos messen lassen müssen. Gerade deshalb ist selektive Empörung demokratietheoretisch relevant. Wenn sich mediale Legitimität dauerhaft an politischer Regierungsfähigkeit orientiert und nicht an der Schwere dokumentierter Menschenrechtsverbrechen, verschiebt sich der Maßstab öffentlicher Urteilsbildung. Die Analyse der Venezuela-Berichterstattung macht dieses Spannungsverhältnis sichtbar – nicht als Ausnahme, sondern als exemplarischer Fall einer breiteren Logik außenpolitischer Gegebenheiten. V. Ein Schlusskommentar: Framing, Verantwortung und demokratische Selbstverteidigung Framing/Rahmung ist kein beiläufiges Stilmittel journalistischer Arbeit, sondern ein machtvoller Eingriff in demokratische Urteilsbildung. Wer entscheidet, welche Konflikte moralisch aufgeladen werden, welche als komplexe Interessenlagen erscheinen und welche Staaten dauerhaft als Abweichung markiert werden, beeinflusst nicht nur Wahrnehmung, sondern politische Handlungsmöglichkeiten. Framing strukturiert Realität – und damit Verantwortung. Aus dieser Einsicht erwächst eine besondere Pflicht für journalistische Medien, insbesondere für Leitmedien mit hoher Reichweite. Journalistische Freiheit bedeutet nicht Beliebigkeit, sondern Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Wer über Außen- und Sicherheitspolitik berichtet, kann sich nicht darauf zurückziehen, lediglich zu informieren oder bestehende Deutungsrahmen weiterzugeben. Journalisten und Chefredaktionen tragen Verantwortung dafür, ob sie Macht kontrollieren und einhegen oder ob sie die Interessen der Mächtigen gegen eine Mehrheit der Bevölkerung stabilisieren. Aber auch als Leser und Konsumenten journalistischer Erzeugnisse sind wir immer wieder herausgefordert. Als Teil der demokratischen Öffentlichkeit nehmen wir idealerweise Informationen im Modus kritischer Aneignung auf. Leider ist das nicht der Regelfall, und viele Menschen übernehmen den medial vorgegebenen Deutungsrahmen ungeprüft und werden so zum Teil ihrer Reproduktion. Noam Chomsky [14] sprach in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit „intellektueller Selbstverteidigung“, also der Fähigkeit, Sprache zu hinterfragen, Interessen zu erkennen, Vergleichsmaßstäbe einzufordern und moralische Asymmetrien sichtbar zu machen. Diese Fähigkeiten sind keine akademische Übung, sondern Voraussetzung demokratischer Mündigkeit. Der Fall Venezuela macht diese Zusammenhänge exemplarisch deutlich. Er zeigt, dass mediale Schärfe nicht allein aus der Schwere dokumentierter Menschenrechtsverletzungen resultiert, sondern aus ihrer Einbettung in politische und normative Ordnungen. Wer diesen Mechanismus erkennt, relativiert weder autoritäre Praktiken noch Menschenrechtsverbrechen. Im Gegenteil: Nur wer Maßstäbe vergleichbar anlegt, kann sie auch glaubwürdig vertreten. Demokratie erodiert nicht nur durch offene Zensur oder autoritäre Gewalt, sondern auch durch unsichtbare Verschiebungen öffentlicher Deutungsrahmen. Framing verschwindet nicht, aber es verliert seine Macht, sobald es von uns erkannt, benannt und kritisch reflektiert wird. Wir, die Konsumenten, die Journalisten und die Medienschaffenden im erweiterten Sinne, sind das demokratische Korrektiv – und darin liegt die gemeinsame Verantwortung von Journalismus und Öffentlichkeit. Echte demokratische Öffentlichkeit beginnt dort, wo Framing sichtbar gemacht wird, oder wie es Albrecht Müller in seinem Buchtitel so treffend formulierte: „Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst“ [https://westendverlag.de/Glaube-wenig-hinterfrage-alles-denke-selbst/1434] Titelbild: zmotions / Shutterstock ---------------------------------------- [«1] Human Rights Watch (2025) [https://www.hrw.org/report/2025/04/30/punished-seeking-change/killings-enforced-disappearances-and-arbitrary-detention] Punished for Seeking Change: Killings, Enforced Disappearances and Arbitrary Detention Following Venezuela’s 2024 Election [«2] Amnesty International (2025) [https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/07/venezuela-desapariciones-forzadas-constituyen-crimenes-de-lesa-humanidad/] Venezuela: Enforced disappearances constitute crimes under international law / Human Rights in Venezuela 2024/25 [«3] PROVEA (2024/2025) [https://provea.org/actualidad/informe-provea-2024-situacion-de-los-derechos-humanos-en-venezuela-2/] Situación de los Derechos Humanos en Venezuela [«4] Amnesty International (2025) [https://www.amnesty.org/en/documents/act50/8976/2025/en/] Death Sentences and Executions 2024 [«5] Amnesty International (2024/2025) [https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/saudi-arabia/] Saudi Arabia: Human Rights Report [«6] Amnesty International (2025) [https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/north-africa/egypt/report-egypt/] Egypt: Human Rights in 2024 [«7] Human Rights Watch (2024/2025) [https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/egypt] Egypt – World Report [«8] Human Rights Watch (2024) [https://www.hrw.org/report/2024/11/14/hopeless-starving-and-besieged/israels-forced-displacement-palestinians-gaza] Hopeless, Starving, and Besieged [«9] United Nations Office [https://www.ochaopt.org/sites/default/files/Gaza_Reported_Impact_Snapshot_23_December_2025.pdf] for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) – Reported Impact Snapshot [«10] HRW (2023) [https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza] Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza [«11] Amesty International (2024) [https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/israel-must-end-mass-incommunicado-detention-and-torture-of-palestinians-from-gaza/] Dokumentationen zu Incommunicado-Haft, Folter und Misshandlung palästinensischer Häftlinge [«12] W. Lance Bennett (1990) [https://web.stanford.edu/class/comm1a/readings/bennett-press-state.pdf] Toward a Theory of Press–State Relations in the United States [«13] Pierre Bourdieu (1996) [https://www.raisonsdagir-editions.org/catalogue/sur-la-television/] Sur la télévision Paris: Liber/Raisons d’agir. [«14] Chomsky, N. (2002): Media Control – Wie die Medien uns manipulieren. Hamburg: Europa Verlag. „Auf welche Weise sorgen die nationalen Medien […] mit ihnen zusammenhängende Elemente der elitären intellektuellen Kultur für die Kontrolle der Gedanken? […] ich habe das lebhafte Empfinden, dass die Bürger demokratischer Gesellschaften Unterricht in intellektueller Selbstverteidigung nehmen sollten, um sich vor Manipulation und Kontrolle schützen und substanziellere Formen von Demokratie anstreben zu können.“
Valitse tilauksesi
Rajoitettu tarjous
Premium
Podimon podcastit
Lataa offline-käyttöön
Peru milloin tahansa
2 kuukautta hintaan 1 €
Sitten 7,99 € / kuukausi
Premium
20 tuntia äänikirjoja
Podimon podcastit
Lataa offline-käyttöön
Peru milloin tahansa
30 vrk ilmainen kokeilu
Sitten 9,99 € / kuukausi
Premium
100 tuntia äänikirjoja
Podimon podcastit
Lataa offline-käyttöön
Peru milloin tahansa
30 vrk ilmainen kokeilu
Sitten 19,99 € / kuukausi
2 kuukautta hintaan 1 €. Sitten 7,99 € / kuukausi. Peru milloin tahansa.