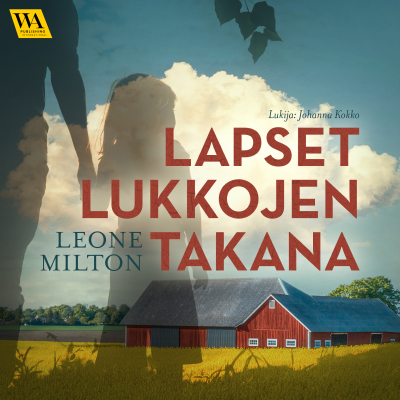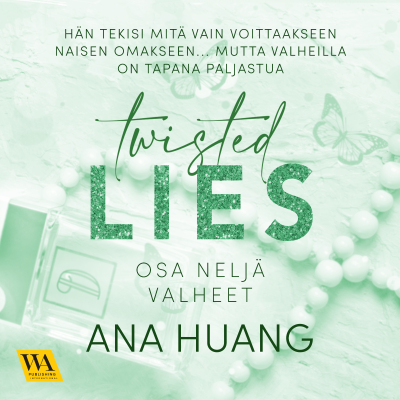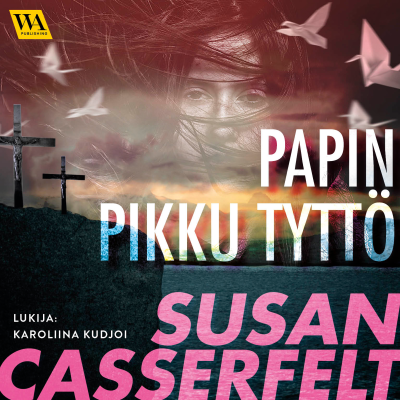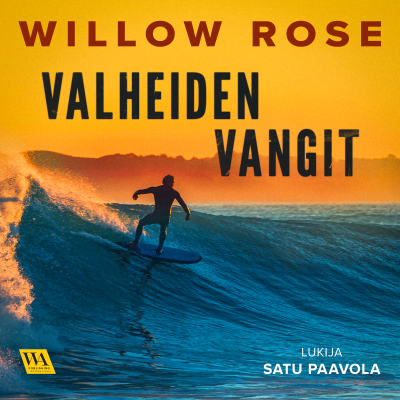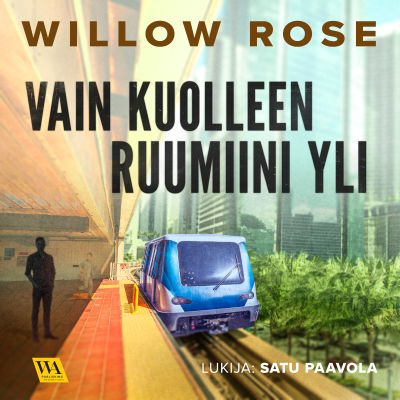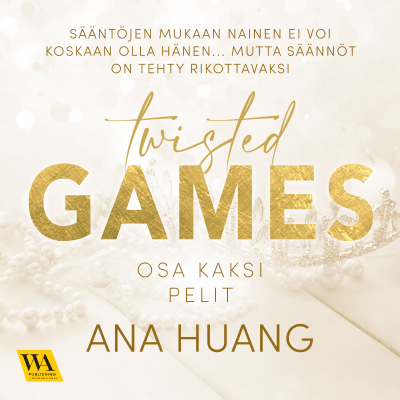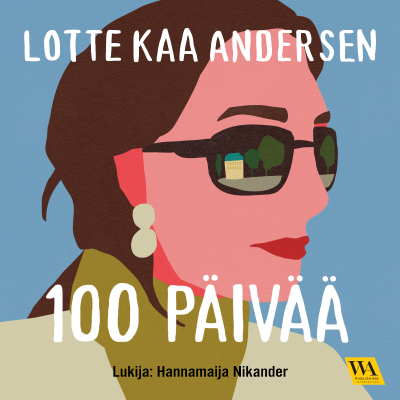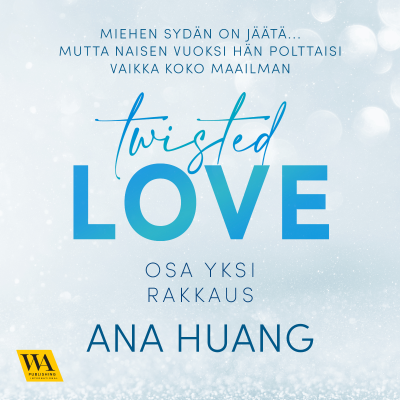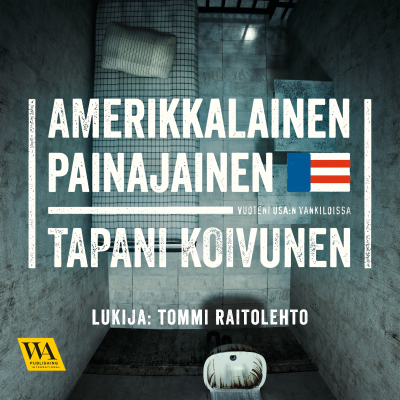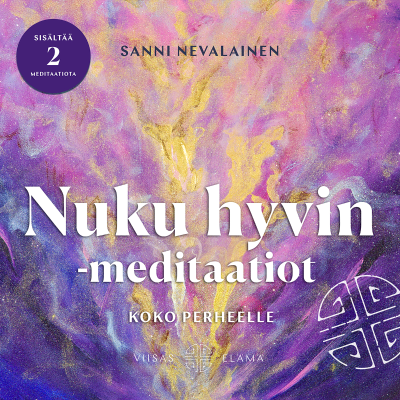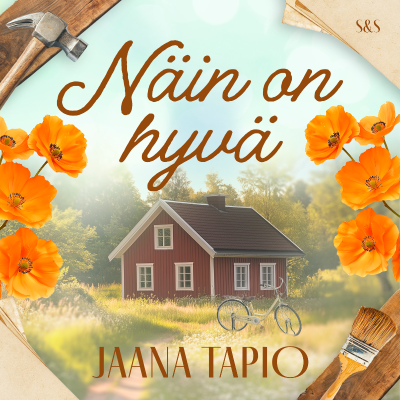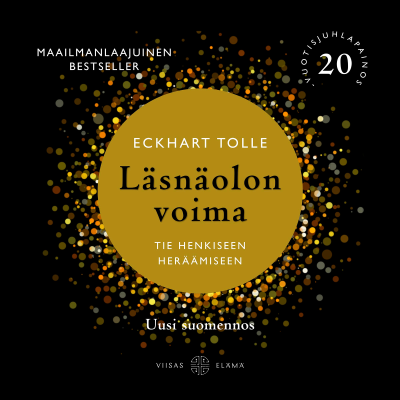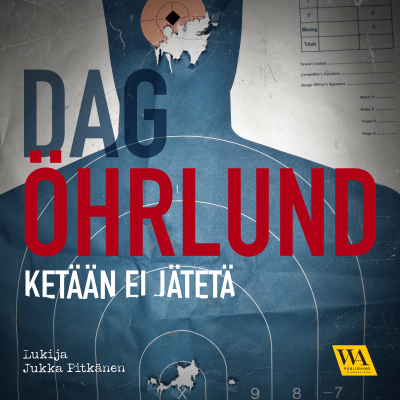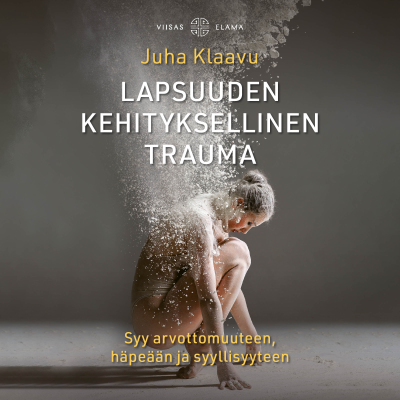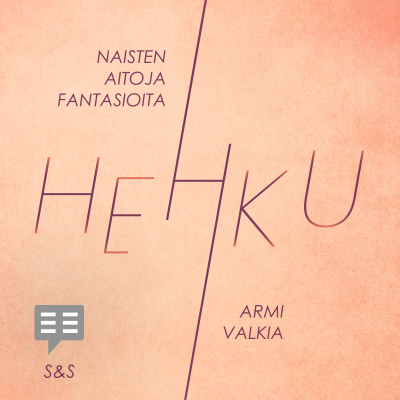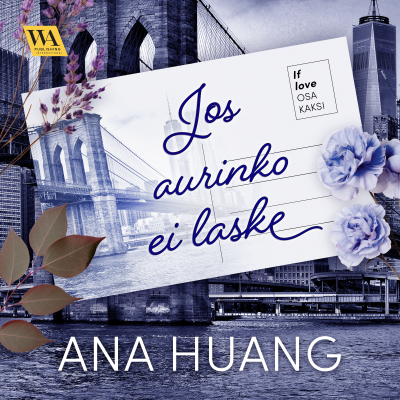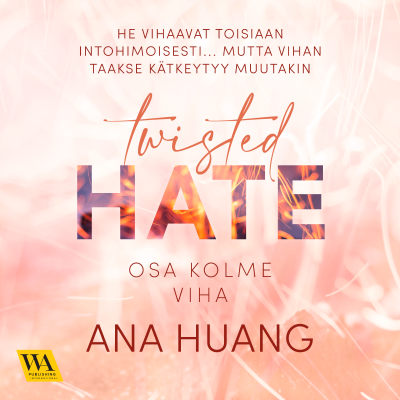SWR3 Report
saksa
Henkilökohtaiset tarinat
Rajoitettu tarjous
1 kuukausi hintaan 1 €
Sitten 7,99 € / kuukausiPeru milloin tahansa.
- Podimon podcastit
- Lataa offline-käyttöön
Lisää SWR3 Report
Die großen, relevanten Themen unserer Zeit aus Gesellschaft, Wissenschaft, Technologie und Kultur. Wir nehmen uns die Zeit ausführlich und ausgeruht zu berichten, sprechen mit Experten, Betroffenen und Zeitzeugen, sind als Reporter live vor Ort und erzählen euch alles, was ihr zum Thema wissen müsst.
Kaikki jaksot
10 jaksotKünstliche Intelligenz: Nutzen und Risiken für uns
SWR3-Reporter Nils Dampz hat sich in Kalifornien umgehört, um herauszufinden, was mit künstlicher Intelligenz heute bereits möglich ist – und wie wichtig der Faktor Mensch heute und in Zukunft sein wird. Mit Abstechern nach Hollywood, in die Musikbranche und ins SWR3-Radiostudio, wo SWR3-Moderator Volker Janitz KI-Tools zum Klonen menschlicher Stimmen im Selbstversuch getestet hat. Wie das klingt, hört ihr in dieser Ausgabe des SWR3-Reports. Was ist an der These dran, dass KI unsere Jobs bedroht? Diese und andere Befürchtungen haben wir mit Experten aus dem Bereich Künstliche Intelligenz für euch gecheckt! * Das KI-Stimmen-Experiment im Radio * EU-Regulierungen: Müssen sich Unternehmen überhaupt an Regeln halten? * 3 KI-Thesen im Check KI-STIMMEN IM RADIO – UNSER GROSSES EXPERIMENT Wir haben es ausprobiert: Eine KI-Stimme moderierte eine Sendung im Radio. Hinter der KI-Stimme versteckt sich Volker Janitz. Im Podcast hört ihr Ausschnitte aus der Sendung. WIE FUNKTIONIERT DAS MIT DER KI-STIMME ÜBERHAUPT? Der SWR3-Moderator hat im Vorfeld bereits Tonaufnahmen an den KI-Experten Michael Katzlberger [https://www.swr3.de/crew/michael-katzlberger-100.html] aus Wien geschickt. Mit Hilfe der Tonaufnahmen wurde das Modell gefüttert und so entstand die KI-Stimme. Doch wirklich leicht ist der Prozess nicht, weiß Michael Katzlberger: „Die Erstellung von KI-generierten Stimmen ist ein mehrstufiger, technisch anspruchsvoller Prozess.“ Gerade die Feinjustierung, also die Betonung einzelner Worte und die Stimmfarbe, mit denen eine Stimme erst natürlich klingt, seien besonders aufwändig. „Es gibt zwar bestimmte Bibliotheken und Frameworks, die einige dieser Prozesse vereinfachen, dennoch bleibt es eine Herausforderung, KI-generierte Stimmen in hoher Qualität zu erstellen, insbesondere auf Deutsch.“ Um Volker und KI-Volker nicht mehr voneinander unterscheiden zu können, gab es einige Hindernisse zu überwinden. Für die bereits angesprochenen Probleme benötigt es vor allem eines: viele Daten! Michael Katzlberger geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren leichter werden wird, KI-Stimmen zu generieren. Die Herausforderung bleibe jedoch, dass KI-Stimmen „die Feinheiten der menschlichen Sprache vollständig“ erfassen. Umso erschreckender, was am Ende dabei zu hören war: Volkers KI-Stimme war kaum noch von der echten Stimme zu unterschieden. Darf man das einfach so oder ist das schon Verbrauchertäuschung? Unser Experiment hat gezeigt, dass es zwar in der Vorbereitung nicht ganz ohne Hindernisse funktioniert, aber das Ergebnis eben doch sehr nah an das Original rankommt. Daher haben wir mit KI-Experten einige Fragen geklärt. WELCHE GEFAHREN GIBT ES BEI DER ENTWICKLUNG VON KI-STIMMEN? Was die Diskussionen um die Entwicklung von KIs der letzten Monate gezeigt haben: KI muss verantwortungsvoll eingesetzt werden. Doch wie kann das geschehen und welche Regulierungen gibt oder braucht es hierfür? Michael Katzlberger spricht sich beispielsweise für eine Kennzeichnung von KI-Stimmen aus: > Ich bin für eine Kennzeichnungspflicht bei Audiospuren und stelle mir das so vor wie den Abspann bei einem Werbespot für Medikamente "Zu Nebenwirkungen fragen sie Ihren Arzt oder Apotheker". Könnte kurz und knapp lauten: ´Für diesen Werbespot wurde KI eingesetzt´. > > > Quelle: Michael Katzlberger, KI-Experte Neben einer Kennzeichnungspflicht von Audiospuren, sieht der Experte es auch für notwendig, dass junge Menschen früh genug mit dem Thema konfrontiert werden: Kai Spriestersbach [https://www.swr3.de/crew/kai-spriestersbach-100.html], Autor des Buches „Richtig Texten mit KI“ beschäftigt sich als Chefredakteur von Search One und Marketing-Experte schon lange mit dem Thema KI. Er sieht, ähnlich wie Katzlberger, eine Notwendigkeit der Regulierung. Allerdings verweist er auch darauf, dass es einige Arten der Regulierung von KI bereits gäbe: „Für die meisten Phänomene im Zusammenhang mit KI gelten bereits existierende Gesetze.“ Zudem sagt er, dass KI nur dann funktioniert, wenn ein Mensch die KI nutzt. Was KI nämlich nicht ist: Eine Intelligenz, die eigenständig Entscheidungen treffen kann. Vielmehr muss sie mit riesigen Datenmengen auf exakt die Anforderungen trainiert werden, die ein Nutzer danach an sie stellt. Dementsprechend müsse dann der Mensch in die Verantwortung gezogen werden. EU ARBEITET AN REGULIERUNG VON KI Die EU arbeitet bereits an Regularien KI-gestützter Programme. SWR3-Hauptstadtkorrespondent Jim-Bob Nickschas berichtet, dass auch die deutsche Regierung sich mit der Thematik beschäftige. Allerdings sei noch keine Antwort auf die Frage gefunden, inwiefern Deutschland auf der einen Seite KI-gestützte Programme regulieren will, auf der anderen Seite aber auch dafür Sorge tragen will, nicht im weltweiten Wettkampf abgehängt zu werden. > Es gibt zwar schon seit Jahren eine milliardenschwere KI-Strategie, um Deutschland für Entwickler attraktiv zu machen – wirklich voran geht die Regierung beim Thema KI aber nicht. > > > Quelle: Jim-Bob Nickschas, SWR3-Hauptstadt-Korrespondent BIRGT KI MEHR GEFAHREN ALS CHANCEN? 3 THESEN IM CHECK! Regularien hin oder her: Seit vielen Wochen und Monaten werden wir fast täglich mit Nachrichten konfrontiert. Fake-News wie die Bilder vom Papst oder Angela Merkel und Barack Obama oder die Meldungen, dass Jobs in Gefahr sind, führen zu Verunsicherung und eventuell auch einer gewissen Genervtheit. Aus diesem Grund haben wir passend zur Podcast-Folge einmal auf die drei Thesen geschaut, die im Moment vermehrt im Umlauf sind und um die Einschätzung derer von Experten gebeten. * KI ist die Zukunft * KI bedroht unsere Jobs * KI lernt KI IST DIE ZUKUNFT Jürgen Geuter [https://www.swr3.de/crew/juergen-geuter-100.html], auch bekannt als „tante“, ist Kritiker des Hypes um das Thema Künstliche Intelligenz. Bei der re:publica, der Konferenz für digitale Gesellschaft, war Jürgen Geuter 2023 zu Gast und hat zu diesem Thema einen Vortrag gehalten und ist auf den Punkt „KI ist die Zukunft“ näher eingegangen. Unsere Werte und Wünsche seien doch nicht irrelevant geworden, nur weil Programme entwickelt wurden, die auf Basis von Künstlicher Intelligenz funktionieren, so Jürgen Geuter. Zudem spricht Geuter noch von einem ganz anderen Problem, das KI im Moment hat und vermutlich auch noch lange haben wird: KI kann nur aus Daten lernen, die bereits digitalisiert wurden. Das heißt, der Blick in Länder, in denen die digitale Landschaft noch nicht so weit ist, wird durch die KI noch weiter in den Hintergrund gerückt. Für Geuter ist daher der Satz „KI ist die Zukunft“ und das, was hinter dem Satz steckt, äußerst problematisch. Wenn wir von KI sprechen und damit von Intelligenz, dann „sprechen wir einem technischen System Agency und Autonomie zu“. Wir machen aus einem Programm oder einer Technologie etwas Menschliches, was es jedoch nicht ist. KI BEDROHT UNSERE JOBS Thomas Bornheim [https://www.swr3.de/crew/thomas-bornheim-102.html], Geschäftsführer von 42 Heilbronn und ehemaliger Google-Mitarbeiter, ergänzt den Satz um folgenden Nebensatz: „und schafft neue Jobs“. Klar sei, dass nicht jeder Job genau so bleibt wie er jetzt ist, sondern es zu Entwicklungen kommen wird. Doch diese Entwicklung als Bedrohung anzusehen, gehe ihm zu weit. > Es wird für manche anstrengend, für manche ergeben sich neue Chancen. Das ist gerade in so einer überalterten Kultur wie unserer gar nicht schlecht. > > > Quelle: Thomas Bornheim, Experte für Künstliche Intelligenz Auch mit Blick auf die Geschichte sei festzustellen, dass Änderungen meist drastisch ausgefallen sind und wir heute davon profitieren. Schaue man auf die Entwicklungen der Automobil-Industrie oder die Elektronisierungs-Welle Ende der 1970er Jahre, stelle man fest, so Bornheim, dass diese Entwicklungen sicher auch für Unmut und Angst gesorgt haben. Mittlerweile seien sie fast vergessen, so Bornheim. Die Herausforderung bestehe vor allem darin, einzelne Gruppen der Gesellschaft nicht zu vergessen. Alle sollten mitgenommen werden – das sei eine Herausforderung für die Regierung. Es ergeben sich jedoch auch ganz neue Formen von Jobs, die es ohne KI nicht geben würde. So wie das Stuttgarter Unternehmen unter Agalya Jebens. Ihr Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, mit Hilfe von KI Lernprogramme zu entwickeln oder experimentelle Kunst-Installtionen zum Leben zu erwecken. KI LERNT > Klingt gut. Macht unsichtbar, wie viele Menschen im Süden der Welt anfangen müssen, für Hungerlöhne unsere Programme zu trainieren und den ganzen Rassismus rauszufiltern. > > > Quelle: Jürgen Geuter im Vortrag auf der re:publica 2023 Das heißt: Ja, KI kann schnell lernen, allerdings muss auch jemand die KI befüttern und ihr erklären, was sinnvolle Schlussfolgerungen aus den Datenmengen sind. Dann geht es, auch laut Thomas Bornheim, recht schnell, dass die Programme mehr und mehr verstehen und anwenden können. „Nun geht es darum, dass wir Menschen die Vereinfachungen erlernen und zulassen.“ Ob Künstliche Intelligenz Gefahr oder Chance darstellt, ist abschließend nicht eindeutig zu sagen. Es gibt sowohl positive Beispiele für den Einsatz von KI als auch negative Beispiele. Die Menschen, die KI einsetzen, sollten verantwortungsvoll damit umgehen und Regularien sollten geschaffen werden – so der Tenor der KI-Experten.
2035 – wie wir in Zukunft leben werden
In den letzten drei Jahren ist viel passiert: erst die Corona-Pandemie, dann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und jetzt die Inflation. Für unsere Zukunft muss es doch auch gute Nachrichten geben. Wir entwickeln uns technisch ja ständig weiter – oder? Das hat sich SWR3-Reporterin Franziska Ehrenfeld gefragt und nach Antworten gesucht. Das sind die Themen, die wir uns näher angeschaut haben: * Bauen und Wohnen * Pflege * Daten * Autonomes Fahren und ÖPNV * Ernährung * Energie und Klima KAUM VERÄNDERUNG BEIM BAUEN UND WOHNEN Die Immobilienpreise sind hoch und jetzt steigen auch noch die Zinssätze für Kredite. Für einige Menschen bedeutet das: Ciao, Traum vom Eigenheim. 2017 hatte der Immobilienexperte Peter Hettenbach noch vorausgesagt, dass der Quadratmeterpreis in einigen Jahren für die Kaltmiete auch in Ballungsräumen bei nur fünf bis sechs Euro liegen könnte. Heute rudert er stark zurück. Es werde zwar Fortschritte in der Baubranche geben, zum Beispiel durch 3D-Drucker, die ganze Häuser oder zumindest einzelne Mauern effizienter hochziehen können. Allerdings sieht Peter Hettenbach die Zukunft generell nicht im Neubau, sondern im Bestand. Bereits existierende Gebäude müssten besser genutzt werden. Und wer sich sein Haus selbst herrichtet, könne sich das auch eher leisten. > Mit dem Krisenmodus, in dem wir sind, glaube ich, dass die Welt in zehn Jahren noch ziemlich genauso aussehen wird wie heute. > > > Quelle: Dr. Peter Hettenbach, Immobilienexperte ZUKUNFT DER PFLEGE: UNTERSTÜTZUNG DURCH ROBOTER Auch im Bereich Pflege wird es zwar technische Neuerungen geben, eine Pflegekraft werden Roboter aber auf absehbare Zeit nicht ersetzen können. Wenn Seniorinnen und Senioren nur noch technische Geräte zu Gesicht bekommen würden, wäre das natürlich ein sehr einsames Leben. Außerdem müssen auch Roboter bedient und gewartet werden. Laut der Soziologin Cordula Kropp wird es in Zukunft aber einige technische Hilfsmittel geben, die alten Menschen und ihren Pflegenden das Leben erleichtern können. > Der Roboter ist zuverlässig im Abzählen von Medikamenten. Der kann das Aussortieren, der kann das zeitgerecht anbieten. (...) Er kann auch Unterhaltungen anbieten, also Spiele, kleine Rätsel, die dann auch angepasst sind an die Vorstellungen der zu Pflegenden und auch an ihre kognitiven Leistungen. > > > Quelle: Prof. Dr. Cordula Kropp – Soziologin, Universität Stuttgart Auch Entwicklungen im Bereich „Smart Home“ werden für Erleichterung sorgen, zum Beispiel Putzroboter. Außerdem könnten Sensoren überwachen, ob Senioren aus ihrem Bett fallen, auf der Treppe stürzen und – im Fall von Bewegungsdrang im Zusammenhang mit Demenz – sogar die Haustür abriegeln. Solche Formen der Überwachung sieht Cordula Kropp aber auch kritisch. Für die Verwendung solcher Systeme würden enorm viele, sensible Daten anfallen. GELD FÜR DATEN? Laut dem Zukunftsforscher Eike Wenzel ist das Generieren von Daten unabdingbar. Vertrauenswürdige Institutionen sollten personenbezogene Daten für sich nutzen können, fordert er. Internet-Giganten wie Facebook sollten dagegen nicht mehr ohne Weiteres von unseren Daten profitieren. Eike Wenzel ist das Meinung, wir sollten dafür Geld bekommen: > Es wird neue Produkte geben, die unsere Daten unbedingt brauchen. (…) Dafür müssen wir entlohnt werden und das ist durchaus möglich. > > > Quelle: Dr. Eike Wenzel, Zukunftsforscher Viele Entwicklungen, die wir in Zukunft für uns nutzen können, basieren laut Eike Wenzel auf dem Sammeln von Daten. Um in Bereichen wie dem autonomen Fahren weiterzukommen, sieht er keinen Weg daran vorbei. SO WEIT SIND WIR 2035 BEIM AUTONOMEN FAHREN Das autonome, also selbstständige Fahren von Fahrzeugen wie Autos aber auch Bussen wird im Moment stetig weiterentwickelt – zum Beispiel von Daniel Grimm. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Informatik (FZI) in Karlsruhe und promoviert zu diesem Thema. Im Viertel Weiherfeld-Dammerstock erprobt er einen autonomen Mini-Shuttlebus schon jetzt im öffentlichen Verkehr. Er rechnet damit, dass solche Fahrzeuge bis 2040 standardmäßig unterwegs sein könnten. Bezogen auf den Individualverkehr schätzt er, dass autonome Autos dann zumindest auf der Autobahn schon komplett selbstständig fahren können. In einigen Jahrzehnten werden Autos dann wahrscheinlich keine Lenkräder und Pedale mehr haben, meint Daniel Grimm. Die Sitze sind dann einander zugewandt und wir können während der Fahrt arbeiten, Filme schauen oder schlafen. Eike Wenzel sieht in solchen Fahrzeugen außerdem den Vorteil, dass autonome Fahrzeug selbstständig Menschen abholen können. Wir brauchen dann also vielleicht kein eigenes Auto mehr, sondern fordern eines an, wenn wir es brauchen. Das Auto fährt uns zum Ziel und wenn wir fertig sind, holt uns ein anderes ab. Dann kann ein einzelnes Fahrzeug viel öfter genutzt werden und benötigt weniger Parkfläche – was Umwelt und Klima zugute kommt. > Wir müssen den Privatbesitz an Automobilität abgeben. Natürlich von heute aus gesehen ein Irrwitz, aber ich glaube, es ist möglich. > > > Quelle: Dr. Eike Wenzel, Zukunftsforscher Außerdem könnte es zu ungünstigen Zeit wie nachts vor allem auf dem Land ein besseres Verkehrsangebot geben, weil keine Fahrerinnen und Fahrer mehr gebraucht werden. DIE ZUKUNFT DES ÖPNVS AUF DEM LAND Auch die „Öffis“-App könnte den ÖPNV auf dem Land revolutionieren: In einer einzigen App sollen in Zukunft alle Verkehrsmittel vereint werden. Neben Bussen, Bahnen, Leihfahrrädern, E-Scootern, Taxis und Carsharing sollen auch Privatpersonen ihre Routen eintragen und für Mitfahrer anbieten können. Bisher wird das nur für einzelne Firmen angeboten. Ab 2023 werden laut Gründer Daniel Teigland aber auch erste Landkreise in das System einsteigen. Das Ziel der Entwickler ist es, auch im ländlichen Raum einen Zehn-Minuten-Takt hinzubekommen. Außerdem arbeiten sie an Fahrradrouten – also daran, dass die App fürs Fahrrad optimierte Routen vorschlägt und navigiert. ERNÄHRUNG 2035: ALGEN, INSEKTEN UND LABORFLEISCH Neben dem Verzicht aufs eigene Auto können wir auch mit unserer Ernährung die Klimaerwärmung erheblich beeinflussen. Wir Deutschen essen im Durchschnitt immer noch mehr als ein Kilogramm Fleisch pro Woche. Das verbraucht viel Energie und Land – nicht nur für die Tierhaltung, sondern vor allem für den Futteranbau. Außerdem stoßen Kühe klimaschädliches Methan aus. Unter dem Strich ist Fleisch essen also schlecht fürs Klima. Trotzdem brauchen wir aber Proteine. Die sind nahrhaft und wir essen von ihnen tendenziell zu wenig. Sie sind ein wichtiger Faktor, um die wachsende Weltbevölkerung nachhaltig ernähren zu können. Wie wir das schaffen können, daran forscht die Ernährungswissenschaftlerin Sonja Floto-Stammen. Für die Zukunft sieht sie allerlei Neuheiten in den Supermarktregalen: Laut ihr wird es künftig zum Beispiel Produkte auf Algen- und Insektenbasis geben. Insekten verbrauchen weniger Ressourcen als andere Nutztiere, sie können sich von Abfällen ernähren. Aber das ist noch nicht alles: > Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Europa auch Laborfleisch in Zukunft – also bis 2035 ganz sicher – haben werden. > > > Quelle: Dr. Sonja Floto-Stammen, Ernährungswissenschaftlerin Laborfleisch basiert auf Stammzellen, die einem Tier operativ entnommen werden. Das Tier kann weiterleben und die Zellen werden im Labor vermehrt und später zu Fleisch geformt. Außerdem verbraucht die Laborfleisch-Produktion wahrscheinlich deutlich weniger Fläche als Tierhaltung. Ob die Herstellung von Laborfleisch auch weniger Energie verbraucht und Treibhausgase ausstößt, wird oft als weiterer Pluspunkt angeführt, ist aber umstritten. 2020 wurde Laborfleisch in Singapur erstmals zugelassen. EIN NEUES ENERGIESYSTEM FÜR EIN BESSERES KLIMA Laut Eike Wenzel liegt die Zukunft unseres Energiesystems in der Elektrifizierung. Wir müssen mehr nachhaltigen Strom produzieren, dann könnten wir damit sogar heizen, sagt er. Verbrennen sollten wir möglichst nichts mehr, auch kein Holz. Stattdessen sollten wir daraus nachhaltige Häuser bauen, fordert der Zukunftsforscher. Außerdem sieht Eike Wenzel Potenzial in der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Also dass wir Geräte und darin verbaute Rohstoffe möglichst oft wiederverwenden, recyclen oder sogar upcyclen. WIE WIRD ALSO UNSER LEBEN 2035? Es gibt einiges, auf das wir uns jetzt schon freuen können. Aber es gibt auch viel zu tun – nicht nur für den Klimaschutz. Wie 2035 wirklich wird, kann niemand sicher wissen. Eike Wenzel fasst es so zusammen: > Wir müssen jetzt akut in den nächsten zehn Jahren handeln, das wissen wir. (...) Wenn wir das schaffen, bin ich eher positiv gestimmt. > > > Quelle: Dr. Eike Wenzel, Zukunftsforscher
Wir – was unsere Gesellschaft zusammenhält
Gibt es in unserer Gesellschaft noch ein „Wir“? Oder driften wir immer weiter auseinander? Und wenn es noch ein „Wir“ gibt – was hält uns dann zusammen? Wir wollten wissen: Wo ist das „Wir“ in SWR3Land, wo halten wir zusammen? Dafür waren unsere Kollegen Saskia Wöhler, Josh Kochhann und Janine Beck unterwegs. Ein Mann, der eine ganz besondere Rolle dabei spielt, ist Sänger Mark Forster. Der hat den Soundtrack Memories & Stories für die Themenwoche geschrieben. Für ihn hat Zusammenhalt in der Gesellschaft etwas mit gesellschaftlichem Konsens zu tun. > Ich glaube, wir einigen uns als Gemeinschaft auf ‚das ist korrekt und das nicht nicht korrekt‘, auf der Basis können wir diskutieren und uns streiten. Dieser Konsens entsteht wahrscheinlich durch ein bisschen Reflexion, wahrscheinlich auch durch Mitgefühl und am Ende durch sowas wie Liebe. Und wenn wir nicht ganz verrückt sind, einigen wir uns auf eine Grundlage und auf der setzen wir uns auseinander. Und daraus entsteht wahrscheinlich ein ‚Wir‘. > > > Quelle: Mark Forster, Sänger DIE ID-MANNSCHAFT VON DARMSTADT 98 Ein Fußballverein für alle – auch für Menschen mit geistigem oder körperlichem Handicap. Den gibt es seit eineinhalb Jahren beim Bundesligaverein Darmstadt 98: In der sogenannten ID-Mannschaft spielen Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zusammen Fußball – und das mega erfolgreich. Das Team spielt mittlerweile bundesweit Turniere, war zum Beispiel bei den Special Olympics in Berlin und ist in diesem Jahr ID-Hessenmeister geworden. Wie krass das zusammenschweißt, hat SWR3 Reporterin Saskia Wöhler sich angeschaut: Sie hat die ID-Mannschaft beim Training begleitet – und unter den Spielern ein ganz besonderes „Wir“-Gefühl erlebt. BEWOHNER VON EGGENTHAL ERÖFFNEN IHREN EIGENEN DORFLADEN Eggenthal ist ein Dorf, wo das „Wir“ ganz groß ist. Seit einem Jahr hat der kleine Dorfladen geschlossen und auch der einzige Dorfgasthof hat kürzlich zu gemacht. Kein Problem für die 1.300 Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner: Sie haben ihren eigenen Dorfladen mit angeschlossenem Bistro eröffnet. SWR3-Reporter Josh Kochhann hat die Bewohner gefragt, welchen Stellenwert der Laden für sie hat. WOHNPROJEKT IN BAD DÜRKHEIM: BEWUSST IN EINER GEMEINSCHAFT LEBEN Das „Wir“ jeden Tag in einer Gemeinschaft leben – dazu haben sich knapp 70 Bewohner im Alter von einem bis 83 Jahren in Bad Dürkheim entschieden. Ihr generationsübergreifendes Wohnprojekt verteilt sich auf 41 Wohnungen und ging vor einem Jahr an den Start. SWR3-Reporterin Jessi Schnellbach war vor Ort und hat ein ganz besonderes Zusammenleben zwischen den Bewohnern kennengelernt. COACH FÜR ZUSAMMENHALT Das „Wir“ wird auch beim Sport großgeschrieben, gerade als Team. Birte Janson des Basketballvereins USC Eisvögel in Freiburg ist das besonders wichtig - sie ist nicht nur Trainerin für junge Mädchen, sondern auch Coach für Zusammenhalt. Dafür hat sie eine 12-monatige Ausbildung beim Württembergischen Landessportbund gemacht. SWR3-Reporterin Janine Beck war bei ihrem Training der 10- bis 12-Jährigen dabei. DAS „WIR“-GEFÜHL IN DEN HOCHWASSERGEBIETEN Mit das größte „Wir“-Gefühl gab es letztes Jahr im Sommer vermutlich in den betroffenen Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz. Da sind Monate lang Tausende Helfer hin und haben mit angepackt, haben teilweise ihren Urlaub und ihre Wochenenden da verbracht. Und auch jetzt noch wird Hilfe gebraucht. SWR3-Reporterin Janine Beck war auf einer Baustelle in Kreuzberg-Altenahr.
K-Pop: Was steckt hinter dem Musik-Phänomen?
Entstanden in den Neunzigern, ist K-Pop heute bedeutend mehr als nur Pop-Musik mit koreanischen Texten. Es gibt unzählige K-Pop-Bands und eine mächtige weltweite Fan-Community. K-Pop ist Lebenseinstellung und Philosophie, ein riesiges Geschäft. Benedikt Wiehle und Rebecca Rodrian aus der SWR3-Redaktion nehmen das Genre unter die Lupe und beleuchten Bands und ihre Entstehung. Sie berichten über die engagierten Fans, über politische Aspekte und auch die Kritik am System der Talentagenturen mit ihrem Leistungsdruck, den Schönheitsidealen und Beziehungsverboten.
Legaler Rausch – wann wird Cannabis erlaubt?
BESITZ UND VERKAUF VON CANNABIS SOLLEN LEGALISIERT WERDEN Die Bundesregierung, bestehend aus der SPD, den Grünen und der FDP, will Cannabis legalisieren und hat damit für viel Aufregung bei Befürwortern und Gegnern gesorgt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte die aktuelle Umgehensweise mit Cannabis für gescheitert. Laut seiner Aussage schwanke die Qualität des Cannabis, der Konsum bei Jugendlichen sei aber nicht zurückgegangen. Warum dauert die versprochene Legalisierung jetzt aber doch so lange? Und was sind eigentlich die Gründe beider Seiten? Im neuen SWR3-Report „Legaler Rausch“ gehen die SWR3-Hauptstadtkorrespondenten Christopher Jähnert und Jim-Bob Nickschas diesen Fragen nach. Sie sprechen mit Befürwortern und Gegnern der Cannabis-Legalisierung, lassen Argumente wissenschaftlich einordnen und hören sich Erfahrungen aus anderen Ländern an. „Wenn man hier durch Berlin läuft, riecht es ja sowieso an vielen Ecken nach Gras“, stellt Jim-Bob Nickschas zu Beginn der Folge fest. Diesen Eindruck teilt auch Christopher Jähnert: > Manchmal könnte man sich fast schon denken, dass Kiffen schon lange legal ist. Ist es aber gar nicht. Also der Konsum an sich ist nicht verboten – aber der Besitz und der Verkauf. BESSERE CANNABIS-QUALITÄT DURCH DIE LEGALISIERUNG Einer der Beweggründe für die Legalisierungspläne: Weniger Risiko wegen schlechter Qualität. Die Regierung habe den Plan, die Gesetze an die Realität anzupassen, erklärt Jim-Bob Nickschas. Trotz Cannabis-Verbot steige nämlich die Zahl der Konsumenten. „Indem Gras dann ganz legal gekauft werden kann, [...] soll auch die Qualität besser kontrolliert werden, weil man auf der Straße eben nicht immer genau weiß: Was für ein Zeug bekomme ich da eigentlich, was ist da drin?“, ergänzt Christopher Jähnert. MEDIZINISCHE FOLGEN DES CANNABIS-KONSUMS Bei einer Cannabis-Legalisierung spielen auch medizinische Argumente eine Rolle. Davon erzählt Linus Neumeier im SWR3-Report. Er hatte nach seinem Cannabis-Konsum mit psychischen Problemen zu kämpfen. Eva Hoch beschäftigt sich mit dem Thema seit Jahren an der Uniklinik München und ordnet die Gefahr des Konsums ein: > Man würde sagen, Cannabis ist ein Trigger. Ein Drittel der Bevölkerung hat die Veranlagung für eine Psychose und wer weitere Stressoren in seinem Leben hat, ist anfälliger dafür, bei Cannabis-Konsum eine Psychose zu entwickeln. Viele wollen ihre Symptome damit lindern, ihre Probleme lösen – das ist möglicherweise dann der Einstieg in eine Abhängigkeit, wie auch bei Alkohol oder anderen Substanzen. > > > Quelle: Eva Hoch, Uniklinik München STEUERERSPARNIS UND ZUSÄTZLICHE EINNAHMEN DURCH CANNABIS-LEGALISIERUNG Argumente, die unter anderem Hubert Wimber, Polizeipräsident a. D. überzeugen: Durch die Legalisierung von Cannabis würden Steuern gespart und zusätzliche Einnahmen geschaffen werden, weil Gerichte und die Polizei entlastet wären. Satte 1,4 Milliarden Euro könnten so gespart werden. Das wurde in einer Studie der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf [https://www.dice.hhu.de/news/studie-cannabislegalisierung-bringt-dem-staat-jaehrlich-47-milliarden-euro-rund-27000-legale-arbeitsplaetze-wuerden-entstehen-1] festgestellt. > Alles in allem zusammengerechnet mit anderen Effekten wie Arbeitsplätzen und so weiter könnte der Staat mit 5 Milliarden Euro Plus aus der Nummer rauskommen – jedes Jahr. Und auch das wird natürlich mitdiskutiert, wenn es um die Legalisierung geht. > > > Quelle: Jim-Bob Nickschas im SWR3-Report Torsten Zelgert war wegen seines Konsums bereits im Gefängnis und hilft mittlerweile anderen Betroffenen. Er glaubt, dass sich Betroffene tendenziell eher Hilfe holen würden, wenn der Cannabis-Konsum nicht mehr unter Strafe stünde. LEGALISIERUNG NICHT SO SCHNELL WIE GEPLANT Warum der Weg bis zur Legalisierung trotz des Vorhabens der Bundesregierung noch länger dauern könnte, wissen Burkhard Blienert, Bundesdrogenbeauftragter, und SPD-Politikerin Carmen Wegge. Das sei vor allem eine Folge des Jugendschutzes. > Wir haben im Verkehrsrecht natürlich Regelungen zu treffen, es geht um die Lieferketten, deshalb sind auch fast alle Ministerien beteiligt. Und darauf baut sich letztendlich auch nochmal die europa- und völkerrechtliche Frage auf. > > > Quelle: Burkhard Blienert, Bundesdrogenbeauftragter Eine Prognose, wann es so weit sein könnte, möchte Blienert nicht abgeben. Neben Blienerts Argument sieht Carmen Wegge aber noch ein weiteres zeitliches Hindernis: > Wir haben die UN Single Convention on Narcotic drugs, die uns theoretisch die Legalisierung verbietet. Da müssen wir austreten, das kann man nur einmal im Jahr machen, das nächste Austrittsdatum ist für uns der 1.1.2024. Dann haben wir einen EU-Rahmenbeschluss, bei dem auch noch die Frage ist, welche Auswirkungen der auf unsere Legalisierung hat. Und dann brauchen wir selbstverständlich auch noch die Zustimmung des Bundesrats. > > > Quelle: Carmen Wegge, SPD-Politikerin
Valitse tilauksesi
Rajoitettu tarjous
Premium
Podimon podcastit
Lataa offline-käyttöön
Peru milloin tahansa
1 kuukausi hintaan 1 €
Sitten 7,99 € / kuukausi
Premium
20 tuntia äänikirjoja
Podimon podcastit
Lataa offline-käyttöön
Peru milloin tahansa
30 vrk ilmainen kokeilu
Sitten 9,99 € / month
Premium
100 tuntia äänikirjoja
Podimon podcastit
Lataa offline-käyttöön
Peru milloin tahansa
30 vrk ilmainen kokeilu
Sitten 19,99 € / month
1 kuukausi hintaan 1 €. Sitten 7,99 € / kuukausi. Peru milloin tahansa.