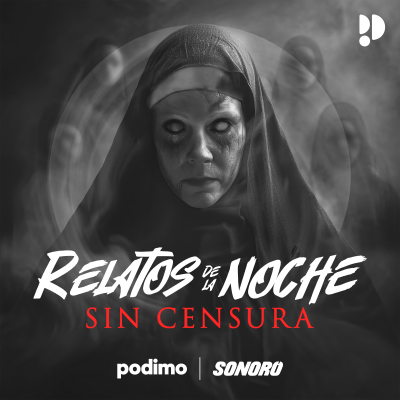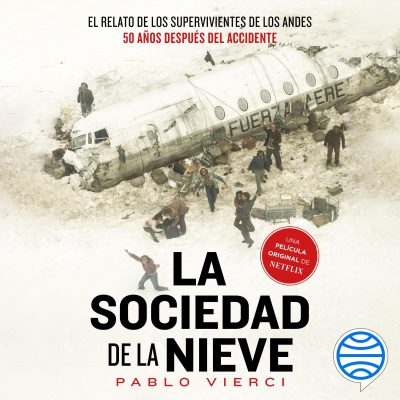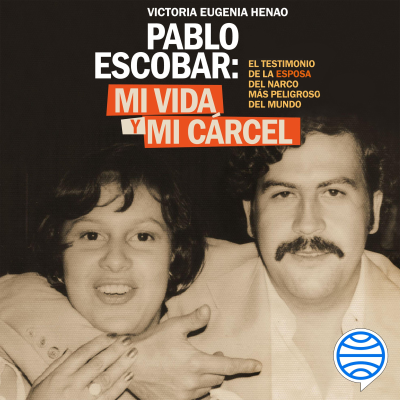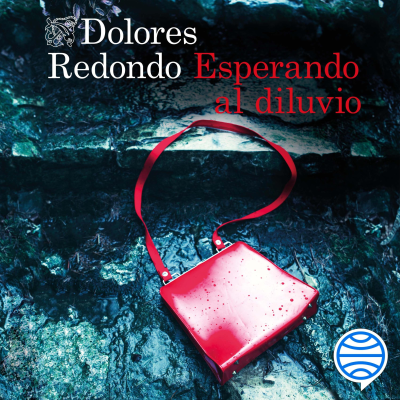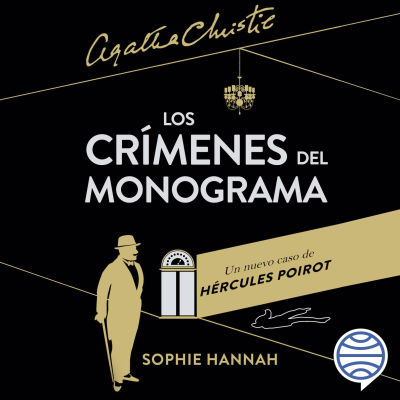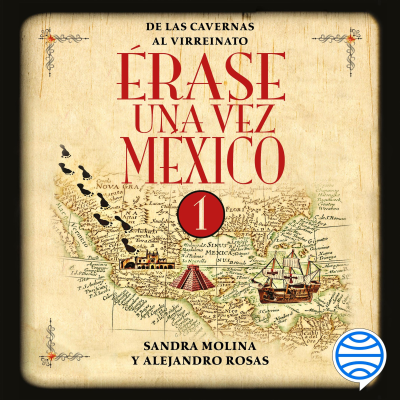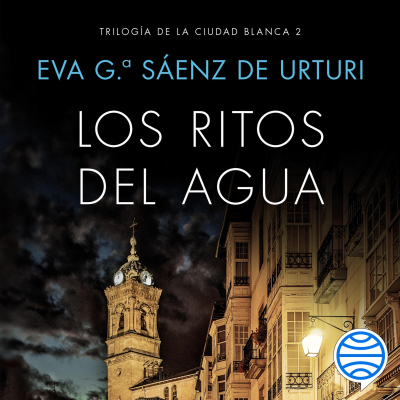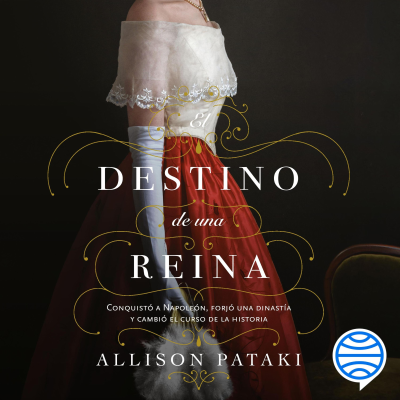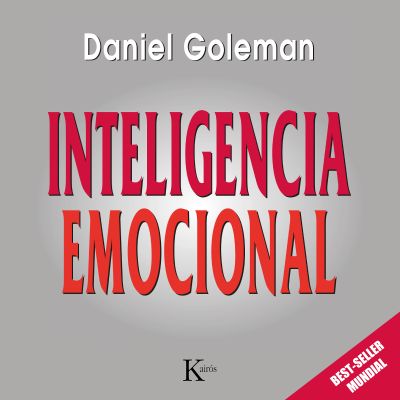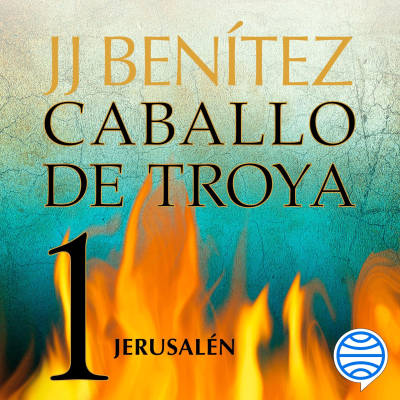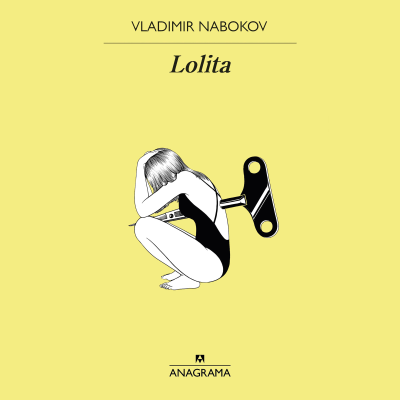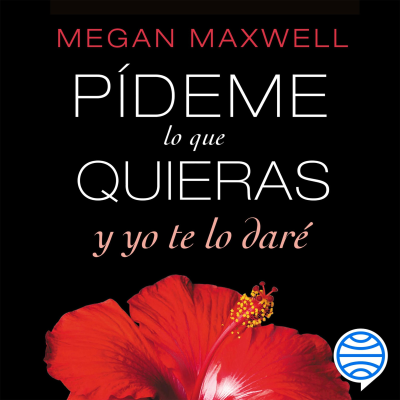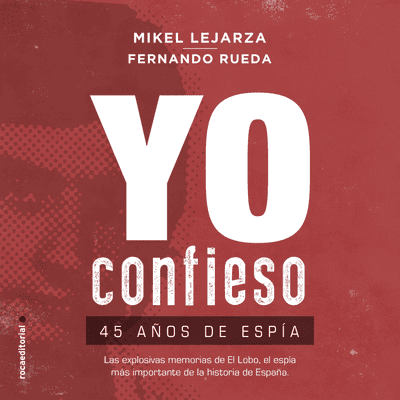Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konflikt-Coaching und Organisationsberatung.
alemán
Negocios
Empieza 7 días de prueba
$99 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
- 20 horas de audiolibros al mes
- Podcasts solo en Podimo
- Podcast gratuitos
Acerca de Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konflikt-Coaching und Organisationsberatung.
Ich bin Sascha Weigel und möchte Sie in diesem Podcast gemeinsam mit meinen Gästen mit spannenden Sichtweisen und Einschätzungen rund um die Themengebiete Mediation, Konflikt-Coaching und Organisationsberatung zum Nachdenken anregen. Wir hegen die Absicht, dass Sie hier durchaus die zündende Idee oder bei Bedarf einen neuen Lösungsansatz für ihre Problem- oder Konfliktsituation entwickeln können. Zu Wort werden in diesem Podcast auch Fachexperten kommen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Forschungsergebnisse wichtige Erkenntnisse für den Umgang mit Konflikten und damit für die Mediation und Konfliktberatung in der VUKA-Welt bieten. Mehr zu Mediation und Konfliktmanagement: www.inkovema.de
Todos los episodios
250 episodios#250 GddZ - Kinder in der Mediation. Im Gespräch mit Swetlana von Bismarck
Die Vorbereitung auf die Mediation ist entscheidend für den Erfolg. ZUSAMMENFASSUNG In diesem Podcast diskutieren Sascha Weigel und Swetlana von Bismarck die Rolle von Kindern in der Mediation, insbesondere in Fällen von Trennung und Scheidung. Swetlana, eine erfahrene Familienmediatorin, erklärt, wie wichtig es ist, Kinder in den Mediationsprozess einzubeziehen, um ihre Perspektiven und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Sie spricht über die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Einbindung von Kindern ergeben, und betont die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung und einer respektvollen Haltung gegenüber den Kindern. Der Podcast beleuchtet auch die Unterschiede zwischen minderjährigen und erwachsenen Kindern in der Mediation sowie die Bedeutung von Freiwilligkeit und Vertraulichkeit. TAKEAWAYS * Die Rolle der Kinder in der Mediation ist entscheidend. * Minderjährige Kinder können echte Beteiligte sein. * Die emotionale Intelligenz von Kindern ist oft höher als die von Erwachsenen. * Freiwilligkeit und Vertraulichkeit sind zentrale Aspekte der Mediation mit Kindern. * Die Vorbereitung auf die Mediation ist entscheidend für den Erfolg. * Eltern müssen auf einer Elternebene kommunizieren, bevor Kinder einbezogen werden. * Die Einbindung von Kindern kann die Konfliktdynamik positiv beeinflussen. * Es ist wichtig, die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder zu respektieren. * Mediation sollte als normales Verfahren betrachtet werden, nicht als Ausnahme. * Die Mediatoren müssen eine respektvolle Haltung gegenüber den Kindern haben. KAPITEL: 00:00 Einführung in die Mediation und Familienkonflikte 02:54 Die Rolle der Mediatorin und ihre Erfahrungen 04:46 Familie und ihre Bedeutung in Konflikten 06:57 Kinder in der Mediation: Abgrenzung und Einbeziehung 08:46 Minderjährige Kinder als Beteiligte in der Mediation 09:50 Emotionale Intelligenz von Kindern in Konflikten 11:38 Nestmodell und Kinderbeteiligung 13:35 Freiwilligkeit und Vertraulichkeit in der Mediation 14:52 Kriterien für die Einbeziehung von Kindern 17:57 Rollenveränderung und Stabilität der Eltern 21:23 Konfliktdynamik und Themen in der Mediation 23:17 Erziehungskonflikte und Paarkonflikte 25:31 Auswirkungen der Volljährigkeit auf die Mediation 26:17 Integration von Kindern in die Mediation 28:41 Herausforderungen und Chancen der Kindermediation 33:24 Vorbereitung auf die Mediation mit Kindern 36:29 Verpflichtende Mediation und ihre Auswirkungen 41:15 Normalisierung von Trennungen und Scheidungen GÄSTIN: SWETLANA VON BISMARCK: Juristin, lizenzierte Familienmediatorin (BAFM) und Gründerin der Mediationspraxis Familienkokon in Berlin. Sie arbeitet als Mediatorin, Verfahrensbeiständin und Supervisorin und begleitet seit vielen Jahren Familien in hochsensiblen Konflikt- und Veränderungsprozessen.
#249 GddZ - Konflikte verstehen und bearbeiten. Im Gespräch mit Kirsten Schroeter
Publikation: Adrian, Linn / Schroeter, Kirsten: Konflikte verstehen und bearbeiten. Fachübergreifende Grundlagen für Studium und Praxis. 1. Auflage, Leverkusen 2025. ZUSAMMENFASSUNG In dieser Episode des Podcasts "Gut durch die Zeit" diskutieren Sascha Weigel und Kirsten Schroeter über das Thema Konflikte und deren Bearbeitung. Sie beleuchten die verschiedenen Facetten von Konflikten, die Bedeutung von Mediation und Konfliktberatung sowie die Herausforderungen, die bei der Bearbeitung von Konflikten auftreten können. Kirsten teilt ihre Erfahrungen aus der Praxis und gibt Einblicke in ihr neues Buch "Konflikte verstehen und bearbeiten", das verschiedene Perspektiven und Ansätze zur Konfliktlösung bietet. Die Diskussion umfasst auch die Rolle von Macht in Konflikten und die Notwendigkeit, unterschiedliche Sichtweisen zu berücksichtigen. KAPITEL Chapters 00:00 Einführung in Konflikte und Mediation 02:59 Das Buch über Konflikte verstehen und bearbeiten 05:51 Die Entstehungsgeschichte des Buches 08:45 Vielfalt der Konfliktliteratur 11:42 Typische Konfliktsituationen in der Praxis 14:25 Besondere Herausforderungen in Wohnprojekten 14:38 Vielfalt der Konfliktbearbeitung 16:37 Der Ansatz zur Konfliktklärung 19:40 Entscheidungsfindung in Konfliktsituationen 25:45 Probleme und Konflikte verstehen 27:41 Konfliktberatung und Mediation 31:44 Perspektiven und Ansätze in der Konfliktbearbeitung 35:39 Literatur und Ressourcen für Mediatoren TAKEAWAYS Takeaways * Konflikte sind eine normale Erscheinung im Leben. * Mediation ist ein Prozess, der Verständnis und Bearbeitung von Konflikten fördert. * Die Vielfalt an Perspektiven ist entscheidend für die Konfliktbearbeitung. * Gute Zusammenarbeit erfordert aktives Aushandeln von Unterschieden. * Konfliktberatung ist eine hochverantwortungsvolle Tätigkeit. * Das 7i-Modell bietet eine systematische Herangehensweise an Konflikte. * Macht spielt eine zentrale Rolle in Konfliktsituationen. * Konflikte sollten nicht als negativ, sondern als Entwicklungschance gesehen werden. * Die Kommunikation ist der Schlüssel zur Konfliktlösung. * Ein interdisziplinärer Ansatz bereichert die Konfliktbearbeitung. GÄSTIN: KIRSTEN SCHROETER Dipl.-Psych. Mediatorin und Ausbilderin, Wissenschaftliche Leitung Master-Studiengang Mediation und Konfliktmanagement (M.A./LL.M.) Europa-Universität Viadrina / Frankfurt (Oder); Mitherausgeberin der Fachzeitschrift KonfliktDynamik
#248 GddZ - Zukunft der Arbeitswelt - Zukunft der Konfliktwelt. Im Gespräch mit Michael Neÿ
skills for future KAPITEL 0:04 - Einführung in die Arbeitswelt 7:58 - Konfliktpotenziale in der digitalen Arbeitswelt 17:25 - Technologie und ihre Auswirkungen auf Kommunikation 27:31 - Ambiguitätstoleranz im Arbeitsumfeld 40:04 - Die Rolle der Menschlichkeit in der digitalen Zukunft AUSFÜHRLICHE ZUSAMMENFASSUNG In dieser Episode des Podcasts „Gut durch die Zeit“ greife ich das Thema der Arbeitswelt auf, insbesondere in Bezug auf die Herausforderungen und Konfliktpotenziale, die mit der fortschreitenden Digitalisierung einhergehen. Ich habe Michael Neÿ, einen erfahrenen Berater und Mitarbeiter des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung, eingeladen, um gemeinsam den Wandel in der Arbeitsumgebung zu diskutieren. Wir sprechen über die Notwendigkeit, die sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Mitarbeitenden zu fördern, um den Anforderungen einer zunehmend digitalen Arbeitswelt gerecht zu werden. Michael liefert wertvolle Einblicke in seine Arbeit am Forschungsinstitut, wo der Fokus auf der Entwicklung von Berufsbildern und dem Bereich der Aus- und Weiterbildung liegt. Wir beleuchten, welche Kompetenzen in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt unerlässlich sind und wie sich diese im Kontext von Bildung und beruflicher Entwicklung manifestieren. Dabei steht die Frage im Raum, was es bedeutet, heute eine Ausbildung zu haben und welche Fähigkeiten in der Zukunft gefragt sein werden. Michael weist darauf hin, dass wir uns der Tatsache bewusst sein müssen, wie wir uns auf die digitalen Veränderungen einstellen und welche praktischen Maßnahmen wir ergreifen können, um den digitalen Wandel nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv daran teilzuhaben. Ein zentrales Thema unserer Diskussion ist die Achtsamkeit in der Kommunikation, besonders im digitalen Raum. Wir erörtern, wie Missverständnisse in der online Kommunikation zunehmen und welche Rolle unreflektierte Erwartungen an die Reaktionszeiten in unserer heutigen Arbeitsweise spielen. Die Technology selbst ist neutral, doch die damit verbundenen Erwartungen sowie der Umgang mit diesen Technologien können zu Konflikten führen. Wir analysieren, wie eine Kultur des reflektierten Umgangs mit Technologie dazu beitragen kann, Stress und Überlastung zu reduzieren, und welche Verantwortung Führungskräfte in diesem Prozess tragen. Weiterhin erörtern wir die sozialen Dynamiken zwischen den Generationen am Arbeitsplatz. Michael betont, dass Stereotype zwischen den Generationen häufig falsch verstanden werden und dass es im Umgang miteinander wichtiger denn je ist, zuzuhören und sich auf die individuellen Perspektiven zu konzentrieren. Es ist entscheidend, in Konfliktsituationen nicht mit vorgefertigten Meinungen zu agieren, sondern die richtigen Fragen zu stellen, um das Verständnis zwischen den Mitarbeitenden zu fördern. Abschließend diskutieren wir die zentralen Fragen unserer Zeit: Was bedeutet „Arbeit“ in einer Welt, in der viele Tätigkeiten von Maschinen übernommen werden können? Wie definieren wir uns selbst, wenn unsere berufliche Identität nicht mehr so stark an die Arbeit gebunden ist? Die Antworten darauf sind nicht nur für die Individuen, sondern auch für die Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um zukunftsfähig zu bleiben. Die Erkenntnisse aus diesem Gespräch sind nicht nur für Fachleute im Bereich der Organisation und Weiterbildung relevant, sondern auch für jeden, der an der Zukunft der Arbeitswelt interessiert ist. Es ist ein Appell, flexibel zu bleiben, den Wandel aktiv zu gestalten und die sozialen Aspekte der Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren. GAST: MICHAEL E.W. NEŸ Soziologe mit sozialpsychologischem Schwerpunkt, systemischer Coach und Supervisor. Seit 2020 am Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, (f-bb) seit 2022 als Projektgruppenleiter am Standort Magdeburg. Inhaltlicher Schwerpunkte „Leben und Arbeiten in der digitalisierten Welt“ und „psychoanalytische Sozialpsychologie in der Organisationsentwicklung“. Im Fokus steht die Frage nach menschlicher und organisationaler Resilienz im Wandel – insbesondere aus dem Blickwinkel der Biographieforschung. Seit ist er 2020 außerdem in der Leitung des Zukunftszentrums Digitale Arbeit Sachsen-Anhalt (ZZST), mit dem Ziel den digitalen Wandel im Bundesland kritische reflektiert umzusetzen. Für das f-bb ist Michael Neÿ im Vorstand des Nationalen Forums Beratung (nfb) und arbeitet an den Themen Professionalisierung der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (BBB-Beratung) sowie Kompetenzanforderungen von Beratung im digitalen Wandel (inkl. KI). Daneben engagiert er sich als Mitglied in der Gesellschaft für psychoanalytische Sozialpsychologie im Themenfeld Tiefenhermeneutik, mit dem Blick auf das Verstehen latenter, unbewusster Dimensionen sozialer Interaktionen, Kommunikationsprozesse und der Kultur einer Organisation. vollständiges Transkript auf der Episodenwebseite.
#247 GddZ - KI-Coaching. Im Gespräch mit Prof. Dr. Harald Geißler
Welches Coaching noch nicht durch eine Künstliche Intelligenz besser ausgeführt wird. > KI hat kein Problem mit Komplexität und Geschwindigkeit. KAPITEL: 0:06 - Einführung in KI-Coaching 1:41 - Professor Geißlers Erfahrungen 5:42 - Die Anwendung von ChatGPT im Coaching 11:21 - Coaching mit KI-Agenten 16:01 - Herausforderungen von KI im Coaching 25:32 - Die Rolle von Werten im Coaching 30:34 - Zukunft des KI-Coachings 31:00 - Empfehlungen für Coaches und Berater > Zielerreichungscoaching durch eine KI ausgeführt ist nicht (mehr) schlechter als von Menschen ausgeführt, aber das erklärte Ziel darf nicht in Frage stehen! GAST: Harald Geißler studierte Erziehungswissenschaft, promovierte 1976 und habilitierte sich 1985 an der Uni Münster. 1985 – 2015 Professor an die Helmut-Schmidt-Universität Hamburg für das Fach Erziehungswissenschaft, insbes. Berufs- und Betriebspädagogik.
#246 GddZ - Mediationsklauseln in der Praxis. Im Gespräch mit Jörg Schneider-Brodtmann und Thomas Schneider
Kleine Reihe: Konfliktprävention und -antizipation INHALT: KAPITEL: 0:07 - Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit 1:28 - Verbindung mit Thomas Schneider 3:24 - Öffentlichkeitsarbeit in der Mediation 6:09 - Praktische Erfahrungen mit Mediationsklauseln 9:01 - Herausforderungen bei der Umsetzung 15:41 - Die Bedeutung der Mediationsklausel 17:09 - Mediation im internationalen Kontext 22:15 - Kosten und Gebühren der Mediation 35:40 - Fazit und Ausblick auf zukünftige Themen AUSFÜHRLICHE ZUSAMMENFASSUNG In dieser Episode sprechen wir mit Thomas Schneider aus der Schweiz, einem Experten für Wirtschaftsmediation, über die Bedeutung und Anwendung von Mediationsklauseln in Verträgen. Gemeinsam mit Jörg Schneider-Brodtmann betrachten wir die praktischen Aspekte der Konfliktprävention im Wirtschaftsbereich und wie Mediationsklauseln eine proaktive Strategie zur Konfliktlösung darstellen können. Zu Gast ist der Schweizer Wirtschaftsmediator von der Schweizer Kammer für Wirtschaftsmediation Thomas Schneider. Wir diskutieren zunächst, wie die Zusammenarbeit zwischen Praktikern und Juristen in der Mediation gefördert werden kann, um das Bewusstsein für präventives Konfliktmanagement zu stärken. Thomas berichtet von seinen Erfahrungen in der Wirtschaft, wobei er hervorhebt, dass Konflikte häufig erst im Nachhinein und oft erst vor Gericht gelöst werden. Die Idee, bereits bei Vertragsverhandlungen die Möglichkeit zur Mediationsklausel einzubauen, wird als cleverer Ansatz dargestellt, um die Wahrscheinlichkeit einer friedlichen Konfliktlösung zu erhöhen. Ein zentraler Punkt unseres Gesprächs ist die Notwendigkeit, die verschiedenen Arten von Mediationsklauseln zu verstehen. Thomas erklärt die Unterschiede zwischen verpflichtenden und optionalen Klauseln und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Wir erörtern, wie eine gut formulierte Klausel nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, sondern auch das Risiko von langwierigen Rechtsstreitigkeiten mindern kann. Darüber hinaus unterstreichen wir die Herausforderungen, mit denen Mediationsklauseln in der Praxis konfrontiert sind. Oft besteht eine Diskrepanz zwischen der theoretischen Einigung über Mediationsklauseln und der tatsächlichen Bereitschaft, diesen Prozess im Konfliktfall zu verfolgen. Wir beleuchten die psychologischen und emotionalen Aspekte, die eine Rolle spielen, wenn Auftraggeber und Geschäftsleitungen mit Konflikten konfrontiert werden und erklären, wie eine Mediationsklausel dabei unterstützt, einen neutralen Mediator zu finden. Im Laufe der Episode bietet Thomas Einblicke in vergangene Projekte und teilt praktische Erfahrungen zur Umsetzung dieser Klauseln. Gemeinsam sprechen wir auch über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Mediation in der Schweiz, den Einsatz von Mediationsinstitutionen und die Schaffung eines Bewusstseins für die Wichtigkeit dieser vorbeugenden Maßnahmen. Abschließend wird deutlich, dass, auch wenn Mediationsklauseln in der Praxis noch nicht weit verbreitet sind, deren zielgerichtete Anwendung und das damit verbundene präventive Denken zu einer signifikanten Verbesserung im Umgang mit Konflikten führen können. Wir hoffen, dass diese Episode die Zuhörer dazu anregt, Mediationsklauseln in ihre Vereinbarungen einzufügen und somit die Verhandlungs- und Konfliktkultur im B2B-Bereich zu verbessern. GÄSTE: Dr. jur. Jörg Schneider-Brodtmann, studierte Rechtswissenschaften in Tübingen, Genf/Schweiz, Heidelberg; Master of Laws (Mediation und Konfliktmanagement), Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder). Anwalt des Jahres für Technologierecht, Handelsblatt / Best Lawyers 2022 und 2024; Empfohlen für IT- und Technologierecht, Handelsblatt / Best Lawyers 2022, 2023 und 2024; Empfohlen für Data / Information Technology, Who’s Who Legal Global und Germany 2022 und 2023; Einer der renommiertesten Anwälte für IT-Recht, WirtschaftsWoche 34/2019. Thomas Schneider, Zertifizierter Mediator bei Schweizerische Kammer für Wirtschaftsmediation (SKWM), als Partner bei TSc Consulting AG (Schweiz) ist Thomas Schneider tätig mit Fokus auf IT, Projekt- und Veränderungsmanagement sowie Mediation.
Elige tu suscripción
Premium
20 horas de audiolibros
Podcasts solo en Podimo
Podcast gratuitos
Cancela cuando quieras
Empieza 7 días de prueba
Después $99 / month
Empieza 7 días de prueba. $99 / mes después de la prueba. Cancela cuando quieras.