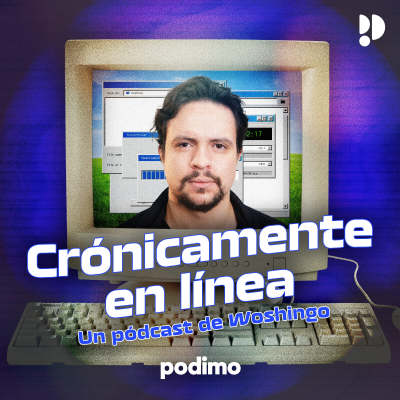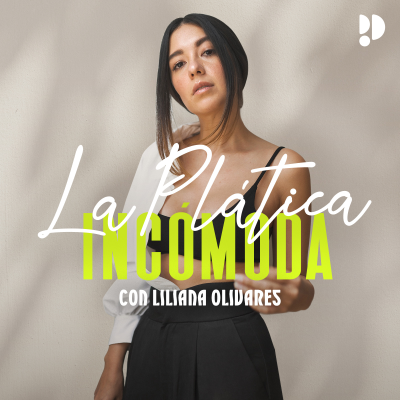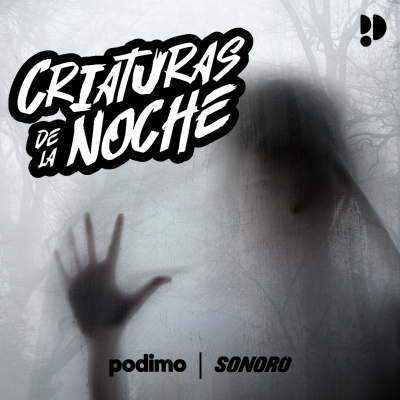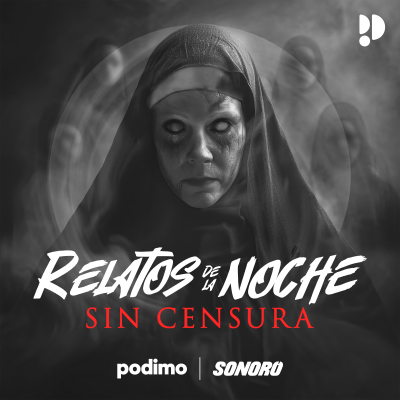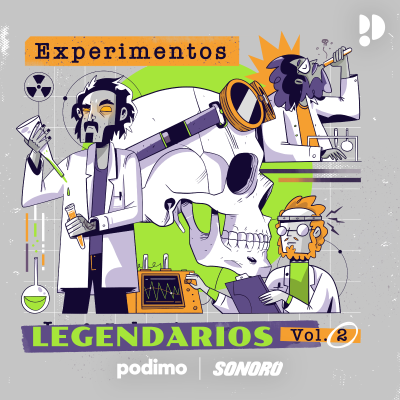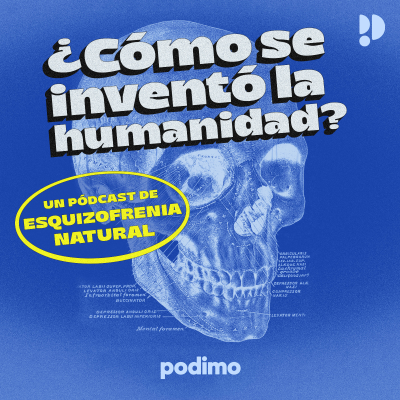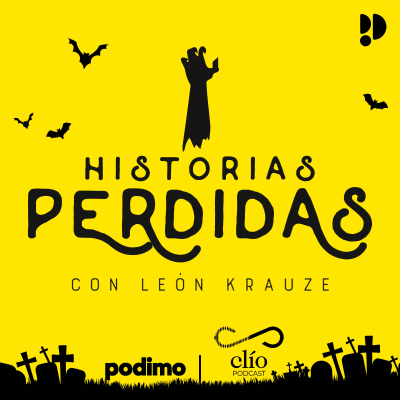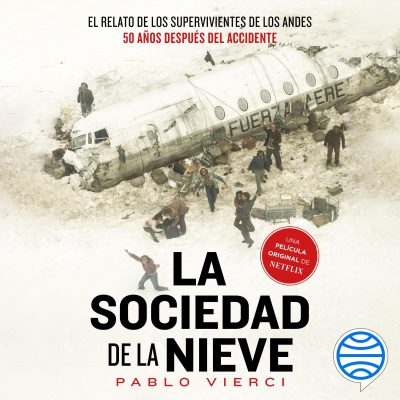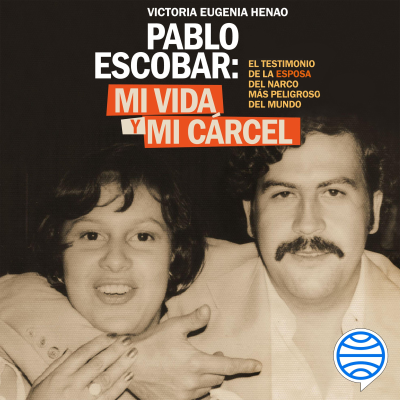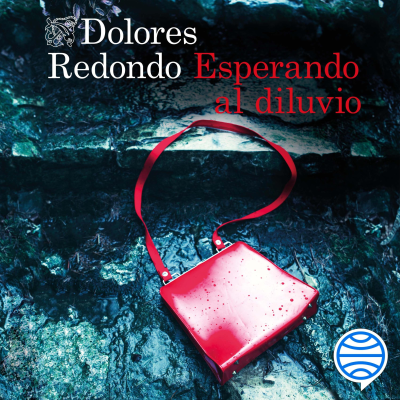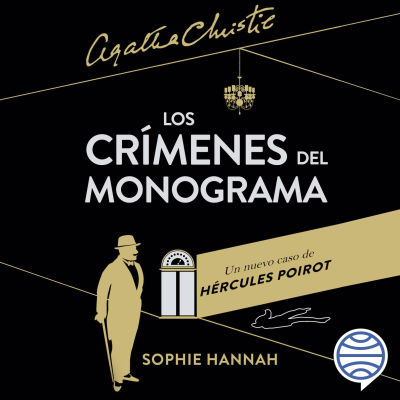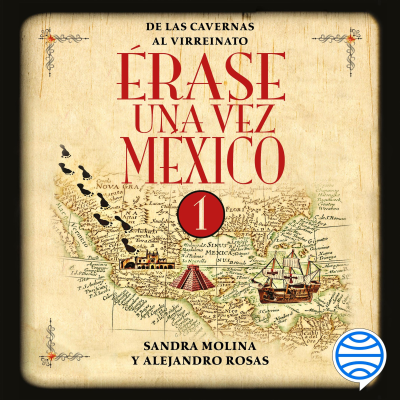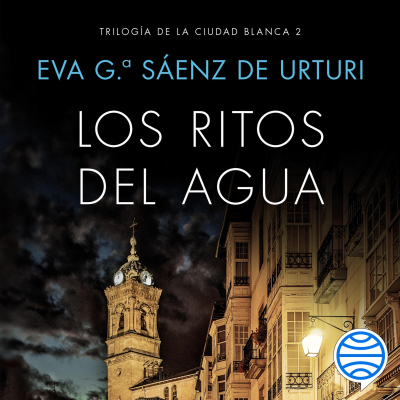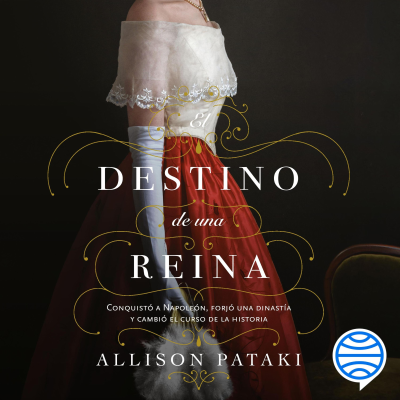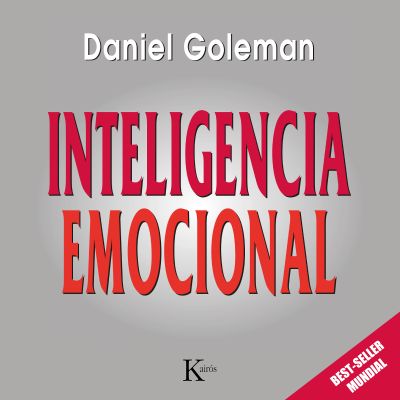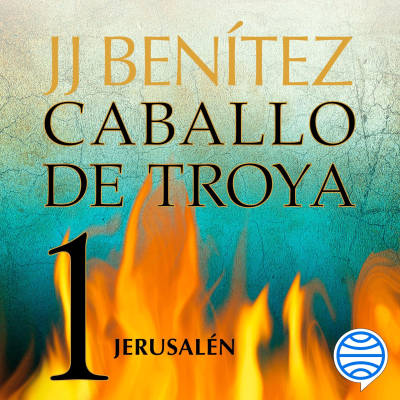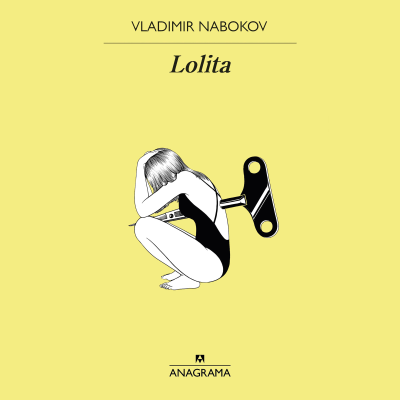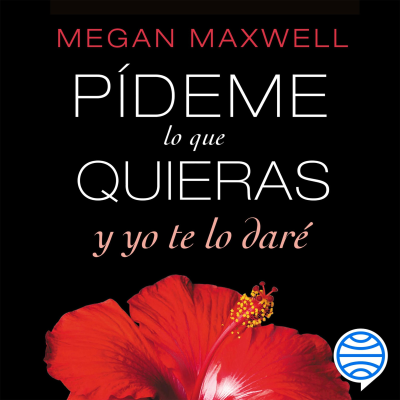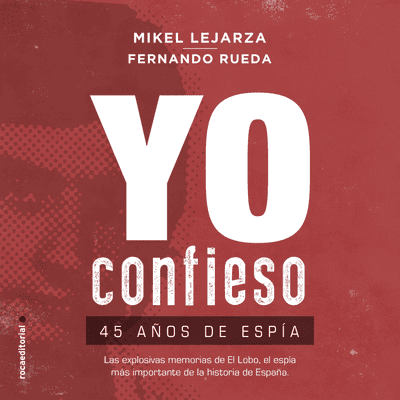NachDenkSeiten – Die kritische Website
alemán
Actualidad y política
Empieza 7 días de prueba
$99 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
- 20 horas de audiolibros al mes
- Podcasts solo en Podimo
- Podcast gratuitos
Acerca de NachDenkSeiten – Die kritische Website
NachDenkSeiten - Die kritische Website
Todos los episodios
4731 episodiosDie Hölle von Verdun – Die Hölle des Krieges
Am 21. Februar ist es 110 Jahre her, dass die Schlacht um Verdun begonnen hat. Verdun wurde zum Beispiel für die Mischung aus mittelalterlicher Brutalität und industriellen Tötungswaffen wurde. Vor allem aber muss die Hölle von Verdun als abschreckendes Beispiel für Krieg in Erinnerung bleiben. Von Reiner Braun und Michael Müller. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Vergessen, verdrängt, verantwortungslos? Am 21. Februar 1916 begann der Morgen mit dem ohrenbetäubenden Lärm von 1.220 deutschen Artilleriegeschützen. Es folgte die extrem brutale Schlacht um die 40 Fortanlagen von Verdun, die nach der Niederlage von 1870/71 von Frankreich ausgebaut worden waren. Verdun wurde durch die entmenschlichten und verlustreichen Kämpfe über zehn Monate zum Symbol der mörderischen Ergebnislosigkeit der Materialschlachten im Ersten Weltkrieg. Um 17:00 Uhr desselben Tages startete die erste Angriffswelle der deutschen Infanterie im eisigen Schlamm der schnell entwaldeten Hügel rund um die Forts. Eine sterbende Landschaft, die schon bald von den Stümpfen zerschossener Bäume gezeichnet war. Trotz der verlustreichen Marne-Schlachten oder der Kämpfe an der Somme hat sich vor allem die Hölle von Verdun, bei der junge Männer hemmungslos ins Feuer geschickt wurden, tief in das deutsche und französische Bewusstsein für das Grauen des Ersten Weltkriegs eingegraben. Die Orte der Unmenschlichkeit hießen Fort Douaumont oder Fort Vaux. Erstmals wurden Flammenwerfer als Waffe eingesetzt. Die Soldaten mussten in vielen Nächten mit Gasmasken schlafen, blieben in der Kraterlandschaft oft tagelang ohne Nahrung, konnten den penetranten Geruch der herumliegenden Leichen nur schwer ertragen und wurden bei Verletzungen oftmals gar nicht medizinisch betreut. In den acht Monaten der Schlacht um Verdun wurden 50 Divisionen auf deutscher und 75 Divisionen auf französischer Seite eingesetzt. Jede Division umfasste zwischen 15.000 und 18.000 Soldaten, auf französischer Seite auch zwangsrekrutierte Männer aus den afrikanischen Kolonien (Armée d’Afrique). Nach den Schätzungen verloren zwischen 377.000 und 540.000 Soldaten für Frankreich und zwischen 337.000 und 434.000 Angehörige des Deutschen Heeres ihr Leben oder wurden schwer verletzt. Und doch wurde gerade Verdun zum Ort der deutsch-französischen Aussöhnung, das Memorial de Verdun zum Mahnmal gegen Krieg. Alle, die heute so leichtfertig von Krieg reden, sollten diesen Ort nicht nur besuchen, sondern sich die Todesnarben des Krieges ansehen, wie zum Beispiel die Orte lebendig begrabener Soldaten mit ihren hochgereckten Bajonetten, um von dem Irrsinn eines Krieges gegen Russland wegzukommen und sich für Frieden einzusetzen. Verdun ist der Ort, der uns alle zum Frieden mahnt; der Ort, der uns seit 110 Jahren vor Augen führt, wie gnadenlos und unsinnig Krieg ist, der doch irgendwann mit großen Schmerzen und unsäglichen Verlusten enden muss. Damit enden aber noch lange nicht das Leid und die Trauer der Familien, die ihre Söhne verloren haben oder die sich um die kriegsversehrten Angehörigen kümmern müssen. Wofür nur? Wie dürfte uns heute das Leben auch nur eines ukrainischen oder russischen Soldaten auch nur eine Sekunde egal sein, von denen aber so viele seit nunmehr vier Jahren ihr Leben lassen? Und wie sollte es uns gleichgültig sein, wenn jetzt auch von unseren Jugendlichen eine „Kriegstüchtigkeit“ gefordert wird, einsatzbereit für einen irrsinnigen Krieg gegen Russland? Jedes leichtfertige Gerede über „Krieg“ verbietet sich angesichts der Hölle von Verdun. Verdun mahnt uns: „Nie wieder Krieg!“ Es gibt nichts Wichtigeres als Frieden in der Ukraine, im Nahen und Mittleren Osten, im Iran, im Sudan und in Venezuela. Und in all den anderen Schauplätzen aktueller Kriege und mörderischer Konflikte. Reiner Braun ist Vorstandsmitglied des Internationalen Friedensbüros (IPB) und der Naturwissenschaftlerinitiative Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit. Michael Müller ist Bundesvorsitzender der Naturfreunde, Mitglied des Deutschen Bundestages von 1983 bis 2009 und ehemaliger Staatssekretär im Umweltministerium. Titelbild: Catalin.Bogdan / Shutterstock
Nord Stream, das Zwiebelprinzip und die größtmögliche Demütigung
Laut aktuellen Recherchen des SPIEGEL [https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nord-stream-cia-war-offenbar-frueh-in-plaene-der-angreifer-eingeweiht-a-d95f5682-dc5b-47a7-82e2-5bb09661b210] soll die CIA bereits früh in die Anschlagspläne auf die Nord-Stream-Pipelines eingeweiht gewesen sein und ihnen zumindest anfangs auch grünes Licht gegeben zu haben. Das wird nicht die letzte „Enthüllung“ gewesen sein und die gesamte Geschichte ist auch noch lange nicht auserzählt. Wie bei einer Zwiebel wird Schicht um Schicht die Wahrheit freigelegt. So kommt es zumindest zu keinem „Realitätsschock“. Derweil betreiben die USA und Russland hinter den Kulissen eifrig ihre Schattendiplomatie. Dass Nord Stream künftig wieder Gas liefern wird, ist durchaus möglich – dann jedoch unter Kontrolle der USA. So droht Nord Stream zu einem Mahnmal der Demütigung und des europäischen Versagens zu werden. Von Jens Berger. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Kurz nach der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines stand für Politik und Medien fest: Der Russe war’s! Was auch sonst? Nachdem Indizien oder gar Beweise ausblieben und man keine Erklärung für das offensichtlich fehlende Tatmotiv Russlands fand, versuchte man den Sabotageakt so gut wie möglich zu verdrängen und kleinzuspielen. Man wolle ja ohnehin kein Gas mehr aus Russland beziehen, da sei es letztlich auch egal, ob die Ostseepipelines nun intakt oder zerstört seien. So ganz ignorieren konnte man die Anschläge aber dennoch nicht, zumal erste Ermittlungsergebnisse an die Öffentlichkeit drangen, die auf eine ukrainische Täterschaft hinwiesen. Nun machte die Geschichte von ukrainischen Hobbytauchern die Runde. In den Medien keimte damals sogar Sympathie für die Täter auf. Wahnsinn. Aus den Hobbytauchern wurden dann bald Angehörige ukrainischer Spezialeinheiten. Zunächst hieß es, sie hätten vollkommen auf sich allein gestellt gehandelt. Dann kam langsam heraus, dass sie auf Anweisung des damaligen ukrainischen Oberbefehlshabers handelten. Angeblich wusste die politische Führung jedoch nichts davon. Wer’s glaubt. Warten wir auch die nächste Schicht der Zwiebel ab. Bislang hielt sich auch die Erzählung wacker, dass weder die USA noch sonstige westliche Staaten in die Planung eingeweiht oder gar aktiv daran beteiligt waren. Zumindest diese Erzählung ist jetzt auch Geschichte. Glaubt man dem SPIEGEL, der sich auf „vertrauenswürdige ukrainische Quellen“ beruft, war die CIA schon sehr früh in die Planung einbezogen. Es gab demnach einen regelmäßigen Austausch und die Amerikaner hatten den Anschlagsplänen wohl auch grünes Licht gegeben. Doch dann sollen sie sich – warum, das bleibt offen – plötzlich anders entschieden haben. Wer’s glaubt. Ob die CIA oder die US-Regierung dieser Version folgend die Pläne daraufhin aktiv verhindert oder ihre Verbündeten in Deutschland informiert haben, bleibt offen. Aber diese Fragen stellen sich ohnehin nur, wenn man die jetzige Version wirklich glaubt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch dies nur eine Schicht der Zwiebel ist und tieferliegende Schichten derartige Fragen ohnehin obsolet machen. Spannender als die derzeitige Geschichte selbst sind daher auch eher die Sätze zwischen den Zeilen. So heißt es im SPIEGEL-Artikel [https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nord-stream-cia-war-offenbar-frueh-in-plaene-der-angreifer-eingeweiht-a-d95f5682-dc5b-47a7-82e2-5bb09661b210] beispielsweise, dass der ukrainische Drahtzieher hinter dem Anschlag zu einer „Elitetruppe“ gehörte, „die von der CIA nach der Maidan-Revolution 2014“ aufgebaut wurde und die spätestens ab 2019 „oft mit Hilfe der USA“ verdeckt „gegen Moskau“ gearbeitet habe. Eine Quelle wird mit den Worten zitiert, man habe „gemeinsam mit den Amerikanern gearbeitet“ und „im Prinzip sei es über die Jahre egal gewesen, zu welchem Dienst (also CIA oder ukrainischer Dienst, Anm. d. Red.) man gehörte“. Interessant. Widerspricht das nicht der auch heute noch in Medien und Politik erzählten Geschichte, die USA hätten sich nicht aktiv am ukrainischen Bürgerkrieg und an Operationen gegen Russland beteiligt? Wenn man diese Sätze ernst nimmt, ist es übrigens auch unerheblich, ob die CIA oder die US-Regierung die ukrainischen Nord-Stream-Saboteure nun direkt angewiesen haben. Es ist ja eh egal, zu welchem Dienst man nun konkret gehört. Und wie reagiert das politische Deutschland auf die nun entfernte Schicht der Zwiebel? Gar nicht. Was auch sonst! Es ist schließlich auch klar, dass die Entscheidungsträger ohnehin wissen, was sich noch in den inneren Schichten der Zwiebel befindet. Am liebsten würde man das ganze Thema totschweigen. Aber wenn man das schon nicht kann, so scheint es zumindest strategisch klüger zu sein, die Schichten Teil für Teil und mit größerem zeitlichen Abstand offenzulegen. Die Öffentlichkeit vergisst schnell. Denn eins ist klar: Je näher man dem Kern der Wahrheit kommt, desto stärker gerät man in Erklärungsnot. Warum unterstützt man einen Staat, der mittels Staatsterrorismus schwere Straftaten gegen Deutschland begangen hat? Erst vor kurzen stellte der BGH fest [https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-stb6025-nord-stream-anschlag-2022-haftbeschwerde-immunitaet-ukraine-russland], dass „dringende Gründe dafür sprächen, dass der ukrainische Staat den Sabotageakt initiiert und gesteuert habe“. Und unsere Regierung sieht diesen ukrainischen Staat immer noch als besten Verbündeten? Kaum zu glauben. Noch größer wäre die Erklärungsnot, wenn nun auch offiziell offenbar würde, dass unser allerbester Verbündeter, die USA, den Anschlag nicht nur toleriert, sondern womöglich auch initiiert und gesteuert haben. Aber es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Stelle keine Fragen, deren Antwort du nicht ertragen kannst. Derweil findet das Thema Nord Stream auch auf einer ganz anderen Ebene statt, die der deutschen Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Dazu ist in der letzten Woche ein überaus lesenswerter Artikel [https://monde-diplomatique.de/artikel/!6143866?fbclid=IwY2xjawQEyvRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETJJNkhmYWczaUNSVHhrb3M5c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuzITGAYNxMHGacGUa5C29vwSM6qMiZjBAWbZjIhlHa8OnkAretCaLXTXae__aem_luWybruBQmFzBJrhYpcAnw] in der Le Monde diplomatique erschienen. Der Artikel behandelt die Schattendiplomatie zwischen Russland und den USA über eine mögliche Reparatur und Wiederinbetriebnahme der Pipelines. Hierfür gibt es nicht nur in Russland, sondern auch in den USA großes Interesse und die normative Kraft des Faktischen wird die EU ohnehin bald zwingen, sich diesem Unterfangen nicht mehr zu verschließen. In Alaska stand die gemeinsame russisch-amerikanische Wiederinbetriebnahme von Nord Stream bereits auf der Agenda. Auch dieser Artikel glänzt aber durch das, was dort zwischen den Zeilen geschrieben ist. So wird beispielsweise unter Verweis auf amerikanische Geheimdienstquellen behauptet, dass die USA schon 2024 – also vor Trumps Wiederwahl – aktiv Interesse an einer Wiederinbetriebnahme von Nord Stream gezeigt haben, um – und hier wird es besonders interessant – „die Pipelines als politischen Hebel gegen Europa zu nutzen“. Das ist durchaus glaubhaft und vervollständigt das Mosaik. Während man in Deutschland immer noch glaubt, es ginge bei dem Anschlag um Russland, wird immer deutlicher, dass Europa das eigentliche Ziel ist. Es ging nie darum, Russland zu schwächen. Es ging den Amerikanern zu jedem Zeitpunkt nur darum, die europäische Energieversorgung zu steuern und Europa so in der Hand zu haben. > Jetzt aber, da Trump sich von der transatlantischen Partnerschaft abwendet, begnügen sich die USA nicht mehr damit, den Europäern LNG zu verkaufen und einer russisch-europäischen Annäherung entgegenzuarbeiten. Sie wollen mehr: eine verstärkte Kontrolle der Energieinfrastrukturen – und zwar auch in Europa. > Quelle: LMd [https://monde-diplomatique.de/artikel/!6143866?fbclid=IwY2xjawQEyvRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETJJNkhmYWczaUNSVHhrb3M5c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuzITGAYNxMHGacGUa5C29vwSM6qMiZjBAWbZjIhlHa8OnkAretCaLXTXae__aem_luWybruBQmFzBJrhYpcAnw] Zählt man eins und eins zusammen, ergibt sich hieraus die größtmögliche Demütigung Europas. Henry Kissinger soll einst gesagt haben: „Wer die Energie beherrscht, beherrscht die Welt“. Er hatte damit nicht ganz unrecht. Nord Stream zeigt, dass Europa die Energie nicht beherrscht. Doch wo bleibt die Diskussion? Wo bleibt der Aufschrei? Titelbild: Frame Stock Footage/shutterstock.com[http://vg04.met.vgwort.de/na/c823a06d9ea845fa8a2f4bb816b97975]
Tilo Jung will dafür „kämpfen“, dass Florian Warweg aus der BPK ausgeschlossen wird
Es gebe „kein Recht“ darauf, Mitglied der Bundespressekonferenz (BPK) zu werden, „insbesondere nicht als ehemaliger Mitarbeiter eines russischen Propagandasenders“. Das sagt der Journalist Tilo Jung, der sich gleichzeitig an anderer Stelle als Streiter für die Rechte von Journalisten aufspielen will. Diese Doppelmoral ist ein Zeichen der Zeit. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Der Journalist Tilo Jung hat – bezogen auf den Journalisten und ehemaligen Redakteur der NachDenkSeiten Florian Warweg – kürzlich auf X mitgeteilt [https://x.com/TiloJung/status/2024139845287714904]: > „Als Mitglied des Vereins der BPK ist es mein gutes Recht gegen die Aufnahme neuer Mitglieder Einspruch einzulegen, da Warweg aus meiner Sicht nichts im Verein zu suchen hat. Das gilt auch weiterhin und dafür kämpfe ich. Befasse dich mit den Tatsachen.“ Er fährt fort: > „Es gibt kein Recht Mitglied der BPK zu werden. insbesondere nicht als ehemaliger Mitarbeiter eines russischen Propagandasenders.“ Ein anderer Nutzer fragt: „Mit welchem Recht bist du dann Mitglied?“ Jung: antwortet: > „Ich habe die Zugangsvoraussetzungen erfüllt“ Ausgelöst wurden die Äußerungen durch Kritik an doppelten Standards: Kürzlich hatte Jung Ausführungen des Filmjournalisten Rüdiger Suchsland kritisiert. Der hatte gesagt, man solle künftig den Zugang zu Pressekonferenzen selektiver gestalten, zu sehen in diesem Ausschnitt [https://x.com/TiloJung/status/2024069919348830470]. Jung hatte dazu geschrieben: > „Manche meiner Kollegen sind sich wirklich für nichts zu dumm: Journalisten fordern die Beschneidung von Rechten von Journalisten.“ Einerseits gegen die Aufnahme von bestimmten Kollegen in die BPK zu trommeln und sich andererseits mit Sprüchen gegen die Zugangsbeschränkung von Pressekonferenzen als Kämpfer für Journalisten-Rechte aufzuspielen, diese Doppelmoral hat die Journalistin Aya Velazquez in diesem Beitrag auf X [https://x.com/aya_velazquez/status/2024160360018608430?s=46] so illustriert: [https://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/269220-jung.jpg] In diesem X-Beitrag [https://x.com/aya_velazquez/status/2024498740715835819] geht Velazquez näher auf die Vorgänge ein. Florian Warweg hat sich in diesem X-Beitrag [https://x.com/fwarweg/status/2024174611428970749?s=43&t=a7Mtaj64iAIk-uNWh6pS0g] dazu geäußert. Der Rechtsanwalt Markus Kompa geht in diesem Interview [https://www.telepolis.de/article/Bundespressekonferenz-gegen-Journalist-Das-ist-Realsatire-vom-Allerfeinsten-9305438.html] auf juristische Fragen des Zugangs zur BPK ein. Warweg ist nicht der erste Journalist, dessen Anwesenheit in der BPK Widerstand hervorruft, erinnert sei etwa auch an die Vorgänge um Boris Reitschuster [https://www.nachdenkseiten.de/?p=70046]. Doppelte Standards Was soll das eigentlich heißen, wenn Jung schreibt, Warweg „hat dort nichts zu suchen“? Und wer definiert eigentlich, wer ein „echter“ Journalist ist und wer nicht? Und würde sich eine restriktive Auslegung dieser Definition nicht auch gegen Jung selber wenden? Auffällig ist die offensive Art, mit der Jung seine doppelten Standards verteidigt. Das ist ein Zeichen der Zeit: Dinge wie freie Meinungsäußerung, gleichberechtigter Zugang zur Monopolveranstaltung BPK etc. werden ganz offen bekämpft, ohne Scham zu empfinden – und dabei wird auch noch so getan, als würde man für eine gute Sache streiten. Die Beurteilung des Vorgangs hat nichts mit inhaltlichen Standpunkten zu tun: Alle Journalisten müssen Zutritt zur BPK erhalten – egal, welche Meinung sie vertreten und wo sie vorher gearbeitet haben, solange sich das im Rahmen der Verfassung bewegt. Wenn einigen Journalisten die Anwesenheit von kritischen Kollegen nicht gefällt, weil das auch ein peinliches Licht auf ihre eigenen angepassten Fragen wirft, dann ist das deren persönliches Problem. Ein Problem für das Prinzip Meinungsfreiheit entsteht erst, wenn schon das Stellen von (bestimmten) Fragen skandalisiert wird. Welpenschutz für Regierungssprecher Die NachDenkSeiten üben viel Kritik an Inhalten in den „etablierten“ Medien – aber wir fordern doch nicht den Ausschluss von deren Personal oder dass sie im Meinungskampf benachteiligt werden. Ich würde nie auf die Idee kommen, für den Ausschluss von Tilo Jung aus der BPK zu trommeln. Viele seiner Inhalte (nicht alle) widersprechen meiner Meinung, z.B. sein angepasstes Verhalten während der Corona-Zeit. Trotzdem wäre auch sein Ausschluss natürlich eine Art der Zensur. Und dafür zu werben, würde ich zusätzlich als unkollegial empfinden. Dass Jung anscheinend denkt, dass er mit diesem Verhalten irgendwo Punkte machen kann, ist bedenklich. Der „Kampf“ dafür, kritischen Journalisten den Zugang zur BPK zur verwehren, erscheint auch wie ein übertriebener Schutz-Reflex für die Regierungssprecher, die auf deren Fragen antworten müssen. Können die sich nicht mit Argumenten „wehren“? Wenn ihre Position so unangreifbar wäre, dann sollte es doch ein Leichtes sein, sie in der BPK zu verteidigen. Der von Tilo Jung und Anderen „bekämpfte“ Florian Warweg hat in der BPK für die NachDenkSeiten guten und seriösen Journalismus gemacht, davon können sich die Leser unter diesem Link [https://www.nachdenkseiten.de/?tag=bundespressekonferenz] überzeugen. Seit seinem Wechsel zur OAZ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=145045] führt er diese Arbeit dort fort – man kann für die Meinungsfreiheit nur hoffen, dass der „Kampf“ des Tilo Jung keinen Erfolg hat. Titelbild: Screenshot NachDenkSeiten, Bundespressekonferenz 21.01.2026 Mehr zum Thema: Die NachDenkSeiten auf der BPK [https://www.nachdenkseiten.de/?tag=bundespressekonferenz] [https://vg08.met.vgwort.de/na/c230ae7e50f94921a63f3bce682f90d3]
Merz will Klarnamenpflicht im Internet – diese Forderung kommt dem Austritt aus der Demokratie gleich
„Aber ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte wissen, wer da sich zu Wort meldet“ [https://x.com/AMoehnle/status/2024224990594314667] – das sagte Friedrich Merz am politischen Aschermittwoch in Trier. Auf schwerste Grundrechtseingriffe während der Coronazeit und der Unterstützung des EU-„Desinformationssanktionsregimes“ folgt nun also ein weiterer Angriff auf die Demokratie. Klarnamenpflicht im Internet: Das ist so, als müsste sich jemand, der auf dem Marktplatz Merz‘ Rücktritt fordert, vorher ein Namensschild umhängen. Hat der Bundeskanzler schon mal etwas von der „Speakers‘ Corner“ in England gehört? Dort gibt es auch keine Klarnamenpflicht. Eine solche würde den Geist der Demokratie beschämen. Die Klarnamenpflicht im Internet ist demokratisch untragbar – wer sie fordert, verabschiedet sich aus der Demokratie. Ein Kommentar von Marcus Klöckner. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Klarnamenpflicht im Internet – das will der Bundeskanzler. Klarnamenpflicht im Internet – das widerspricht dem demokratischen Geist. Klarnamenpflicht im Internet – das ist so, als müsste sich jemand, der auf dem Marktplatz sagt, Merz solle zurücktreten, vorher ein Namensschild umhängen. Wie soll es weitergehen? Sollen demnächst Wahlen nicht mehr geheim sein? Wahlen nur noch unter öffentlicher Bekanntgabe, wer wie gewählt hat? Peter Maier hat die CDU gewählt: Applaus! Eva Maier hat die AfD oder das BSW gewählt: öffentliche Beschämung und Verfolgung? So langsam sollte es jedem klar werden: Den Kampf um die jämmerlichen Reste der öffentlichen Debattenräume versucht die Politik mit immer dreckigeren Mitteln für sich zu entscheiden. In einer freien, offenen, demokratischen Gesellschaft muss es für jeden Staatsbürger möglich sein, seine Meinung öffentlich ohne Nennung seines Namens kundzutun. Die Anonymität ist ein Schutzraum, der für eine Demokratie von elementarer Bedeutung ist. Politische Meinungsäußerungen kommen längst einem Gang durch ein Minenfeld gleich. Nicht jeder hat den Mut und die Kraft, seine politische Position öffentlich unter seinem vollen Namen zu äußern. Deshalb hat eine demokratische Gesellschaft den Raum des Anonymen zu gewähren. Wer nämlich befürchten muss, dass auf die Äußerung der eigenen politischen Meinung die Knute folgt, wird sich aus der öffentlichen Diskussion zurückziehen – und damit wird die Demokratie erstickt. Hat Friedrich Merz jemals etwas von der Speakers‘ Corner in England gehört? Die Speakers‘ Corner ist ein weltberühmter Ort, an dem der Geist der Demokratie zelebriert wird. Speakers‘ Corner – das ist jene Stelle im Londoner Hyde Park, wo auf einer freien Fläche jeder Mensch sich auf eine Kiste stellen darf, um frei öffentlich das zu sagen, was er denkt. Persönlichkeiten wie Karl Marx, Lenin, George Orwell oder Emma Goldman haben dort vorgetragen. Alles kann an der Speakers‘ Corner frei gesagt werden: Geniales und Abgedrehtes, Höfliches und Unverschämtes – alles darf und soll gehört werden. Gerade dadurch, dass an diesem Ort jeder anonym sprechen darf, ist die Speakers‘ Corner zum Symbol für Meinungsfreiheit geworden. Eine „Klarnamenpflicht“ gibt es dort nicht. Bei allen autoritären Entwicklungen, die auch in Großbritannien zu beobachten sind: Klarnamenpflicht an der Speakers‘ Corner? Ein Unding! Der Jurist Niko Härting [https://www.nachdenkseiten.de/?p=68202] spricht von einem „Menschenrecht“ [https://x.com/nhaerting/status/2024321286953177386] in Bezug auf die anonyme Rede. Doch eine Klarnamenpflicht im Internet wäre noch schlimmer als die Pflicht zum Umhängen eines Namensschildes bei einer Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit. Wer seinen Namen in der Internetöffentlichkeit unter jedem Posting angeben muss, wird für die gesamte Welt sichtbar – und wird es bleiben, solange es das Internet gibt. Arbeitgeber könnten so nach der politischen Gesinnung ihrer Mitarbeiter oder von Bewerbern Ausschau halten – und entsprechend agieren. Längst liegen die Karten auf dem Tisch. Der Politik schmeckt nicht, dass sie kritisiert wird. Sie hat ein Problem damit, dass sie nicht die Kontrolle über die Debattenräume im Internet hat. Die öffentliche Diskussion auf den großen Plattformen der öffentlich-rechtlichen Medien ist ohnehin längst abgewürgt. Das ist im Sinne der Politik. Dass im Internet Max Mustermann vor den Gefahren der Corona-Impfung warnt, Lieschen Müller sich traut, „Stellvertreterkrieg“ zu sagen und Heiner Maier den Rücktritt der Regierung fordert, soll verhindert werden. Um nichts anderes geht es bei der Klarnamenpflicht im Internet. Die Klarnamenpflicht im Internet ist demokratisch untragbar – wer sie fordert, verabschiedet sich aus der Demokratie. Titelbild: penofoto / Shutterstock
27 Monate Regenwetter – wenn Gewerkschaften ihre eigenen Mitglieder nass machen
Der Abschluss im öffentlichen Dienst der Länder setzt neue Maßstäbe in puncto „Genügsamkeit“: Ein Plus von 5,8 Prozent in drei Schritten und eine Laufzeit von über zwei Jahren bedeuten bestenfalls eine Nullrunde, eher schleichenden Reallohnverlust. Die Reaktionen unter ver.di-Mitgliedern reichen von „Beleidigung“ über „Desaster“ bis hin zu „Vogel abgeschossen“. Für studentische Beschäftigte an den Hochschulen gibt‘s auch kaum etwas, schon gar nicht einen eigenen Tarifvertrag. Von Ralf Wurzbacher. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Ein Abschluss bei den Bundesländern dürfe „nicht schlechter ausfallen“ [https://www.handelsblatt.com/dpa/tarifstreit-verdi-kuendigt-verschaerfte-warnstreiks-an/100198133.html] als das Ergebnis der Einigung, die die Gewerkschaften im April 2025 mit dem Bund und den Kommunen erreicht hätten. Diese Vorgabe hatte der Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Frank Werneke, Anfang Februar noch einmal vor dem finalen „Tarifpoker“ im öffentlichen Dienst der Länder gemacht. Seit vergangenem Wochenende ist der Streit beigelegt, und zumindest in einem Punkt legten die Beschäftigtenvertreter eine Punktlandung hin: 27 Monate beträgt die Laufzeit des vor zehn Monaten ausgehandelten Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Und exakt 27 Monate gilt nun auch der Tarifvertrag für die Bediensteten der Länder (TV-L). Da kann man nur sagen: Herzlichen Glückwunsch! Solche Gewerkschaften braucht Deutschland. Man gibt einen schlechten Maßstab als letzte Verteidigungslinie aus, trifft am Ende halbwegs ins Schwarze und verkauft das Ganze anschließend als Erfolg. Der aber in Wahrheit eine bittere Niederlage ist, weil meilenweit entfernt von den Forderungen, mit denen man Anfang Dezember in die Auseinandersetzung eingestiegen war. Da stand auf der Wunschliste noch eine Geltungsdauer von einem Jahr, also 365 Tage und nicht über 800. Damit aber gerät das Erreichte zu einem billigen Abklatsch dessen, was man eigentlich durchsetzen wollte. Am Sonntag versah der Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck auf seinem Blog „Relevante Ökonomik“ [https://www.relevante-oekonomik.com/2026/02/15/lohnzuwaechse-im-oeffentlichen-dienst-bei-2-prozent-pro-jahr/] das angeblich „vernünftige“ Ergebnis mit einem dicken Fragezeichen. So vermeide es ver.di, das Resultat transparent auf die Forderungslänge von zwölf Monaten herunterzurechnen. „Was heißt, gerechnet haben sie bestimmt, aber sie halten es nicht für nötig, ihre Mitglieder und die interessierte Öffentlichkeit darüber zu informieren.“ „In Richtung null“ Ursprünglich wollten ver.di, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Beamtenbund (DBB), die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 300 Euro monatlich zur Stärkung der unteren Entgeltgruppen rausholen. Außerdem verlangten sie, die Vergütung für Nachwuchskräfte um 200 Euro anzuheben, sowie eine Erhöhung der Zeitzuschläge um 20 Prozent und die Einführung eines bundesweiten Tarifvertrags für studentisch Beschäftigte (TVStud), den es bisher nur in Berlin gibt. Gelandet ist man nicht bei sieben Prozent mehr Lohn, sondern bei 5,8 Prozent mehr, gestreckt über drei Etappen. Los geht es mit 2,8 Prozent zum 1. April 2026, gefolgt von zwei Prozent im März 2027 und schließlich einem Prozent im Januar 2028. Flassbeck hat die Kennzahlen „ganz primitiv“ heruntergebrochen und kommt, auf ein Jahr betrachtet, zunächst auf ein Plus von 2,57 Prozent. Da der „alte“ TV-L bereits am 31. Oktober ausgelaufen war und keinerlei rückwirkende Entschädigung vereinbart wurde, drückten „fünf Leermonate“ den Ertrag auf nur noch rund „zwei Prozent“. Bei einer stabil bleibenden Inflationsrate ebenfalls um den Dreh von mindestens zwei Prozent – im Januar waren es 2,1 Prozent [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/02/PD26_051_611.html?nn=2110] – deutet sich für Flassbeck an, wohin die Reise geht, „nämlich in Richtung null“. Absehbar werden die rund 925.000 Tarifangestellten sowie die 1,3 Millionen Landesbeamten und Versorgungsempfänger, auf die das Ergebnis übertragen wird, also bestenfalls so viel oder wenig Geld zur Verfügung haben wie bisher. Es geht noch pessimistischer, denn zur allgemeinen Teuerung kommen wahrscheinlich noch Mehrbelastungen durch drohende „Reformen“ etwa bei Gesundheit und Pflege. Letztlich müssen die Kolleginnen und Kollegen womöglich sogar Reallohnverluste schlucken. Operettenstreik Tatsächlich hatten die Gewerkschaften in den zurückliegenden Wochen durchaus beachtlich mobilisiert und öffentliche Verwaltungen, Kitas, Schulen, Unikliniken sowie Teile des öffentlichen Nahverkehrs bestreikt. Auffallend war jedoch die Tonlage vor der dritten Verhandlungsrunde, die sich in der Vorwoche vier Tage lang hinzog. Obwohl die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) bei den beiden vorherigen Gesprächsterminen kein konkretes Angebot vorgelegt hatte, war viel vom „wahrscheinlich entscheidenden“ Treffen die Rede und ver.di selbst rief im Vorfeld zur „letzten Druckwelle“ [https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/bunte-erste-wochenhalfte-verdi-kundigt-bundesweite-warnstreiks-an-15226550.html] auf. Die Gewerkschaften wollten augenscheinlich eine Einigung um jeden Preis. Eine vierte Runde, die selbst die TdL ins Spiel gebracht hatte, sollte wohl tunlichst vermieden werden, und Drohungen, bei einem Scheitern mit unbefristeten Ausständen die Schlagzahl zu erhöhen, gab es auch keine. Am Ende hat man ein maues Ergebnis erstritten, ohne von den echten Waffen Gebrauch zu machen. Für solche „Arbeitskämpfe“ gibt es einen treffenden Begriff: Operettenstreik. Das ist typisch für Deutschlands handzahme Gewerkschaften, die lieber die sogenannte Sozialpartnerschaft mit den Arbeitgebern hochhalten als entschlossen die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. Das kommt bei denen nicht gut an, wie sich an zahllosen Kommentaren auf der Facebook-Seite von ver.di zeigt. „Warum verkauft ihr das als Erfolg“, fragt ein User und ein anderer: „Hat es jemals bei Tarifverhandlungen so eine Beleidigung gegeben? Eine Erhöhung im letzten Monat der Laufzeit um ein Prozent! Wahnsinn!“ Jan meint, „dieser Tarifabschluss ist ein Desaster und wird euch viele Mitglieder kosten“. Positive Wortmeldungen finden sich praktisch keine, nur da, wo ver.di-Moderatoren die Wogen zu glätten versuchen. Nicole klagt: „Ich zweifele schon lange an Verdi und frage mich, wen vertretet ihr eigentlich noch. Aber jetzt habt ihr den Vogel abgeschossen.“ Und Ralf verkündet: „Sollte das Ergebnis angenommen werden, trete ich in den unbefristeten Streik gegen Verdi ein und spare mir bis zu einem gerechten Abschluss die Beiträge.“ Anschluss nicht gehalten Ohne Frage verbuchen die Gewerkschaften auch Punkte auf der Habenseite [https://oeffentlicher-dienst-news.de/tarifeinigung-im-oeffentlichen-dienst-der-laender/]. So setzten sie endlich die Hamburg-Zulage durch, einen eigenständigen Tarifvertrag für den Stadtstaat, der 100 Euro mehr für Beschäftigte mit Kundenkontakt und 50 Euro mehr für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst vorsieht. Nächstes Jahr steigen die Beträge auf 115 beziehungsweise 75 Euro. Zudem werden die Arbeitszeiten an den ostdeutschen Unikliniken Rostock, Greifswald und Jena schrittweise an die 38,5 Wochenstunden im Westen angepasst. Auch die Unkündbarkeit nach 15 Dienstjahren wird für alle Tarifbeschäftigten im Osten Anfang Januar 2027 Realität. Für Auszubildende gibt es 150 Euro mehr in drei Schritten: 60 Euro 2026 und 2027 sowie 30 Euro 2028. Und der Nachwuchs wird künftig nach erfolgreichem Abschluss wieder unbefristet übernommen. Aber gemessen an den Ausgangsforderungen und dem Hauptanliegen – sieben Prozent mehr Geld über zwölf Monate – sind das bloß kleinere Fortschritte für einzelne Gruppen, während das Gros der Beschäftigten mit einem kümmerlichen Plus abgespeist wird, das sich unter ungünstigen Bedingungen in ein Minus verkehrt. Haltbar ist nicht einmal die These von Ver.di-Chef Werneke, den „Anschluss an das Lohnniveau“ [https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/tarifrunde-oeffentlicher-dienst-laender-beschaeftigte-erhalten-58-prozent-mehr-geld-mindestens-100] im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen herzustellen. Die mit dem TVöD ausgehandelten 5,8 Prozent mehr Gehalt teilen sich in zwei Erhöhungsschritte (3,0 und 2,8 Prozent) und nicht in drei. Die Kolleginnen und Kollegen in Bund, Städten und Gemeinden gelangen also schneller und in größeren Schritten zu ihrer bescheidenen Besserstellung und sind damit eher davor gefeit, von der Preisentwicklung überholt zu werden. Ein Kommentator bei Facebook konstatierte: „Im Vergleich zum TVöD liegen wir beim Land circa 300 Euro zurück.“ Studentische Hilfskräfte bleiben prekär Abgespeist werden einmal mehr die studentischen Hilfskräfte an Deutschlands Hochschulen. Wie die NachDenkSeiten vor zwei Wochen hier berichteten [https://www.nachdenkseiten.de/?p=145811], kämpfen diese seit etlichen Jahren für einen bundesweiten Tarifvertrag (TVStud) nach Berliner Vorbild. Bei der TdL sind sie trotz anderslautender Ankündigungen abermals abgeblitzt. Ihre Mindeststundenlöhne werden im Rahmen der schon bestehenden „schuldrechtlichen Vereinbarung“ lediglich in zwei Stufen aufgestockt, auf 15,20 Euro zum Sommersemester 2026/27 und 15,90 Euro ein Jahr darauf. Erfahrungsgemäß werden die Vorgaben allerdings in großem Stil und systematisch unterlaufen, womit für die Betroffenen auch weiterhin gilt: „Jung, akademisch und (immer noch) prekär“ [https://www.verdi.de/gesundheit-soziales-bildung/mein-arbeitsplatz/hochschulen-und-forschungseinrichtungen/jung-akademisch-immer-noch-prekaer]. Wie die GEW mitteilte, seien in Bezug auf die Mindestvertragslaufzeit „zumindest Verschlechterungen abgewehrt“ worden. Dazu noch die Ansage: „Die 300.000 studentischen Beschäftigten werden wieder Teil der kommenden Tarifrunde der Länder!“ Übersetzt: In zweieinhalb Jahren dürft ihr wieder streiken – für so gut wie nichts. Bis zum 9. März können alle Gewerkschaftsmitglieder im TV-L über das Verhandlungsergebnis abstimmen. Am 12. März wird die zuständige Bundestarifkommission endgültig entscheiden. Die Hürden für eine Annahme sind gering, lediglich mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten müssen dafür votieren. Bei Unterschreiten der Marke müssten die Verhandlungen für gescheitert erklärt werden und sich anschließend wenigstens 75 Prozent für einen Erzwingungsstreik aussprechen. „Danke Verdi!“ Dietmar Breme vom „Netzwerk für eine kämpferische und demokratische ver.di“ ist restlos bedient. „5,8 Prozent in drei Schritten – 27 Monate Laufzeit“ [https://www.labournet.de/branchen/dienstleistungen/oedienst/tarif-und-besoldungsrunde-oeffentlicher-dienst-der-laender-2025/], schrieb er in einem Beitrag auf Labournet.de. „Und das bei steigenden Lebenshaltungskosten. Und das bei steigenden Mieten, steigenden Kosten für Heizung und Strom. Steigenden Preisen für Bus und Bahn. Steigenden Steuern. Danke Verdi!“ Das Einzige, was gehe in diesem Land, „sind zig Milliarden für Aufrüstung und Kriegsvorbereitung. Billionen für die Rüstungsindustrie. Milliarden für die Ukraine, damit das Sterben weitergeht“, so Breme. Das alles freilich geht nur mit Gewerkschaften, die sich nicht gegen Zeitgeist, „Zeitenwende“ und „Kriegsertüchtigung“ auflehnen, sondern stillhalten und mitmachen, sich der Propaganda von „leeren Kassen“ und „Sparzwängen“ unterwerfen und ihre Mitglieder verraten. Aber da geht noch mehr. Vor einem Jahr schloss die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit der Deutschen Bahn (DB) ab: Laufzeit 33 Monate [https://www.nachdenkseiten.de/?p=129061]. Ver.di und Co. kommen der Sache näher. Titelbild: fotandy/shutterstock.com[http://vg05.met.vgwort.de/na/433c115d4bdb49c5be070fc360b30a43]
Elige tu suscripción
Premium
20 horas de audiolibros
Podcasts solo en Podimo
Podcast gratuitos
Cancela cuando quieras
Empieza 7 días de prueba
Después $99 / mes
Empieza 7 días de prueba. $99 / mes después de la prueba. Cancela cuando quieras.