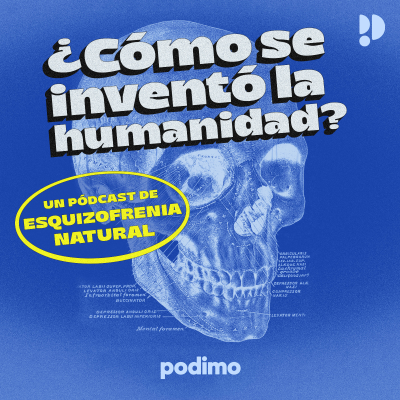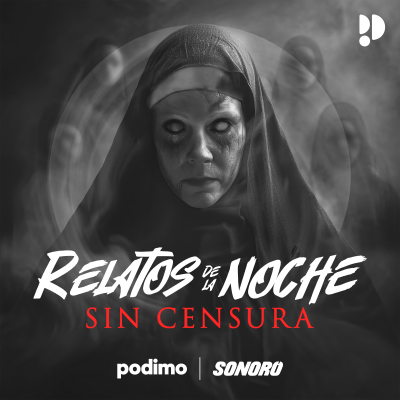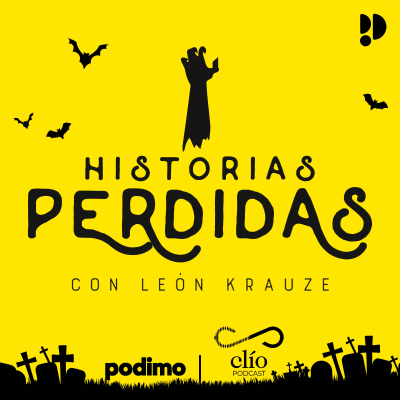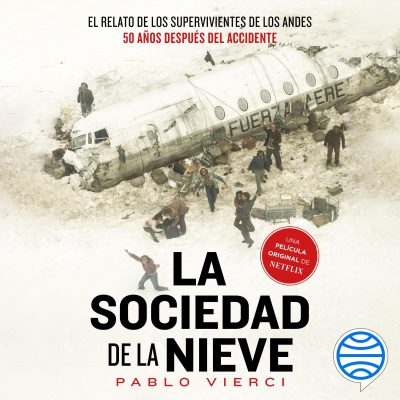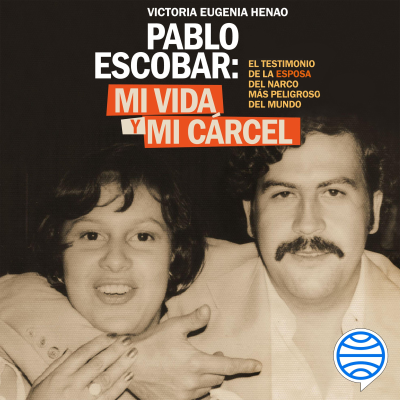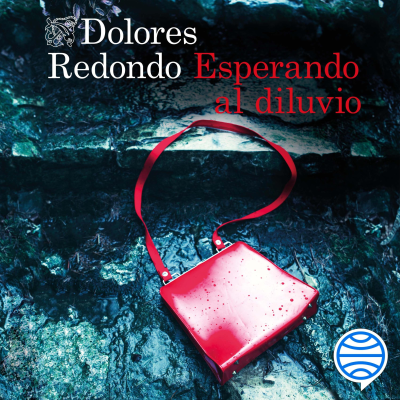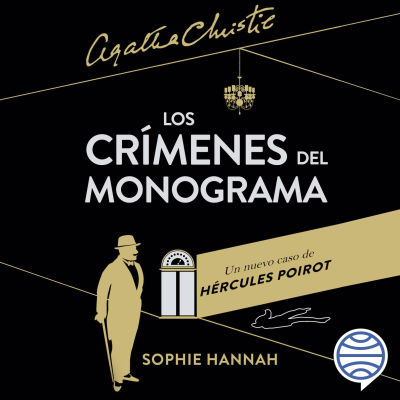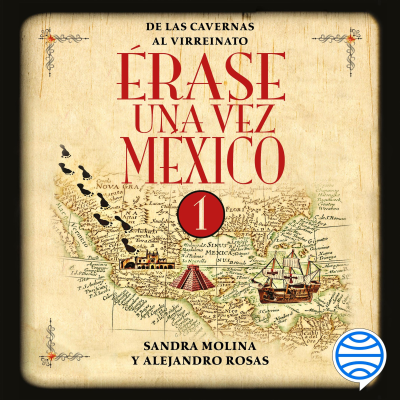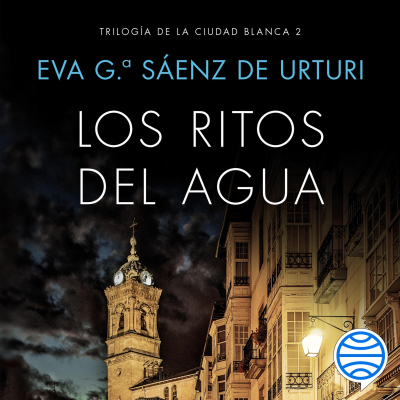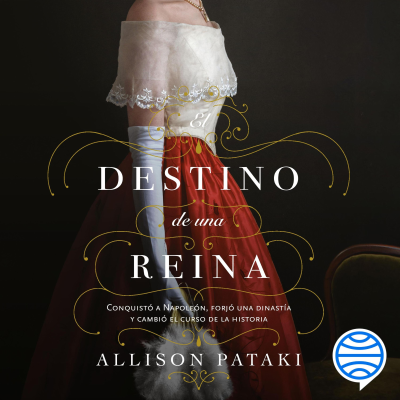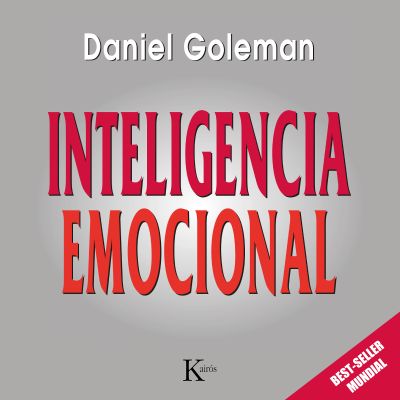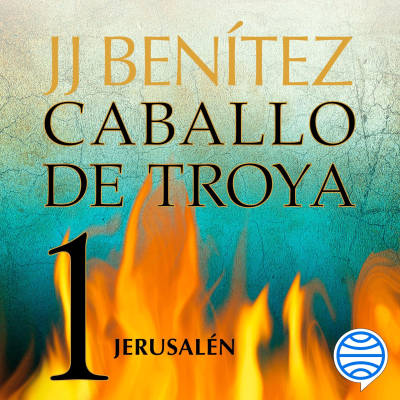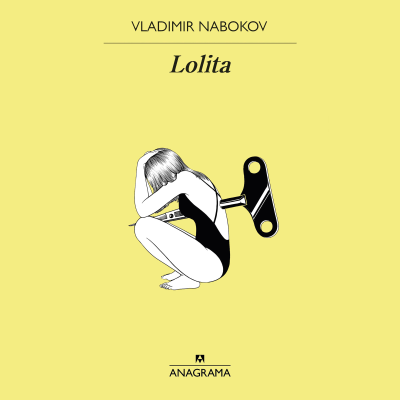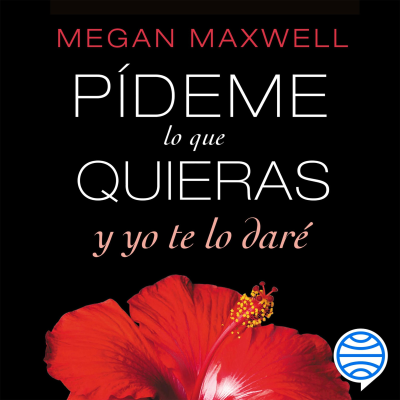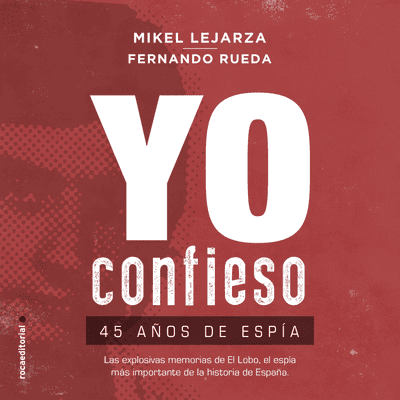Escuchar SWR2 Kultur Aktuell
Podcast de SWR
Welche Bücher sind neu, was läuft im Kino, wie sieht die Festivalsaison aus und worüber diskutieren Kulturwelt und Kulturpolitik? Im Podcast SWR Kultur Aktuell widmen wir uns täglich den Nachrichten, mit Hintergründen, Gesprächen, Kritiken und Tipps. Damit Sie nichts Wichtiges mehr verpassen! Zur Sendung in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/swr2-kultur-aktuell/12779998/
Empieza 7 días de prueba
$99.00 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
Todos los episodios
9366 episodiosMusik: „The Boys in the Backroom” (aus: “Der große Bluff“): „See what the boys in the backroom will have, and tell them, I’m having the same …” „The Boys in the Backroom“ war der Song zu einer Filmrolle, in der die glamouröse Diva Marlene Dietrich sich auch in Hollywood von ihrer komischen, ihrer Berliner Seite zeigen konnte. Das war Ende 1939, im Western „Der große Bluff“. > Guck einfach, was die Jungs im Hinterzimmer trinken, und sag ihnen: Ich seufze ... ich heule ... und ich sterbe von demselben Zeug. > > > Quelle: Reiner Burger – Marlene Dietrich an der Front Musik: s.o. „... Just see what the boys in the backroom will have, and tell them I sighed, and tell them I cried, and tell them I died of the same.” Wenige Jahre später sollte sie den Song wieder und wieder singen, vor immer neuen, sie bejubelnden US-amerikanischen Soldaten, die in Europa gegen die Achsenmächte kämpften. 1944 war Marlene Dietrich Teil der kulturellen Truppenbetreuung und absolvierte zwei wochenlange Tourneen in Italien und im umkämpften deutsch-belgischen Grenzgebiet. LEBEN MIT DEN „BOYS“, SCHLAFEN MIT DEN RATTEN Und sie schaute nicht nur für einen schnellen Auftritt in den Lagern und Lazaretten vorbei. Wie ihre Künstlerkollegen war Marlene offiziell Soldatin der US-Army im Rang eines Captain, sie teilte das Leben der Männer, die sie ihre „Boys“ nannte. Trug Khaki wie sie, aß mit ihnen Feldverpflegung, wusch sich mit Schneewasser, logierte in zerbombten Gebäuden voller Ratten. > Man liegt auf dem Boden in seinem Schlafsack, die Decke bis zum Kinn hochgezogen, und diese Biester rasen einem übers Gesicht mit ihren kalten Pfoten. Sie erschrecken einen zu Tode. Da man außerdem durch die Bomben in Angst und Schrecken versetzt wird, kann man sich fragen, was man bevorzugen soll: V1, V2 – oder die Ratten. > > > Quelle: Reiner Burger – Marlene Dietrich an der Front Diese Geschichte erzählt der FAZ-Journalist Reiner Burger kenntnisreich und lebendig im Bild-Text-Band „Marlene Dietrich an der Front“, und er erzählt sie nicht nur auf Basis historischer Quellen und Lebenszeugnisse, sondern auch anhand einer Fülle vielsagender Fotos aus Marlene Dietrichs Nachlass: die Schauspielerin posierend vor Panzern und auf provisorischen Bühnen, in Schürze vor der Feldküche, beim Eintopfessen mit Kommandeuren und, ein besonders eindrucksvolles Bild, vor Scharen von Fallschirmen, die während eines Manövers vom Himmel schweben. GUTE FIGUR AUCH IN FELDMONTUR Bis heute fasziniert die Ausstrahlung einer Frau, die in Feldmontur ebenso gute Figur machte wie im Paillettenkleid. Auf Schnappschüssen wie auf offenkundig gestellten Fotos wirkt Marlene immer zugleich selbstbewusst und authentisch. Von manchen der Fotos wird hier auch die Rückseite gezeigt, von ihr eigenhändig beschriftet während der letzten Lebensjahre in der Pariser Matratzengruft. Die Monate mitten im Krieg waren keine bloße Episode. Nicht nur für Marlene. KRIEGSMONATE, DIE DAS LEBEN PRÄGTEN Sich in der Nachkriegswelt zurechtzufinden, war die Herausforderung. Ihrem Freund Ernest Hemingway etwa gelang das wesentlich schlechter als ihr. Sie beide hatten die monatelange blutige Hürtgenwald-Schlacht in den Ardennen erlebt, sie als Truppenunterhalterin, er als Kriegsbericherstatter an vorderster Front. Was er zu ihr gesagt hatte, bevor er sich 1961 umbrachte, ließ sie nicht los. > Ich werde niemals seinen Satz, 'es war einfacher im Hürtgenwald‘ vergessen. > > > Quelle: Reiner Burger – Marlene Dietrich an der Front Die Schrecken des Krieges hatten ihn traumatisiert, und im Frieden kam er nicht klar. Marlene Dietrich zog eine andere Bilanz der Zeit, als sie nicht nur zur Stärkung der Moral ihrer „Boys“ unterwegs war, sondern auch im Dienst der Anti-Nazi-Propaganda des US-Geheimdienstes. Ihren Einsatz nannte sie wörtlich „das einzig Wichtige, was ich je getan habe.“ Zugleich war es der Wendepunkt ihrer Karriere, auch das wird in diesem lesens- und betrachtenswerten Buch deutlich. Die Erfahrung, live vor begeistertem Publikum aufzutreten, motivierte sie, Anfang der Fünfziger vom Film auf Gesangsshows umzusatteln. Zwanzig Jahre lang hatte sie phänomenalen Erfolg – mit den Songs, die sie für die Soldaten gesungen hatte. Aus “Marlene Dietrich speaks to American GI's during WW II”): „ …to a speedy victory. Good bye, good luck, godspeed.“
Temmis stehen für die Neue Neue Deutsche Welle zugeordnet - Musikerinnern und Musikern, die sich mit den Erfahrungen der Pandemie und dem beständigen Fluss düsterer Nachrichten auf den Sound der 1980er-Jahre beziehen und für ihre manchmal alltagsmüde Generation singen. Popmusik auf Deutsch hatte in der Vergangenheit ein eher schwieriges Image. Zu weichgespült, zu nah am Schlager gebaut, schnell auch ein bisschen schnulzig. In den letzten Jahren kommen aber immer mehr junge deutsche Musiker auf, deren deutschsprachige Musik anders ist. Die Neue Neue Deutsche Welle klingt nach 1980er-Synthesiser und düsteren Texten. Aber warum ist dieser Sound gerade jetzt so beliebt und was hat die Corona-Pandemie damit zu tun? Im Gespräch mit Roman Paetin und Alexander Schießl in SWR Kultur gehen wir auf Spurensuche in der Popmusik.
180 ARBEITEN VON 21 FOTOGRAFINNEN Eine riesige Weltkarte empfängt die Besucher im Kunstforum Ingelheim. Mit kleinen Flaggen sind die Länder markiert, die die rund 21 Fotografinnen, deren Arbeiten in der Ausstellung zu sehen sind, bereist haben, erklärt Kuratorin Katharina Henkel zum Konzept: „Zum einen haben wir die journalistische Fotografie, Fotoreportagen. Der zweite Themenblock sind dokumentarische Fotografien und der dritte ist die freie künstlerische Fotografie.“ Die subjektiven Eindrücke der Fotografinnen sind vielfältig und die Ästhetik der rund 180 Arbeiten aus rund 100 Jahren Fotografiegeschichte ist sehr unterschiedlich. Als eine der Pionierinnen des Reisejournalismus gilt Alice Schalek. Sie bereist bereits Anfang des 20. Jahrhunderts unter anderem Nordafrika, Ägypten und Indien. Fotografiert Straßenszenen, Tempel und Paläste, stets ausschnitthaft und mit ungewöhnlichen Details. So fällt auch mal eine Palme mitten durchs Bild, das um die hundert Jahre alt ist. AUFGESCHEUCHTE TAUBEN VERDECKEN DEN MARKUSDOM Die Österreicherin Inge Morath fing eigentlich als Texterin bei der Fotoagentur Magnum an. Durch Zufall entdeckte sie in den 1950er-Jahren ihre Liebe zur Fotografie auf einer Reise nach Venedig. Als gerade kein Fotograf zur Verfügung stand, sollte sie selbst Fotos machen. Dort habe sie aber eher die normalen Menschen, die sich in Venedig bewegen, fotografiert, erzählt Katharina Henkel: „Es gibt ein wunderschönes Foto von ihr. Da sieht man aufgescheuchte Tauben vor dem Markusdom.“ Tatsächlich wirken die Tauben in der speziellen Lichtsituation so dominant, dass man den Dom erst auf den zweiten Blick erkennt. Jeder, der einmal in Venedig war, sagt Katharina Henkel, habe sicher auch ein Taubenfoto zu Hause. Daher lädt sie auch alle Besucher dazu ein, ihre Lieblingsreisefotos mitzubringen, die dann in einem Extra-Raum ausgestellt werden. FOTOGRAFIEN VON LAND, LEUTEN UND PFLANZEN Dokumentarisch geht Herlinde Koebl vor. 2018 reiste sie mit einer Gruppe von Archäologen nach Turkmenistan. „Die haben sich dort Objekte angeschaut für ein Ausstellungsprojekt“, erzählt Katharina Henkel. „Entstanden sind Fotografien von Land und Leuten.“ Augenfällig sei die Gegenüberstellung einer kleinen Terrakottafigur und einer jungen Frau auf einem der Fotos – beide weisen die gleiche Art der Haartracht auf. Die jüngsten künstlerischen Arbeiten sind von Anne Schönharting: Kakteen, die sich den Weg aus den Pflastersteinen kämpfen. Altarblumen, deren Zeit bald abgelaufen ist. „Sie ist 2024 im Herbst nach Hongkong gereist und hat dabei Pflanzen entdeckt. Und festgestellt, wie schwer das Überleben in Großstädten für Pflanzen ist. Die Pflanzen sind in einem sanften Licht getaucht und tagsüber gehen ganz viele Menschen vorbei und erhören diesen Überlebenskampf nicht.“ Durch diese Fotos motiviert die Ausstellung „Neugier, Mut und Abenteuer“ im Kunstforum Ingelheim ganz sicher die Besucher, bei ihrer nächsten Reise erst beim zweiten – dem ungewöhnlicheren Blick - auf den Auslöser zu drücken.
EDWIN ROSEN BENANNTE UNGEWOLLT EINE NEUE MUSIKALISCHE BEWEGUNG Er hat die Musikströmung quasi aus Versehen benannt: Der Stuttgarter Musiker Edwin Rosen. Beim Streaming-Dienst Spotify hatte er seine Musik als „neueneuedeutsche Welle“ beschrieben. Mittlerweile ist das zur Bezeichnung für eine ganze Bewegung von neuen jungen Musikern und Bands geworden. Sie alle verbindet das Singen von deutschen, meistens düsteren Texten. Und ein Sound, der an die Neue Deutsche Welle aus den 1980ern erinnert. DIE NDW-MUSIKER DER 80ER HATTEN NICHT DIE GROSSEN TONSTUDIOS Wie der damals entstanden ist, weiß Derek von Krogh, künstlerischer Direktor der Popakademie Baden-Württemberg: „Das, was die NDW damals ausgezeichnete war eine Antihaltung, aber auch technische Limitierungen, ganz massiv. Die Leute, die mit dieser Antihaltung ankamen, die hatten einfach nicht die großen Tonstudios.“ Unter diesen Bedingungen entstand in den 1980ern ein eher piepsig-kratzender Sound, der sich auch gut mit den billigeren Synthesizern produzieren ließ. So zum Beispiel bei Peter Schilling [https://www.swr.de/swr1/rp/leute/swr1-leute-mit-peter-schilling-musiker-100.html]s „Major Tom“. DER SOUND VON NNDW IST EINE BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG Aber warum wollen junge Musiker heute wieder so klingen? Im Jahr 2025 braucht niemand mehr große Tonstudios, um Musik zu machen. Wer zuhause am Laptop produziert, hat unendliche Möglichkeiten und kann erstmal genau so klingen wie er oder sie will. Der Sound der Neuen Neuen Deutschen Welle ist also eine bewusste Entscheidung. Und sie scheint nach einem bestimmten Rezept funktionieren, sagt Derek von Krogh: „Erstens auf jeden Fall: maschineller Beat. Zweitens: Achtel. Drittens: eine Gitarre die relativ clean ist, aber im Chorus ersäuft, dieser schwebende, atmosphärische Sound. Und dann ein Gesang mit einer Attitüde und einer sehr kleinen Range von Tonsprüngen. Wenn man das mit diesen vier Zutaten macht, dann landet man in diesem Vibe. MAL ELEKTRONISCH UND HART, MAL SOFT UND VERTRÄUMT Der Song ICE 579 der Band Temmis zeigt aber auch: Musik-Strömungen und ihre Künstlerinnen und Künstler lassen sich nicht in zu enge Boxen packen. Mal klingt die Neue Neue Deutsche Welle, kurz NNDW, elektronisch und hart, mal eher soft und verträumt. Aber eines verbindet die Musiker. Es ist das Selbermachen, das Selbst-in-die-Hand-Nehmen, sagt Temmis- [https://www.swr.de/swrkultur/musik-jazz-und-pop/die-neue-neue-deutsche-welle-die-band-temmis-im-gespraech-100.html]Sänger Roman Dick: „Generell ging es bei dem Aufkommen der NNDW um einen DIY Charakter. Es ging darum, nicht so zu sein wie der Mainstream. Am Anfang ging es darum, etwas anderes zu machen als das, was gerade in Deutschland populär ist. Was man einfach besser findet oder was mehr so die wirkliche Gefühlslage von vielen jungen Leuten oder von einem selber anspricht.“ TEXTE DER NEUEN NEUEN DEUTSCHEN WELLE: DÜSTER, DIREKT, ABSURD ABSTRAKT Die Gefühlslage einer Generation, die während der Corona-Pandemie viel Zeit isoliert in ihren Schlafzimmern verbracht hat und die auch momentan nicht viele positive Nachrichten zu hören bekommt. Auch der Musiker Edwin Rosen nimmt diese allgemeine Erschöpfung wahr: „Viel ist durch so eine Alltagsmüdigkeit und eine Ausweglosigkeit geprägt. Es wirkt alles so ein bisschen schwer. Und ich glaube, das ist leider auch die Stimmung von vielen Leuten in der aktuellen Zeit.“ Ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das ähnlich wie der Sound der NNDW, auch an die politische Situation der 1980er erinnert. Die Texte der Neuen Neuen Deutschen Welle sind oft düster, direkt und manchmal schon fast absurd abstrakt. Es geht viel um Herzschmerz, Eskapismus und das Gefühl, die Welt nicht mehr aushalten zu können. Aber auch um die Flucht ins Nachtleben, wie in diesem Song von nand: ABGRENZUNG VON DEN DEUTSCHPOETEN MIT TEXTEN ÜBER DAS GUTE LEBEN Mit diesem Stil grenzen sich die jungen Musiker ganz klar von den Deutschpoeten ab, die vor der Pandemie hauptsächlich die schöne Liebe und das gute Leben besungen haben. Und über die sich Entertainer Jan Böhmermann 2017 im Stück „Menschen, Leben, Tanzen, Welt“ ein wenig lustig gemacht hat. Dass diese Art von Musik in einer Zeit voller Krisen nicht mehr besonders gut ankommt, wundert den künstlerischer Direktor der Popakademie Baden-Württemberg Derek von Krogh nicht: „Unverbindlichkeit ist gerade nichts, was gefragt ist. Und verbindlich ist mit Deutschpoetentum schwierig, aber mit NNDW sehr einfach.“ DEUTSCHE TEXTE AKTUELL AUCH IM MAINSTREAM-POP SEHR ERFOLGREICH Verbindlichkeit schaffen auch die Texte auf Deutsch, die eben nicht vom Leben in New York oder London handeln, sondern von dem junger Menschen in Leipzig oder Tübingen. Ein Blick in die Charts zeigt: Deutsche Texte sind zur Zeit auch im Mainstream-Pop sehr erfolgreich. Aber die Neue Neue Deutsche Welle ist mehr Punk als Pop. Sie ist kein geplantes Werk der Musikindustrie. Sondern die Reaktion auf eine Welt, die viele junge Menschen gleichzeitig rastlos und müde macht.
BÜHNENVERSION DES KOMPLEXEN ROMANS VON FATMA AYDEMIR Es ist ein trauriger Anlass, der die vier Geschwister zusammenkommen lässt. Ihr Vater Hüseyn ist gestorben. Nach einem harten Arbeitsleben hatte der Frührentner eine Wohnung in Istanbul gekauft und plötzlich einen Herzinfarkt bekommen. Nun stehen sie da und stellen mit einer Mischung aus Bestürzung, Wut und Schmerz fest, wie viele Leerstellen es in ihrem Leben gibt, was alles verschwiegen, verdrängt wurde. In drei Monaten ist die Bühnenversion des sehr komplexen Romans von Fatma Aydemir gewachsen im ständigen Austausch von Ensemble und Regisseurin. Eine intensive Zeit, in der Text und persönliche Erfahrungen der Spielenden miteinander abgeglichen wurden. VIER JUNGE MENSCHEN BRINGEN „DSCHINNS“ AUF DIE BÜHNE „Ich glaube der Roman spricht einfach für eine postmigrantische Generation von Menschen, die in Deutschland aufwachsen“, sagt Yeşim Nela Keim Schaub, „und für mich ist besonders interessant an dieser Arbeit, dass eben diese Menschen auch auf der Bühne stehen. Und dass wir versucht haben, uns diesen Stoff auf eine Art und Weise anzueignen, um die spezifischen Erfahrungen, die wir auch teilen, die wir in dem Roman finden, zu erzählen und spürbar und greifbar zu machen.“ Vier junge Menschen bringen das Erzähltheater „Dschinns“ auf eine schlichte, nur mit weißer Folie ausgelegte Bühne. Keine Profis, sondern Laien, die sich für das Theater begeistern und entsprechende Spielerfahrung mitbringen. Seit einiger Zeit bereits arbeitet das Junge Ensemble intensiv mit Laien zusammen, vorrangig in gemischten Produktionen. Dabei geht es um die in der Kinder- und Jugendtheaterszene viel diskutierte Frage: Wer darf welche Geschichten erzählen? DIE GESCHICHTEN DER ELTERN UND GROSSELTERN „Der Gedanke dahinter ist gar nicht mal vorrangig, dass es Laienspielende sind, sondern dass wir sehr junge Menschen auf die Bühne stellen wollten“, erklärt die Intendantin des JES, Grete Pagan. „Wir wollten gern ein Projekt machen mit und für junge Menschen. Und auch gerne mit jungen Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, die in dritter, zweiter, vierter Generation in Deutschland leben und mit den Geschichten ihrer Eltern und ihren eigenen, ihrer Großeltern alltäglich zu tun haben und was das in unserer Gesellschaft bedeutet.“ Die Produktion hat denn auch Mohammed Amin Zariouh gleich fasziniert. Sein Opa sei als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, erzählt er, das mache die Geschichte gleich persönlicher. Der 22-Jährige studiert Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg und ist damit – wenn man so will - der „Halb-Profi“ im Team, der den ältesten Sohn in der Familie Hakan mimt. HADERN MIT RASSISMUSERFAHRUNGEN UND FAMILIENGEHEIMNISSEN „Mir war es wichtig, Hakan nicht mit Klischees zu füllen, die man vielleicht von anderen Hakans so hat in Deutschland“, erzählt er, „und Hakan eine Zärtlichkeit zu geben, die erst einmal gar nicht so da ist. Ich habe Hakan begriffen als großen Bruder, der mit dem Tod seines Vaters begreift, dass er der große Bruder ist und für den Zusammenhalt in der Familie eine Verantwortung trägt.“ Es sind komplexe Figuren, die in diesem Stück mit ihrer Geschichte, mit Rassismuserfahrungen, Identitätsfragen und Familiengeheimnissen hadern. Eine Herausforderung für die Besetzung, der einiges abverlangt wird. Denn die vier jungen Menschen spielen nicht nur die sehr unterschiedlichen Geschwisterkinder, sie schlüpfen manchmal sogar nahtlos in die Rollen der Eltern. Ein notwendiger Perspektivwechsel, um allen Facetten der Erinnerung gerecht zu werden, meint Regisseurin Yeşim Nela Keim Schaub, „um der Geschichte auch eine Komplexität zu geben, die sonst nicht so gezeigt wird. Ich glaube, dass diese Personen, sehr unterschiedlich sind und diese Komplexität auch verstehen und in ihren eigenen Familien mit sich tragen.“
Empieza 7 días de prueba
$99.00 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
Podcasts exclusivos
Sin anuncios
Podcast gratuitos
Audiolibros
20 horas / mes