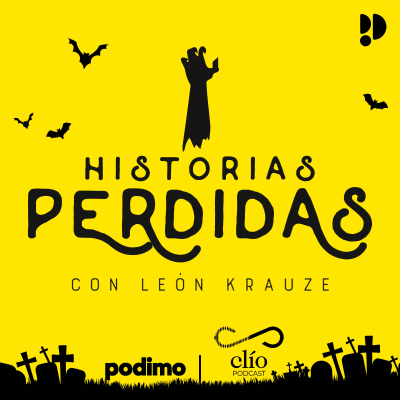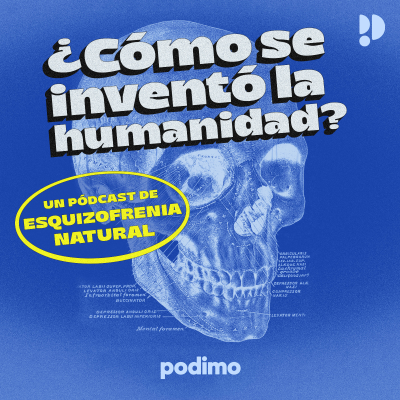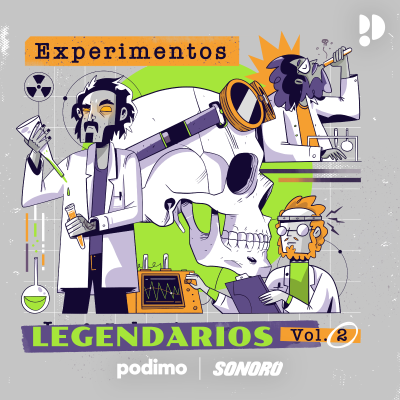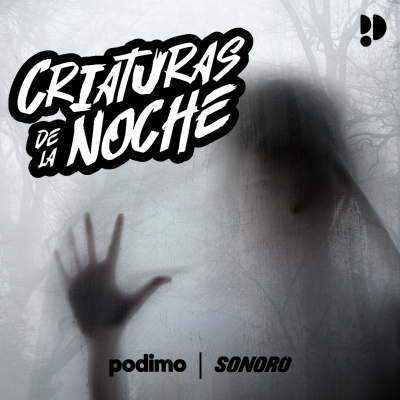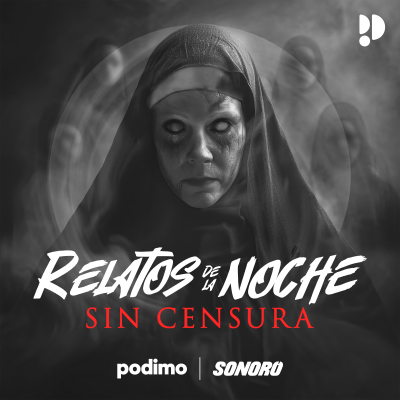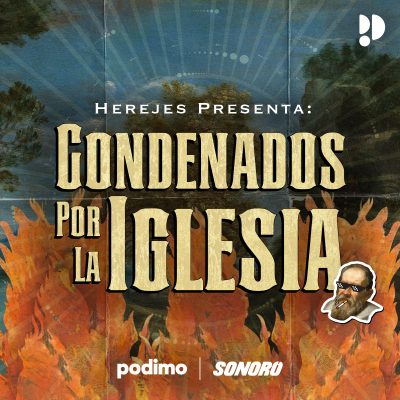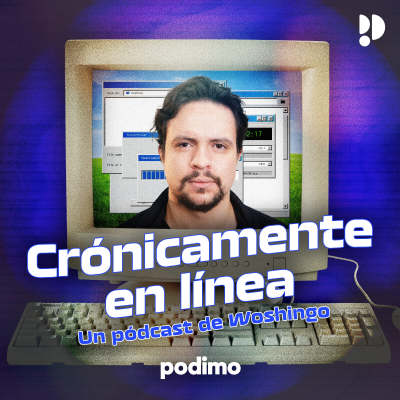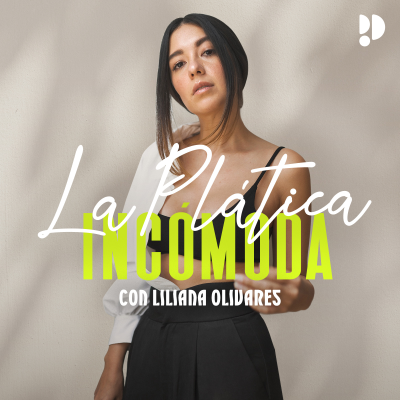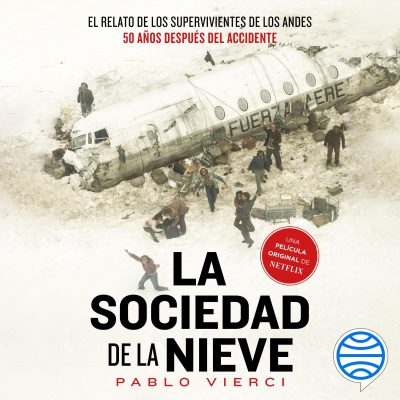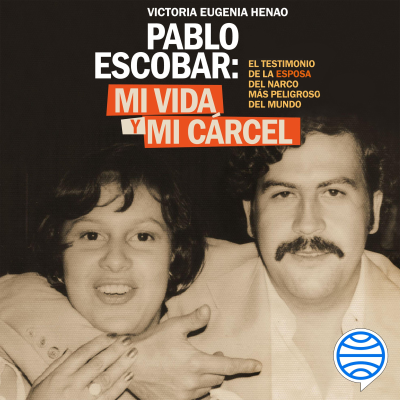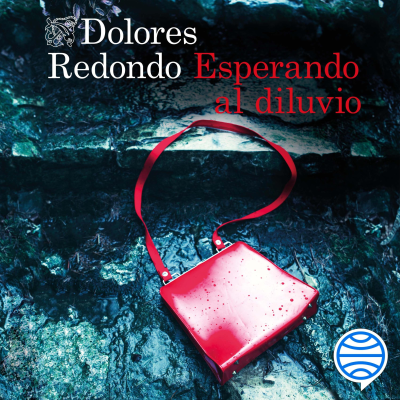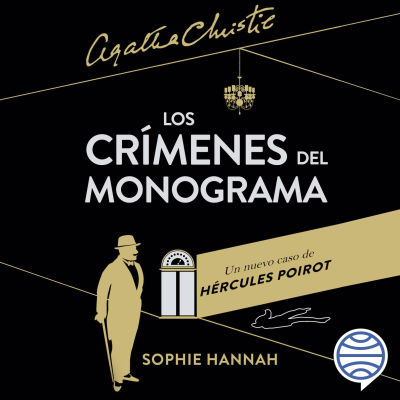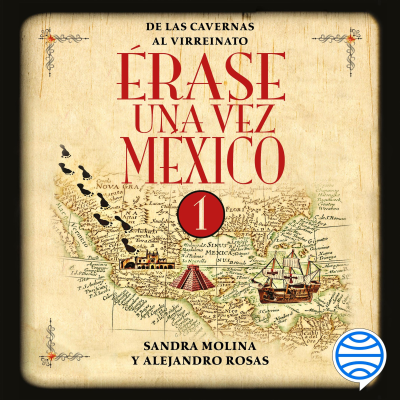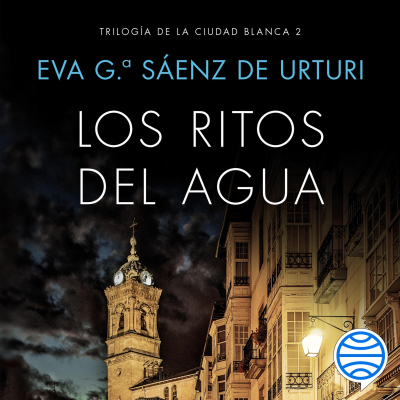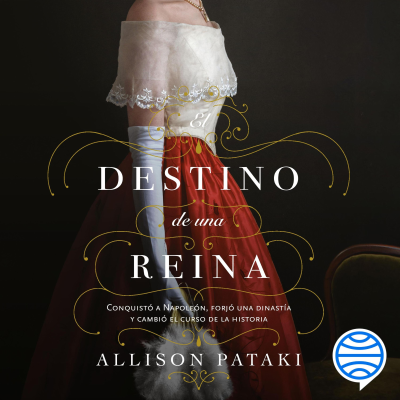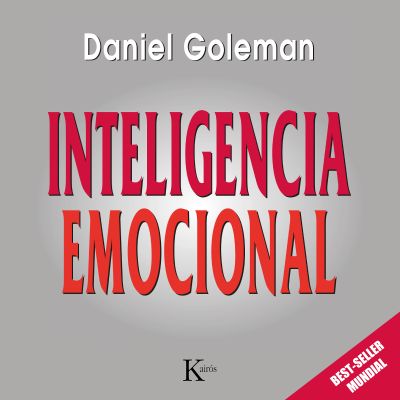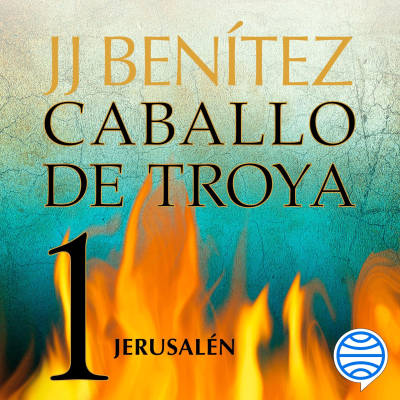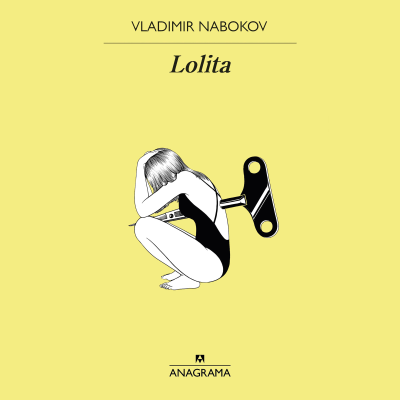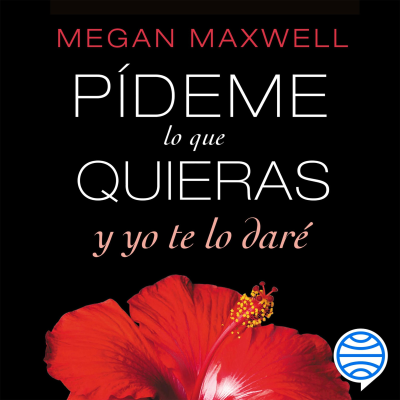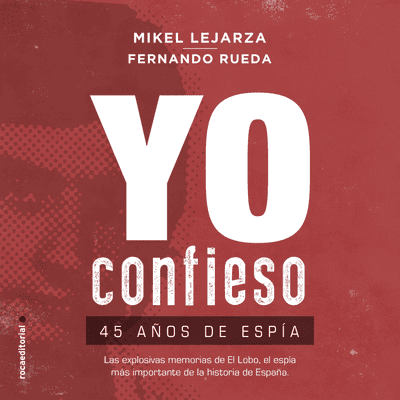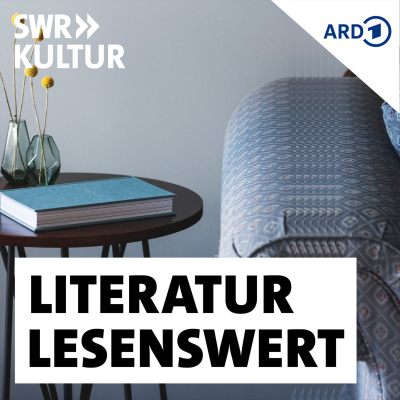
SWR Kultur lesenswert - Literatur
alemán
Cultura y ocio
Empieza 7 días de prueba
$99 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
- 20 horas de audiolibros al mes
- Podcasts solo en Podimo
- Podcast gratuitos
Acerca de SWR Kultur lesenswert - Literatur
Die Sendungen SWR Kultur lesenswert können Sie als Podcast abonnieren.
Todos los episodios
5463 episodiosGegen den Judenhass. Der Rapper Ben Salomo kämpft gegen Antisemitismus an deutschen Schulen
Seit 2019 hat der Berliner Rapper Ben Salomo über 500 Schulen in ganz Deutschland besucht, um über Antisemitismus zu sprechen. Dabei traf der gebürtige Israeli, der als Kind nach Deutschland kam, auf überraschend viel Unkenntnis: „Wenn ich an die Schulen komme, und sage: Weiß denn jemand von euch, wie viele Jüdinnen und Juden ermordet wurden, von den Nazis, dann passiert es oft, dass da Leute herumraten. Es ist vielleicht bei einem Drittel der Schulen, wo die Leute wissen, dass es sechs Millionen sind.“ OFFENE JUDENFEINDLICHKEIT AN DEUTSCHEN SCHULEN Weil er auf seine Frage nach der Opferzahl einmal die frech grinsende Antwort: „Ich biete sechs Millionen!“ erhielt, hat Ben Salomo seinem Buch den Titel „Sechs Millionen – wer bietet mehr?“ gegeben – und die Unterzeile „Judenhass an deutschen Schulen“. Denn der Rapper erfährt auch reichlich Ablehnung. Vor allem, wie er schreibt, von „mehrheitlich muslimischen Schülern mit Migrationshintergrund“ und „biografiedeutschen linken Schülern, die sich manchmal schon äußerlich, mit der Kufiya, dem ‚Palästinenser-Tuch', als Verbündete von Palästinenser-Positionen zu erkennen geben“. So feindlich ist die Stimmung, dass ein Moderator, der Ben Salomo regelmäßig in die Schulen begleitet, ans Aufhören denkt. Ben Salomo kann das verstehen: „Der Kampf gegen Antisemitismus ist manchmal sehr belastend. Ich bin ein ziemlich resilienter Mensch, aber ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass auch mich das hie oder da, besonders nach dem 7. Oktober, stark mitgenommen hat. Vor allem, weil ich mir vor Augen halte: Diese Menschen sind hier, die werden erwachsen, die werden hier Politik beeinflussen können in Zukunft, die öffentliche Meinung prägen.“ DEUTSCHE OBSESSION MIT ISRAEL In Deutschland habe die Israelkritik nicht nur an Schulen oft obsessive Züge, findet Ben Salomo. Er hat eine Vermutung, weshalb das so ist. „Einer der Hauptgründe, warum wir gerade in Deutschland diese große Zahl an leidenschaftlichen Israelkritikern haben, hat damit zu tun, dass es die individuelle Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der eigenen Familie nie als Massenbewegung gegeben hat. Und auf Basis dieser nicht ausreichenden Aufarbeitung gibt es dann diesen Umweg, der sagt: Na ja, aber wenn ich jetzt Israel sehe, das, was Israel mit den Palästinensern macht. Das ist ja das gleiche, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Dann ist das eine Entlastung.“ NÖTIGE ÜBERARBEITUNG DER LEHRPLÄNE Ben Salomo fordert jedoch nicht nur, dass Schüler sich intensiver mit der Geschichte des europäischen Antijudaismus auseinandersetzen. Auch der historische Einfluss der NS-Ideologie auf den arabischen Raum müsse im Lehrplan vorkommen: die enge Kollaboration von Mohammed Amin al-Husseini, dem Großmufti von Jerusalem, mit dem NS-Regime. „In Deutschland wissen nur ganz wenige Menschen, dass der Mufti von Jerusalem auf Arabisch Nazipropaganda in die ganze Welt ausgestrahlt hat. Dieser Radiosender, das war das TikTok seiner Zeit, das Al-Dschasira seiner Zeit.“ Al-Husseini war der politische Ziehvater des „Palästinenserführers“ Jassir Arafat, dessen Anhänger sich mit der Kufiya schmücken. Bis heute berufen sich Hamas- und andere Terroristen im Nahen Osten auf den Nationalsozialismus. Sie lesen „Mein Kampf“, zeigen den Hitlergruß und tragen Hakenkreuz-Tattoos. DIE ZUKUNFT DES JÜDISCHEN LEBENS IN DEUTSCHLAND Wenn es auch in Zukunft jüdisches Leben in Deutschland geben soll, dann ist es höchste Zeit, Antisemitismus entschiedener zu bekämpfen. Ben Salomo, der ein imponierend klares und geradliniges Buch geschrieben hat, sagt dazu: „Ich bin Betroffener, seit meinem ganzen Leben. Der Antisemitismus jagt meine Familie seit Jahrhunderten. Ich bin ein Überlebender, in der Linie meiner Familie. Jetzt bin ich wieder in einer Generation, wo der Antisemitismus wieder so hoch ist wie zu Zeiten meiner Großeltern. So fühlt sich das an. Das ist der reine Existenzkampf.“
Der Tod des Beamten
Robert Menasse hat als Schriftsteller eine echte Marktlücke entdeckt: die Pro-EU Prosa. In mehreren Essays und zwei umfangreichen, mit Preisen ausgezeichneten Romanen hat er den Bürokratiekoloss mit literarischem Herzblut zu erwärmen versucht. Auch Franz Fiala, die Hauptfigur seiner Novelle „Die Lebensentscheidung“, ist Beamter in Brüssel. Er hat in einer Unterebene der Generaldirektion Umwelt am Green Deal mitgearbeitet und war nicht zuletzt an der Ausformulierung der Honigrichtlinie beteiligt. Werte zu verbindlichen Normen machen – das ist die Devise, die bei den Bürgern aber zunehmend auf Ablehnung stößt: EU ist für viele gleichbedeutend geworden mit Verbotspolitik, Überregulierung und bürokratischer Dysfunktionalität. FRUST IN BRÜSSEL Fiala setzen sie zu, die Nationalisten, Populisten und Wutbürger, die Traktorendemonstrationen oder diese ständigen Sticheleien sogar auf Familienfeiern: „Franz schenkte nach – und musste sich zurückhalten, die Flasche zu schütteln und dem Onkel den Champagner ins Gesicht zu spritzen, in dieses blöde, vor vertrottelter Heiterkeit glänzende, selbstverliebte Gesicht. Fritz sagte nämlich: Na, Herr Eurokrat, erzähl! Was heckt ihr gerade wieder aus in Brüssel?“ Fiala hält den Gegenwind nicht mehr aus – und gibt damit wohl auch die politische Enttäuschung des EU-Enthusiasten Robert Menasse zu erkennen. Frustriert trifft der Beamte eine „Lebensentscheidung“: Vorruhestand mit Ende Fünfzig. Er möchte reisen, lesen, vielleicht endlich seine Freundin Nathalie heiraten. Und sich mehr um seine alte, an Alzheimer erkrankte Mutter kümmern, die in Wien noch in der Wohnung lebt, in der er aufgewachsen ist. EINE SYMBIOTISCHE BEZIEHUNG Ihre Verbindung ist immer eng, fast symbiotisch gewesen, auch wenn ihm das oft ein bisschen peinlich war. Sein Vater starb früh; die Mutter hat ihre Bildungsambitionen auf Franz übertragen. Von Mutterliebe getragen, vom Mutterehrgeiz angeschoben, hat er Jura studiert und Karriere in Brüssel gemacht. Franz ist ihr ganzer Stolz; in ihrer Verwirrtheit glaubt sie manchmal sogar, dass er der persönliche Berater der EU-Präsidentin sei. Das Schicksal aber macht einen Strich durch die schönen Ruhestandspläne. Fiala erkrankt an Bauchspeicheldrüsenkrebs; ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Und an diesem Punkt wird die Novelle sehr existentiell und anrührend. VERSTECKSPIEL OHNE ERFOLG Sohn und Mutter Fiala versuchen fortan angestrengt, ihre Hinfälligkeit voreinander zu verbergen, ohne den anderen wirklich täuschen zu können. So auch in dieser Szene: „Er beobachtete seine Mutter, bewunderte ihre Anstrengung, selbstbewusst, geradezu herrisch zu wirken, während sie so elendiglich in ihrem Fauteuil saß. Sie beobachtete ihren Sohn, sah mit Sorge, wie er schwer atmete, so dass er manchmal geradezu leise stöhnte.“ > Du bist krank, sagte sie. Was hast du? > Nichts. Es geht mir gut. > > > Quelle: Robert Menasse – Die Lebensentscheidung Noch erleben zu müssen, wie er, der einzige Sohn, vor ihr stirbt – das kann Franz seiner Mutter nicht zumuten. Es gilt durchzuhalten, wenigstens ein paar Tage länger als die Mutter. VORBILD FRANZ WERFEL Dieses Grundmotiv hat Menasse aus Franz Werfels Novelle „Der Tod des Kleinbürgers“ übernommen. Dort heißt der schwer kranke Held ebenfalls Fiala: ein kleiner Beamter, der für seine Familie eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, die aber nur ausgezahlt wird, wenn er das fünfundsechzigste Lebensjahr erreicht. Von den ersten Schmerzattacken über die siebenstündige Operation und die nachfolgenden Komplikationen bis zum finalen Zusammenbruch schildert Robert Menasse Fialas Krankheit zum Tode mit beklemmenden Details, in einer Sprache, die nicht nur berichtet, sondern Verstörung, Panik und die kleinen Schübe der Hoffnung auch formal abbildet. Falls eine EU-Norm für unter die Haut gehende Prosa in Planung sein sollte – bei dieser Novelle könnte sie Maß nehmen.
Vertraglich verbriefte 60-Stunden-Woche
Hu Anyan hatte 19 verschiedene Jobs. Er war Kurierfahrer, Warensortierer, Eisverkäufer und Tankwart. Er arbeitete im Copyshop, in Imbissbuden, bei der Security und hatte auch mal selbst einen Laden für Damenbekleidung. In verschiedenen chinesischen Städten und innerhalb von nur zwei Jahrzehnten. Darüber hat er ein Buch geschrieben: „Ich fahr Pakete aus in Peking“ heißt es sehr sachlich, und genau so ist es auch verfasst: als die Chronik eines Arbeiterlebens, das vor allem darin besteht, von der ersten bis zur letzten Seite tonnenweise Waren zu verschieben. EINSAMER MALOCHER STATT HELD DER ARBEIT 300 Millionen Wanderarbeiter gibt es in China. Vielleicht wurde Hus Buch auch deshalb ein Megaseller. Und weil er keinen glühenden Helden der Arbeit bietet, wie das im Sozialistischen Realismus sehr lange üblich war. Hu ist eher der Typ einsamer Malocher. Einmal arbeitet er als Paketsortierer. Das Logistikzentrum ist enorm, etwa zehn Fußballfelder groß. Ständig fahren LKWs die Halle an und liefern Waren, die dann von über hundert Gabelstaplern entladen und zu den Sortierteams gebracht werden. > Ich arbeitete die Nachtschichten, jeden Abend von sieben Uhr bis um sieben Uhr morgens, mit zwei freien Tagen im Monat. […] > > > Quelle: Hu Anyan – Ich fahr Pakete aus in Peking „Beim sogenannten „Vorstellungsgespräch“ ging es nur um Formalitäten, eigentlich wurde niemand abgelehnt, aber bevor man eingestellt wurde, musste man drei Tage ohne Lohn Probe arbeiten,“ erklärt Hu in seinem Buch. „Das entsprach wahrscheinlich nicht dem „Arbeitsrecht“, aber ich hab mich erkundigt, alle Firmen im Logistikpark haben das so gemacht. Wer damit nicht klar kam, hat den Job eben nicht bekommen.“ DEPRESSION DURCH ÜBERARBEITUNG Seine Arbeitsodyssee erzählt Hu Anyan ohne große Aufregung, auch wenn es ihm zwischenzeitlich ziemlich schlecht geht. Er lebt in einfachen Unterkünften, schläft manchmal sogar hinter der Ladentheke und muss trotzdem spitz rechnen. Oft scheint es, als würde Hu sein eigenes Leben kaum spüren. Vielleicht hat er zwischen den Schichten auch einfach keins. Sein Lebensbericht wirkt eher wie ein zwei Jahrzehnte langer Lieferschein. Vertraglich verbrieft ist ihm eine 60-Stunden-Woche, doch meistens werden daraus eher 72 Stunden. Mit der Zeit merkt er, dass er immer reizbarer wird, langsamer denkt und viel vergisst. Hus Schilderung von Einsamkeit, Verrohung und schließlich Depression durch Überarbeitung macht dieses Buch zu einem atemberaubenden Dokument. Auch der Glaube an den staatlich propagierten Fortschritt kommt ihm abhanden. AMERIKANISCHE SCHRIFTSTELLER ALS STÜTZE Was Hu Anyan hilft: in seiner knappen Freizeit lesen und schreiben. Am liebsten liest er amerikanische Autoren wie Salinger, Carver, Yates und Capote. „Mich faszinierte, dass die Art und Weise, wie im amerikanischen Realismus das Leben und die Gefühle beschrieben wurden, auch in mir Widerhall fand,“ schreibt Anyan. „Das lag wahrscheinlich daran, dass Konsum und die Warengesellschaft auf der ganzen Welt zunehmend Einfluss gewannen und menschliche Erfahrungen immer mehr homogenisierten.“ > Je mehr literarische Werke ich las, desto distanzierter fühlte ich mich von meiner eigenen Realität. > > > Quelle: Hu Anyan – Ich fahr Pakete aus in Peking SEHR GEGENWÄRTIGE, BLOGSPRACHLICHE ÜBERSETZUNG Vielleicht hat der Arbeiter Hu Anyan bei den amerikanischen Autoren gelernt, dass Literatur rau sein darf. Fakten statt Metaphern. Hus ungeschliffene Ehrlichkeit jedenfalls trifft auch deutsche Leserinnen und Leser direkt ins Herz. Darin ist sie den Malocher-Interviews von Liao Yiwu und den Gedichten der Wanderarbeiterin Zheng Xiaoqiong [https://www.swr.de/kultur/literatur/zheng-xiaoqiong-erzaehlung-von-den-konsumguetern-100.html] seelenverwandt. Zugleich ist Hus Bericht aber mehr Ich-Chronik, dem übrigens auch Monika Lis sehr gegenwärtige, blogsprachliche Übersetzung herausragend Rechnung trägt. Hus Unmittelbarkeit durchstößt die glänzende Oberfläche einer journalistischen Berichterstattung, in der wir China nur als ökonomische Megapower bestaunen. Sie ist durch und durch menschlich.
Versteinerung und Todeshauch: Philipp Theisohn über Conrad Ferdinand Meyer
SUBVERSIVES IM WERK VON C.F. MEYER Wer hätte diesem Stoff so viel Spannung zugetraut? Einer Studie über Conrad Ferdinand Meyer, dessen Dichtungen im Regal doch mittlerweile oft, nun ja, eher vor sich hinstauben? Philipp Theisohn gelingt das. Denn er zeigt das Radikale im Werk von Conrad Ferdinand Meyer, das Subversive in den oft so steril wirkenden Gedichten und Novellen des Schweizer Schriftstellers. Philipp Theisohn deutet dieses Werk als Abgesang, als Verabschiedung jener Kunstauffassung des 19. Jahrhunderts, die bei Goethe beginnt und noch den jungen Meyer in Zürich umhüllt wie ein Zwangskorsett: dass echte Literatur dem Leben abgewonnen wird. Dass der Roman das wahrhaft Erlebte einfängt – und so den Lesern selbst ins Leben hilft. VERSTEINERTE FIGUREN: EINE STILISIERTE KUNSTWELT Conrad Ferdinand Meyer macht genau das Gegenteil. Nicht Erlebnisse interessieren ihn. Seine Figuren wirken leblos, versteinern, werden zu Bewohnern einer stilisierten Kunstwelt, wie in einem Herbarium kostbarer Blumen oder einem Skulpturen-Garten. Man hat es offensichtlich hier mit einem Menschen zu tun, so beschreibt es Theisohn, „der darauf besteht, keine Spuren eines Innenlebens zu hinterlassen.“ Das erzeugt den leisen Grusel dieser Lektüre: Man entdeckt Conrad Ferdinand Meyer als Schattengestalt der Literatur, einen Geist, der nachts voller Unruhe durch die Ruinen des 19. Jahrhunderts streift. „War’s als höbe mir ein Bergwind aus der Stirn die grauen Haare“, dichtet der Schriftsteller. > War’s als dufteten die Matten, drein ich schlummernd lag versunken. / War’s als rauschten alle Quelle, draus ich wandernd einst getrunken. > > > Quelle: Philipp Theisohn – Conrad Ferdinand Meyer. Schatten eines Jahrhunderts Alles wird hier zum „Als ob“. War‘s so – oder doch nicht? Ist die Erinnerung echt – oder trügt sie? Bei Conrad Ferdinand Meyer bleibt alles unwirklich, nebelhaft. EIN OPFER RELIGIÖSER OBSESSIONEN Philipp Theisohn rezitiert die Worte des Literaturwissenschaftlers Friedrich Kittler, das Werk des Dichters sei im „im Zwischenraum zweier Internierungen in Irrenanstalten“ entstanden. Fraglos ist Conrad Ferdinand Meyer ein Opfer der religiösen Obsessionen seiner Mutter. In der Heilanstalt am Neuenburgersee wird schon dem jungen Mann eingetrichtert, er müsse seinen Stolz ablegen, Demut üben. So hält es auch die Mutter. Bevor sie Selbstmord begeht, hinterlässt sie dem Dreißigjährigen einen erschütternden Brief. „In unaussprechlichem Seelenschmerz“ müsse sie sich von ihm losreißen, damit sie nicht Sünde auf Sünde häufe. DAS LEBENDIGE EINFRIEREN Die Angst vor der Verstrickung in Lebenslüge und Sünde wird, wie Philipp Theisohn erkennt, nicht nur zu Meyers Psychogramm. Es wird zur Folie seiner poetischen Selbstbefreiung. Literatur als Mittel, dem Verhängnis zu entrinnen, den Strom des Lebens erkalten zu lassen, die fatale Lebendigkeit literarisch einzufrieren. So werden auch die Novellen von Conrad Ferdinand Meyer verständlich. „Der Schuss von der Kanzel“ zum Beispiel, über einen waffenvernarrten Pfarrer, der bloßgestellt wird und damit unfreiwillig den Weg zu einer Ehe freimacht. Wie Marionetten bewegen sich die Figuren durch die Handlung. Philipp Theisohn verknüpft solche Werkanalysen mit der Verstörung, die Meyers Werk bei den Zeitgenossen hinterlässt. Vergeblich wartet Verleger Hermann Haesseler auf ein episches Werk, etwas anderes als den Kunstfrost der Novellen. Verkniffen urteilt der Zürcher Schriftstellerkollege Gottfried Keller, Meyer habe ein merkwürdig schönes Talent, aber keine rechte Seele. DIE FAMILIE ALS BEGLEITPERSONAL Selbst Meyers Familie, seine Schwester, seine Ehefrau, so beobachtet Philipp Theisohn, fristen das Dasein eines zeitentrückten Begleitpersonals, einzig dazu bestellt, dem Dichter bei seinen Versteinerungsübungen zu helfen. Selbstoffenbarend fragt er im Gedicht „Möwenflug“: > Und du selber? Bist du echt beflügelt? / Oder nur gemalt und abgespiegelt? > > > Quelle: Philipp Theisohn – Conrad Ferdinand Meyer. Schatten eines Jahrhunderts Conrad Ferdinand Meyers Werk wird so zum Widerschein einer untergegangenen Welt. Die letzten Lebensjahre verbringt der Schriftsteller in Heilanstalt und Betreuung. Wie ein Todeshauch wirkt das Buch, das ihm Philipp Theisohn gewidmet hat. Eine literarische Gespensterstunde.
Mit neuen Büchern von Norbert Gstrein, Joanna Bator, Ricarda Junge und Pierre Michon
Norbert Gstrein erfindet sich neu und bleibt doch er selbst. Ricarda Junge erlebt das tägliche Schulchaos und findet doch auch Zärtlichkeit. Und Joanna Bator führt durch unheimliche postmoderne Welten.
Elige tu suscripción
Premium
20 horas de audiolibros
Podcasts solo en Podimo
Podcast gratuitos
Cancela cuando quieras
Empieza 7 días de prueba
Después $99 / mes
Empieza 7 días de prueba. $99 / mes después de la prueba. Cancela cuando quieras.