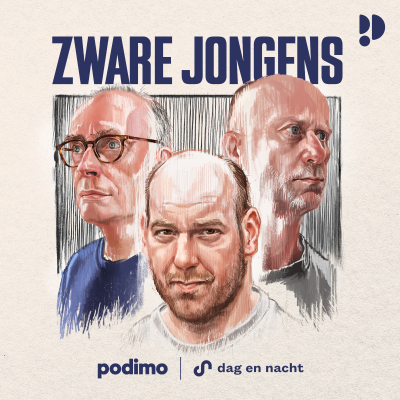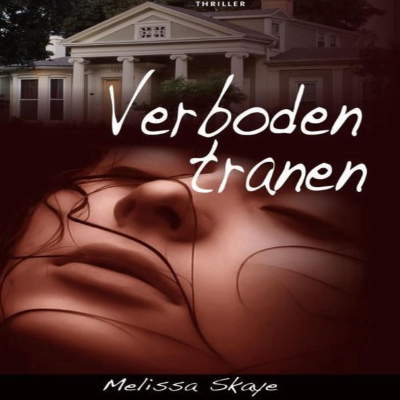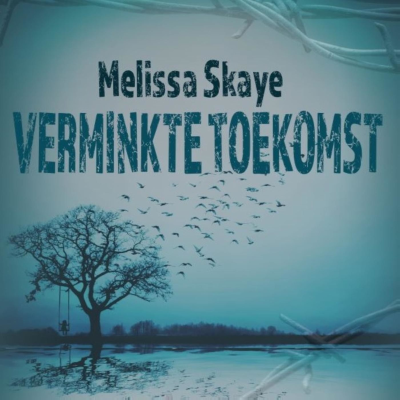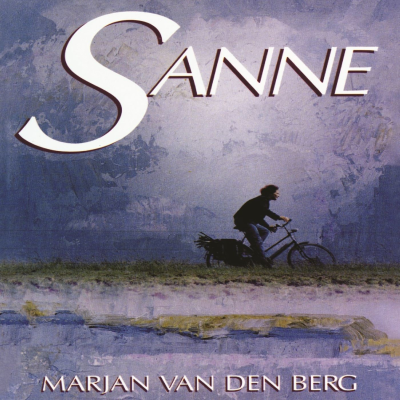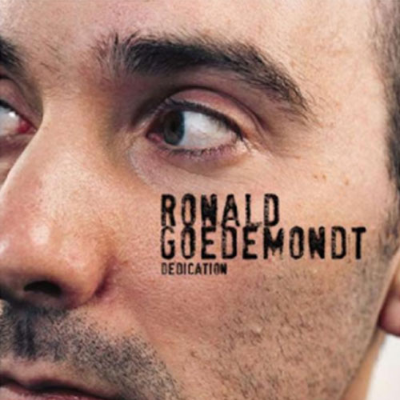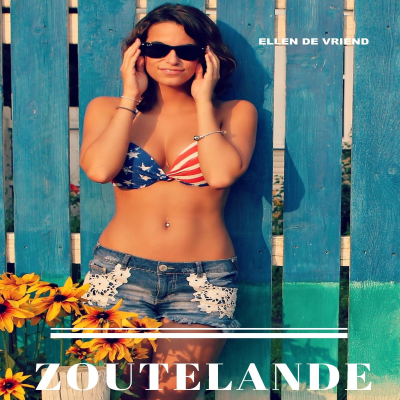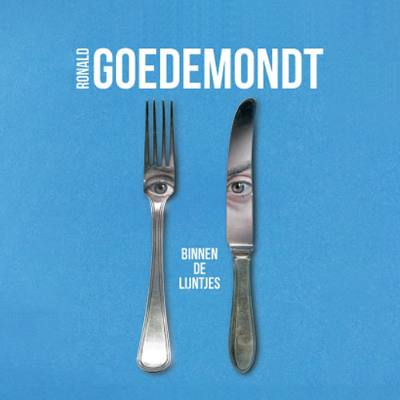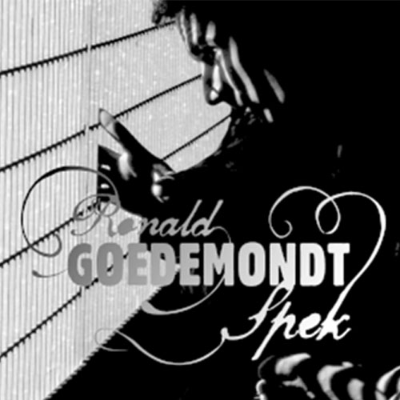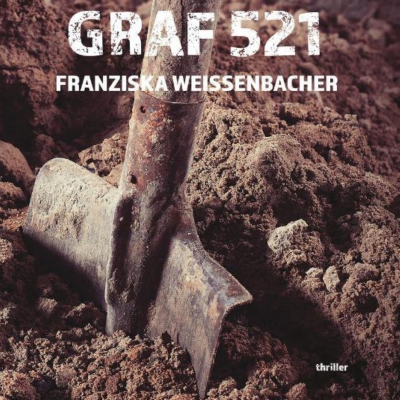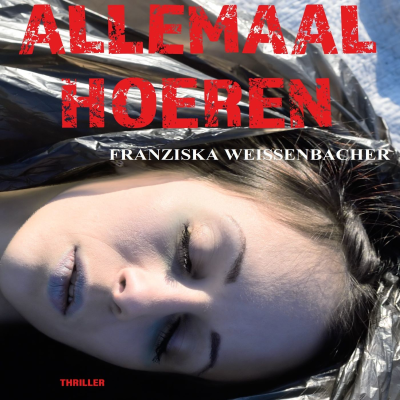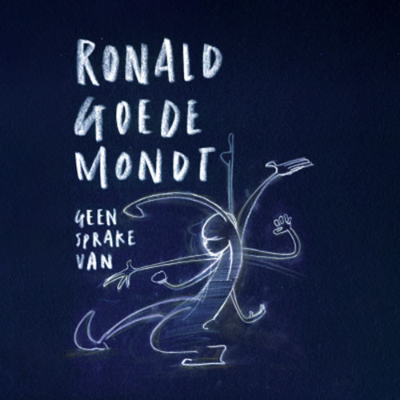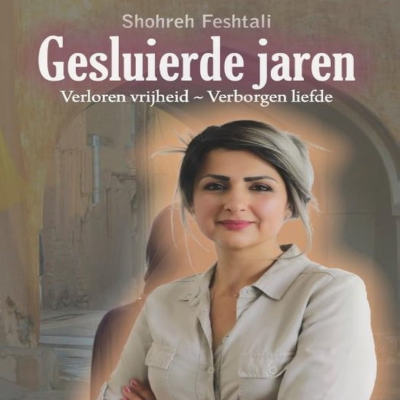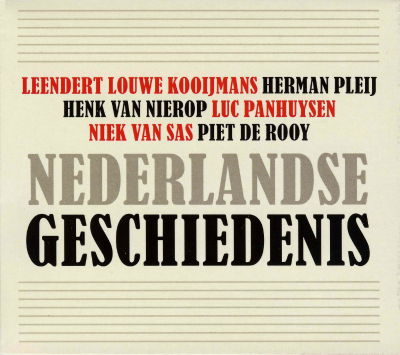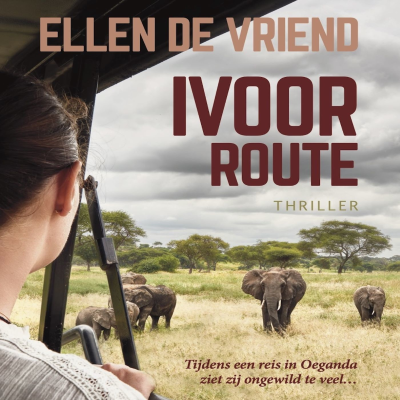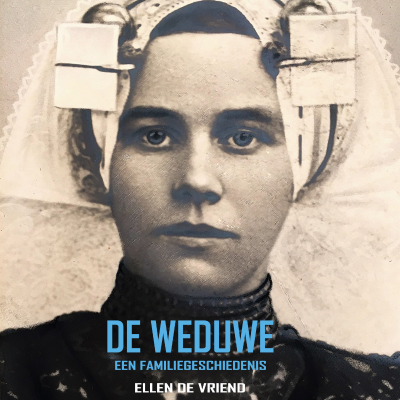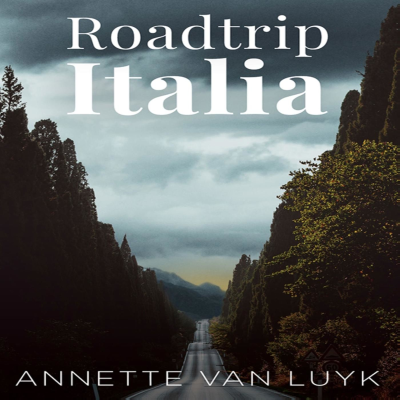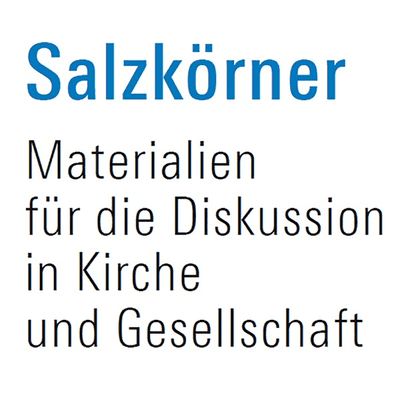
Die Salzkörner
Podcast door Zentralkomitee der deutschen Katholiken
Frisches Salz in der Meinungssuppe! Der Podcast des Zentralkomitees der deutschen Katholiken bringt dir Materialien, Meinungen und Standpunkte für die Diskussion in Kirche und Gesellschaft. In Schriftform erscheinen die Salzkörner sechsmal im Jahr kostenfrei auf www.zdk.de/veroeffentlichungen/salzkoerner/
Tijdelijke aanbieding
3 maanden voor € 1,00
Daarna € 9,99 / maandElk moment opzegbaar.
Alle afleveringen
16 afleveringenEin Meer von weiß-rot-weißen Fahnen in den Straßen von Minsk, Zehntausende, die Woche für Woche friedlich für Neuwahlen demonstrieren – vor wenigen Monaten hätte man sich solche Bilder in Belarus nicht vorstellen können. Als Konsequenz aus den manipulierten Präsidentschaftswahlen hat sich in kürzester Zeit eine Protestbewegung geformt, die sich durch staatliche Gewalt nicht mehr einschüchtern lässt. Frauen spielen eine besondere Rolle in dieser Entwicklung. Auch die katholische Kirche in Belarus erhebt ihre Stimme. Wir sprachen mit Dr. Angelika Schmähling von Renovabis am 28. November 2020 über die Lage in Belarus, Weißrussland. In Artikleform könnt ihr dies nachlesen auf https://www.zdk.de/veroeffentlichungen/salzkoerner/detail/Belarus-ein-Land-im-Umbruch--965I/ [https://www.zdk.de/veroeffentlichungen/salzkoerner/detail/Belarus-ein-Land-im-Umbruch--965I/] ### Frisches Salz in der Meinungssuppe! ### Der Podcast des Zentralkomitees der deutschen Katholiken bringt dir Materialien, Meinungen und Standpunkte für die Diskussion in Kirche und Gesellschaft. In Schriftform erscheinen die Salzkörner sechsmal im Jahr kostenfrei auf www.zdk.de/veroeffentlichungen/salzkoerner/
Seit 1992 ist Franz Meurer Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth in den Kölner Stadtteilen Vingst und Höhenberg, die als „Problemviertel“ gelten: Dort leben rund 23.000 Menschen, von denen knapp 4.000 Sozialhilfe erhalten; jeder Dritte ist Ausländer. Meurer initiierte zahlreiche Aktivitäten, von einer Kleiderkammer und einer Essensausgabe bis zu Ferienfreizeiten für 630 Kinder – „HöVi-Land“ genannt. Er berichtet, wie die Ferienfreizeit trotz Corona stattfinden konnte. Es sollte die 27. Auflage unsere Kinderstadt HöVi-Land in den Sommerferien sein. Für die „Pänz“, wie Kinder in Köln heißen, ist sie das Highlight des Jahres. Ein kleines Mädchen brachte es für das ARD-Morgenmagazin genial auf den Punkt, als es auf die Frage der Reporterin, was denn am schönsten sei, antwortete: „Dass wir hier zusammenhalten – und all die anderen Dinge.“In der Tat ist es der Zusammenhalt, der das HöVi-Land auszeichnet. Der macht Ausflüge, Schwimmen, Basteln oder gemeinsam Kochen noch mal so schön. Die jugendlichen Leiterinnen und Leiter, die jedes Jahr eine intensive Ausbildung erfahren, sind Vorbilder für die Kinder. Die Abschiedstränen am letzten Tag der Ferienfreizeit beweisen es. Als zusätzliches Dankeschön erhält jede/r ein T-Shirt mit dem jeweiligen Motto. Heiß begehrte Sammlerobjekte. Ebenso das Armband, das jedes Kind zu Beginn erhält. Eine Jugendliche trägt mittlerweile elf HöVi-Land-Bänder am Handgelenk. Die Kinderstadt ist keine Kinderbespaßung für drei Wochen, sondern der real gewordene Traum eines solidarischen Gemeinwesens. Neben den jugendlichen Gruppenleiterinnen der 30 Gruppen engagieren sich auch rund 300 Erwachsene. Natürlich ist alles ökumenisch. Und demokratisch. Für alle und mit allen Menschen guten Willens. Mit Corona geriet alles ins Wanken. Doch der wöchentlich sich treffende Pfarrgemeinderat entschied: „Wir machen für die Pänz, was irgend geht!“ Und so haben wir statt einer Kinderstadt ein Kinderdorf eröffnet. Leider konnten statt 630 Kindern, wie bisher, nur 210 teilnehmen und auch nur eine Woche statt drei. Die Gruppen mussten auf Abstand zueinander bleiben. Jeweils zehn Kinder waren in einer Gruppe, dazu drei Leiterinnen und Leiter. Jedem Kind mussten im geschlossenen Raum fünf Quadratmeter zur Verfügung stehen. Bei Aktivitäten draußen waren es zehn. Mittagessen ging nur jeweils in der kleinen Gruppe. Das Essen kam nicht von der Zeltküche, die immer für 900 Personen gekocht hat, sondern wegen der strengen Hygieneregeln von einem Caterer. Der Kontakt zu den Kindern, die nicht mitkommen konnten, wurde über Bildschirm gehalten. Junge Menschen hatten ein Fernsehstudio eingerichtet, von dem aus Gesang, Sketche und morgendlicher Frühsport übertragen wurden. Besonders schön fand ich, dass etliche besser gestellte Familien auf die Teilnahme ihrer Kinder verzichteten, damit ärmere wenigstens eine schöne Ferienwoche erleben konnte. Das ist die Solidarität, die unseren Stadtteil zusammenhält.
Ein Forschungsteam des Instituts für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim und der Goethe-Universität Frankfurt hat kürzlich eine Studie zum Thema Jugend und Corona veröffentlicht *1, die zeigt: Junge Menschen fühlen sich während der Corona-Pandemie nicht ausreichend gehört und ihre Interessen werden zu wenig berücksichtigt. Jugendliche werden in der Medienöffentlichkeit fast ausschließlich in ihrer Rolle als Schüler*innen wahrgenommen. Perspektiven auf die Lebensgestaltung zwischen Gleichaltrigen, Sport, Aktivitäten in Jugendverbänden, Vereinen und Netzwerken, die Teilnahme an und das Engagement in außerschulischer Bildung und die vielfältigen Angebote der Jugendarbeit spielen im öffentlichen Diskurs kaum eine Rolle. Jugendliche aus dem Blick verloren Junge Menschen kritisieren die Verletzung ihres Rechtes auf Partizipation an politischen Entscheidungsprozessen. Die bestehenden Wege der Beteiligung junger Menschen am Diskurs sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen massiv eingeschränkt und digitale Formate nur ein unzureichender Ersatz. Auch die physischen Räume zur Gestaltung fehlen. Jugendbildungsstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe waren bzw. sind geschlossen und kämpfen aufgrund langer Wartezeiten auf Überbrückungshilfen im Konjunkturpaket ums Überleben. Spätestens hier zeigt sich, dass auch nach Bewältigung der eigentlichen Pandemie die vielfältige Landschaft der Jugendarbeit gefährdet ist. Mit viel Kreativität und Engagement setzen sich Interessenvertreterinnen in den Jugendverbänden für den Erhalt der wertvollen Angebote ein, denn Bildung ist mehr als schulischer Unterrichtsstoff: Ethisches, soziales und politisches Lernen geschieht auch außerhalb der Schule. Die Gesellschaft und der Staat wären ohne ehrenamtliches Engagement junger Menschen kaum funktionsfähig. Unsere Demokratie funktioniert durch den solidarischen Einsatz von Menschen für die Gesellschaft. Junge Christinnen in den Jugendverbänden setzen sich nicht nur für ihre eigenen Belange ein, sondern wollen die Welt als Ganzes ein Stück besser machen: Beim Einsatz für eine zukunftsfähige Kirche im Synodalen Weg, mit Aktionen für den Erhaltung der Schöpfung oder in politischen Diskussionen – sie wollen die Gesellschaft lebenswerter und menschenfreundlicher gestalten. Was vor der Pandemie selbstverständlich war, wird jetzt an die aktuellen Umstände angepasst. Ein konkretes Beispiel ist der Einsatz des BDKJ Limburg und seiner Jugendverbände: Ein Hilfe-Netzwerk unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ wurde ins Leben gerufen. Menschen vor Ort werden während der Corona-Krise unterstützt. Junge Menschen kaufen für sie ein, tätigen Erledigungen, treffen sich mit ihnen zum Gebet und Gespräch oder helfen bei technischen Herausforderungen. 2 Auch die Malteser Jugend im Erzbistum Berlin hat in Kooperation mit dem BDKJ Berlin und dem Caritasverband ein Unterstützungsangebot ins Leben gerufen, und es hat sich das Projekt „72 gute Taten in 2020“ angeschlossen.3 So entstehen bundesweit Initiativen aus einer lebendigen und funktionieren Jugendverbandskultur heraus, in der junge Menschen Solidarität und Engagement aus dem christlichen Menschenbild erfahren und weitergeben. Wir sind dazu aufgerufen, auch in Zeiten der Krise die Stimme junger Menschen zu hören, ihre Belange zu berücksichtigen und sie an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Eine Demokratie, die auch in Zukunft auf den Einsatz ihrer Bürger*innen setzt, sollte deren Selbstbestimmung von Anfang an fördern und jungen Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen zugestehen. Und in einer Krise, in der es kreative Ideen, Solidarität und kluge Entscheidungen braucht, sollte die Kreativität, Energie und das Experimentieren junger Menschen Vorbild sein. Die Aufgabe der erwachsenen Menschen ist es, diese zuzulassen.
Themen wie „Urlaub“ und „Reise“ sind zur Zeit verbunden mit dem „Aber“-Wort! Urlaub ist okay (zumal im Sommer), aber … – Reisen sind notwendig (privat und geschäftlich), aber …! War das „Aber“ in den ersten Monaten des Jahres noch verbunden mit „Umwelt“, „Klima“ und „Greta Thunberg“, so hat sich das Bindemoment verändert: Das „Aber“ ist mittlerweile die sprachliche Vorwarnung zum Phänomen „Corona“. Das COVID-19-Virus hat sich nicht nur in menschliche Körper hineingedrängt, sondern bestimmt aktuell das Leben in der Gesellschaft und ihre Mobilität. Es ist prinzipiell die Absicht einer (Urlaubs-)Reise, einen anderen Ort aufzusuchen. Man erwartet nicht nur Ortswechsel, sondern auch Entspannung der besonderen Art, und mehr noch, das Erfahren ganz neuer Eindrücke. Reiseberichte“, mit diesem Titel erschien kürzlich ein Band des Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unseld. Er versammelt 35 (von insgesamt 1500 vorliegenden) Berichte des Verlagschefs an seine Mitarbeiter*innen. Urlaubsreisen kann man Unselds Touren nicht nennen, sondern es handelte sich vor allem um Besuche bei Autor*innen, Literaturschaffenden und gesellschaftlichen Größen. Unselds Reiseberichte erzählen kaum von der Schönheit der besuchten Orte oder vom Menü-Ablauf der vielen Arbeitsessen, sondern vielmehr von den Anliegen und Vorstellungen seiner Klient*innen. Henry Kissinger, Peter Handke, Max Frisch und wie sie alle hießen, mit denen Unseld auf seinen Reisen zu tun hatte, waren seine Gesprächspartner. Die Rapporte an seine Mitarbeiter*innen geben Anweisungen, wie in unterschiedlichsten Verlagsangelegenheiten zu verfahren ist. Man staunt beim Lesen, wie geschäftstüchtig die einen sind und wie sensibel die anderen.„Reisen bildet!“, heißt es. Und die Berichte des Verlagsleiters zeigen, wie sehr auch er profitiert vom Reisen. Flüchtige Beobachtungen der besuchten Orte wurden notiert, aber auch Museumsbesuche (oftmals gemeinsam mit den Gesprächspartner*innen) finden Erwähnung. Fast 40 Jahre Geschäftsreisen der besonderen Art, auf hohem Bildungs- und Erfahrungsniveau – die Lektüre ließ mich neidisch und nachdenklich gleichzeitig werden … Reise: theologisch und spirituell gleichzeitig In Texten der Bibel und in vielen Mythen findet sich das Phänomen der Reise dokumentiert. Die Reise an sich hatte keineswegs den Charakter eines Erholungsurlaubs, sondern war trotz aller Strapazen Teil von Muße und Kontemplation. Beispielhaft seien genannt die Wanderung des Gilgamesch, das Unterwegssein in der Odyssee oder die Argonautensage, aber auch die verschiedenen Reisen, die in den neutestamentlichen Büchern beschrieben sind. So verorten sich Gemeinschaften durch die Reisemotivik als Herkunftsgemeinschaft und schreiben sie fort. Prozesse der Herkunft, Abreise und Wiederkehr spielen in der Literatur immer wieder eine Rolle, die Mythen bauen aufeinander auf, kopieren, fokussieren und erweitern ihre Perspektive. Es ist die Suche nach den Anders-Orten, welche die Reisen bestimmten. So beschreiben die Evangelisten die zielorientierte Wanderung Jesu. Die paulinischen Reisebeschreibungen gehen von einem theologisch motivierten Grundduktus aus. Das Werden des Christentums wird als Ausbreitungsgeschichte konzipiert, der Weg ist gleichsam ekklesiologisches Programm. Reisen – trotz und mit Corona Im Falle der COVID-19-Pandemie wurde man durch den Lockdown empfindlich daran erinnert, wie fragil das soziale Leben ist, auf dessen Rhythmus man sich im Laufe des Lebens eingestellt hat. Die gewohnten Prozesse der Arbeits- und Freizeit erfahren eine jähe Unterbrechung, wenngleich mit neuen Dimensionen – der kurze genehmigte Spaziergang um den Häuserblock erlaubt einen neuen unverstellten Blick für das Naheliegende. Dann wird die Reisesehnsucht in die große weite Welt relativ. ### Frisches Salz in der Meinungssuppe! ### Der Podcast des Zentralkomitees der deutschen Katholiken bringt dir Materialien, Meinungen und Standpunkte für die Diskussion in Kirche und Gesellschaft. In Schriftform erscheinen die Salzkörner sechsmal im Jahr kostenfrei auf www.zdk.de/veroeffentlichungen/salzkoerner/
Das Lager Moria ist abgebrannt. Weit über zehntausend Menschen sind obdachlos, irren in den Straßen umher auf der Suche nach Wasser und Nahrung. Sebastian Eckert sprach mit Dr. James Jakob Fehr vom Deutschen Mennonitischen Friedenskomitee. Er ist vor Ort - und berichtet über die unmenschliche Situation, in der die Geflüchteten seit Jahren in einem europäischen Lager mitten in Europa ausharren müssen. "Wie in einem Gefängnis", sei es dort. ### Frisches Salz in der Meinungssuppe! ### Der Podcast des Zentralkomitees der deutschen Katholiken bringt dir Materialien, Meinungen und Standpunkte für die Diskussion in Kirche und Gesellschaft. In Schriftform erscheinen die Salzkörner sechsmal im Jahr kostenfrei auf www.zdk.de/veroeffentlichungen/salzkoerner/
Tijdelijke aanbieding
3 maanden voor € 1,00
Daarna € 9,99 / maandElk moment opzegbaar.
Exclusieve podcasts
Advertentievrij
Gratis podcasts
Luisterboeken
20 uur / maand