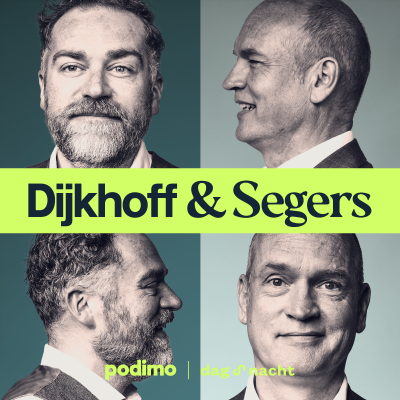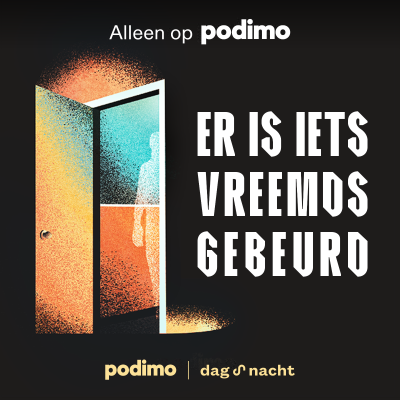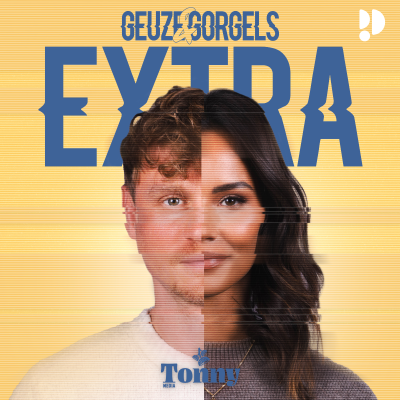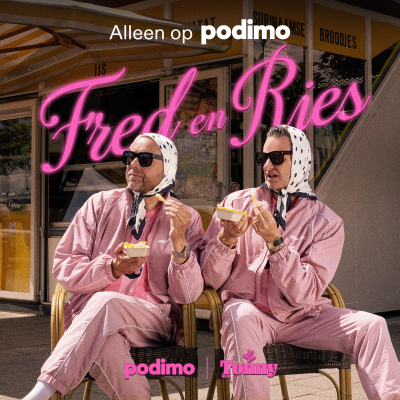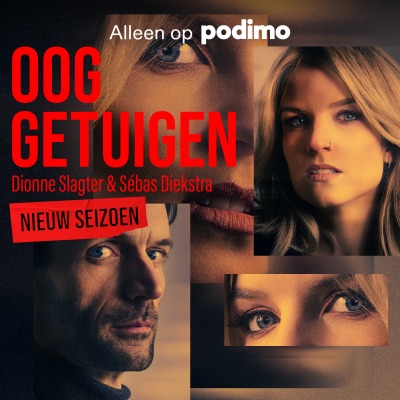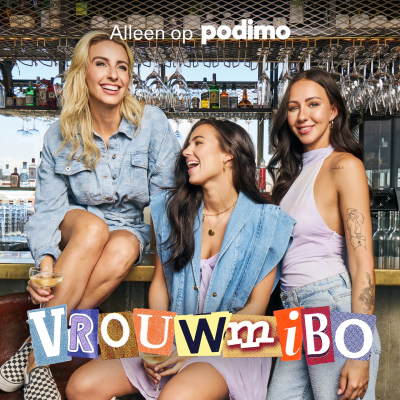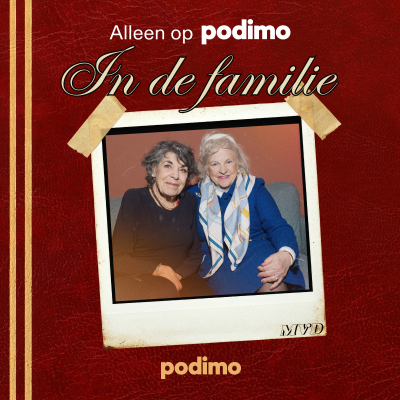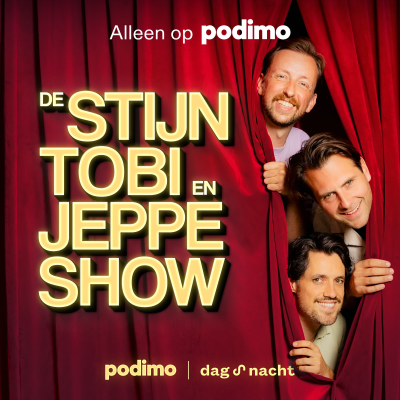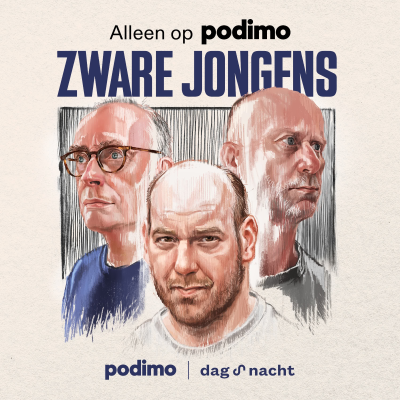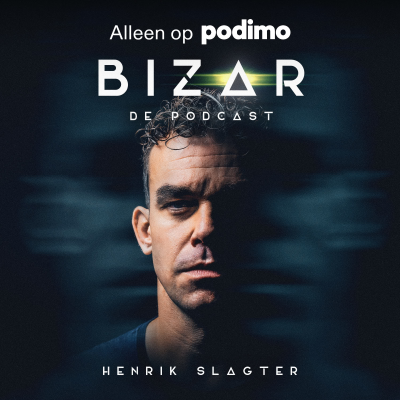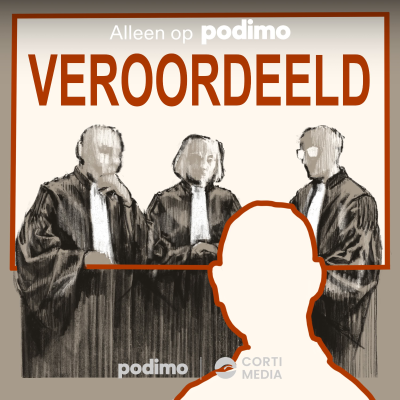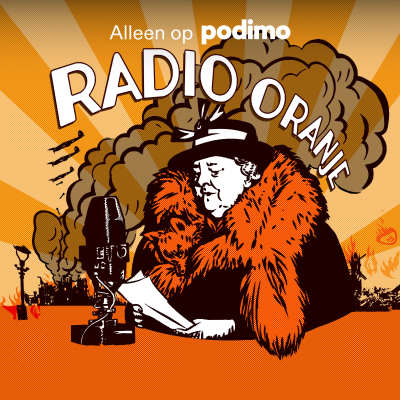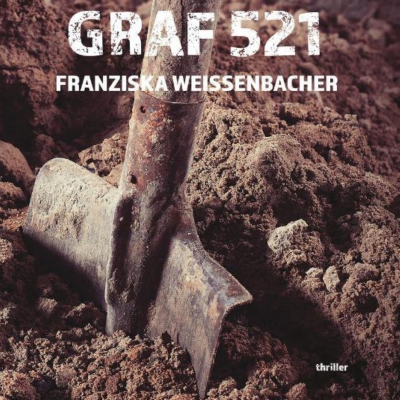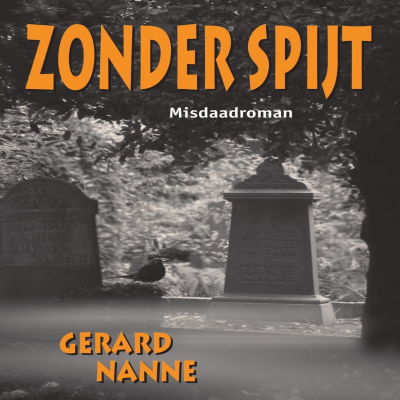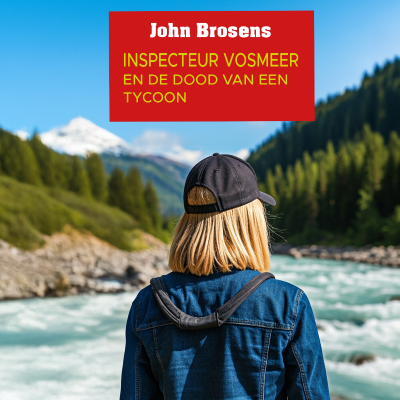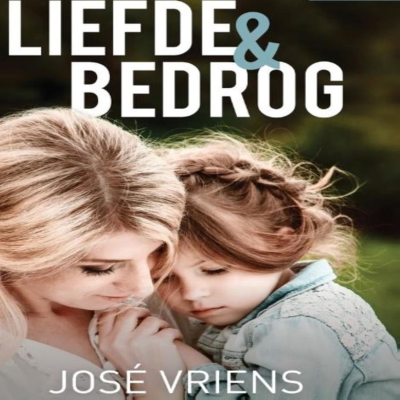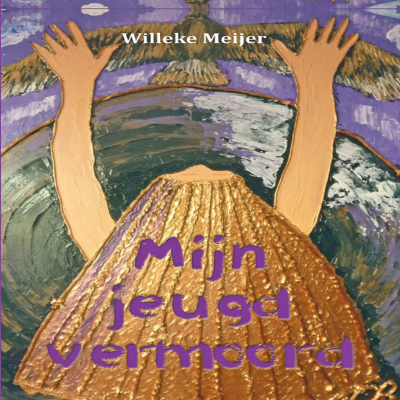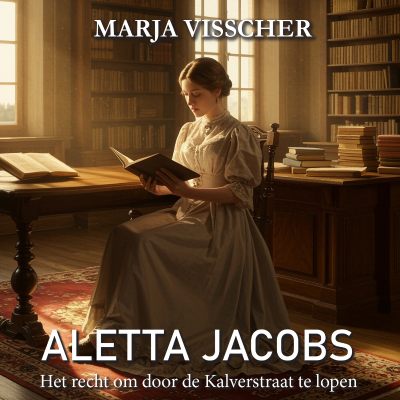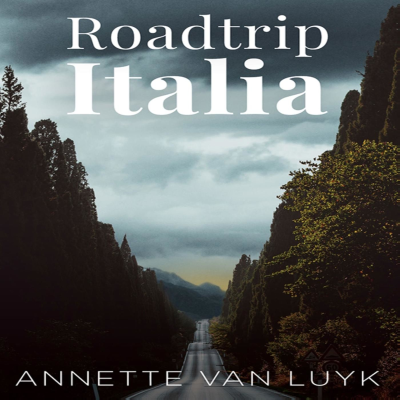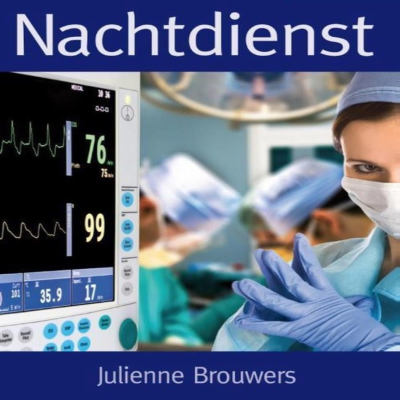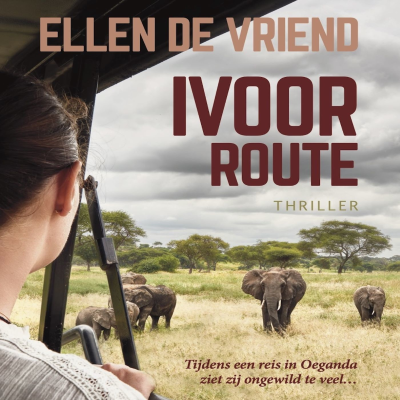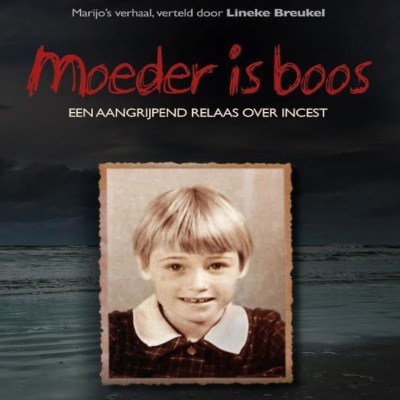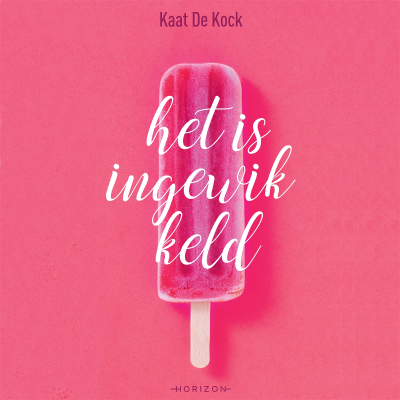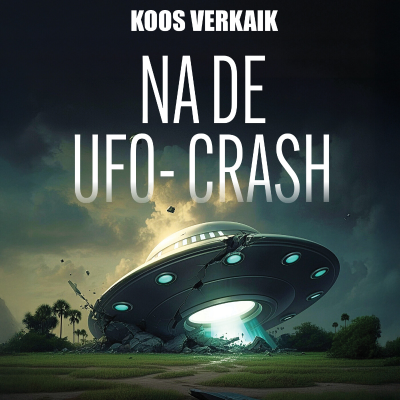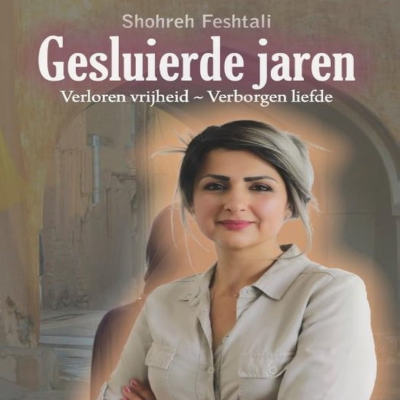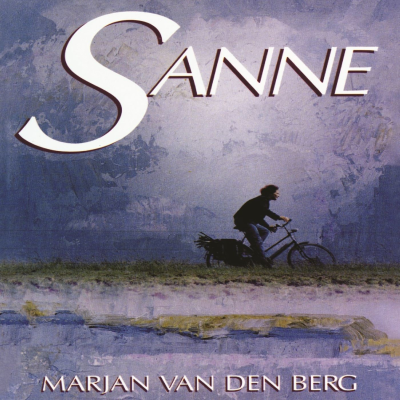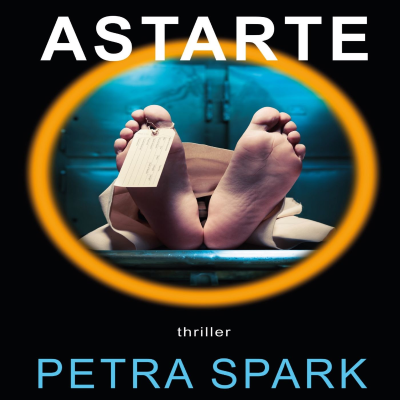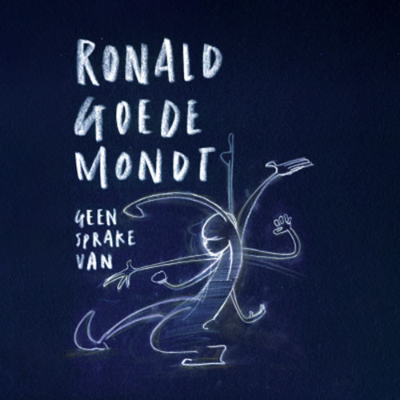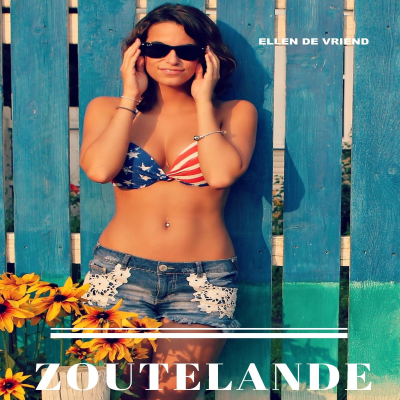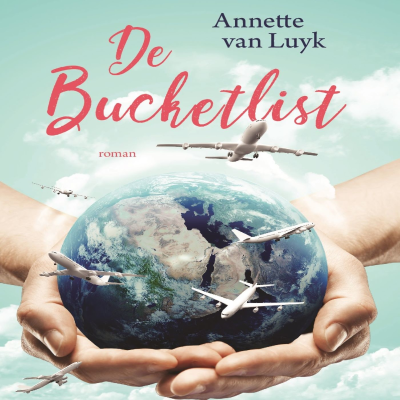NachDenkSeiten – Die kritische Website
Duits
Nieuws & Politiek
Tijdelijke aanbieding
2 maanden voor € 1
Daarna € 9,99 / maandElk moment opzegbaar.
- 20 uur luisterboeken / maand
- Podcasts die je alleen op Podimo hoort
- Gratis podcasts
Over NachDenkSeiten – Die kritische Website
NachDenkSeiten - Die kritische Website
Alle afleveringen
4731 afleveringenDas Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit – Sonderausgabe: Friedrich Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026
Vokabelkritik ist zu Kriegszeiten das Gebot der Stunde. Ich veröffentliche, nicht zuletzt aus hygienischen Gründen, in unregelmäßigen Abständen eine Sammlung teils verharmlosender, teils lügenhafter Wörter oder Formulierungen, deren Sinn und Funktion es ist, unsere Gesellschaft – uns alle – an das Undenkbare zu gewöhnen und möglichst geräuschlos in Richtung „Kriegstüchtigkeit“ umzukrempeln. – Eine Sternstunde ereignete sich vergangenen Freitag, den 13. Februar, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als Kanzler Merz in seiner Eröffnungsrede [https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rede-kanzler-msc-2407218] – im üblichen leicht indignierten Angebersound [https://www.youtube.com/watch?v=27aA5WaLEl8] und Halbstarkenhabitus [https://www.youtube.com/watch?v=A22iB7ygm8c] – eine wahre Goldmine an Kriegstüchtigkeitsworten aus dem Zylinder zauberte. Ihm sei daher hier eine ganze Sonderausgabe gewidmet. Ich präsentiere die Merz‘schen Nuggets mit kurzen Kommentaren. Von Leo Ensel. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. ausbuchstabieren, wie wir dies europäisch organisieren wollen Und zwar Folgendes: „Zur Erinnerung und auch für manch einen, der es nicht weiß: In Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union verpflichten wir uns, einander im Fall eines bewaffneten Angriffs in Europa beizustehen.“ – Ausbuchstabiert lautet die subkutane Drohung an Putin: Wenn die Ukraine demnächst in der EU ist, bekommt er es militärisch mit uns allen zu tun! Bereitschaft zu Aufbruch, Veränderung und, ja, auch Opfern Die aktuelle traditionsbewusste Merz‘sche Version von Churchills „Blood, Sweat, Toil and Tears“. bis zum bitteren und bösen Ende „Wir Deutsche wissen, eine Welt, in der nur Macht zählt, wäre ein finsterer Ort. Unser Land ist diesen Weg im 20. Jahrhundert bis zum bitteren und bösen Ende gegangen. Heute schlagen wir einen anderen, einen besseren Weg ein.“ – Auf Deutsch: Wir sind geläutert und schlagen heute anders und besser zu! (Und zwar „nie wieder allein“, sondern mit der ganzen EU – „ausbuchstabiert“.) Chancen eröffnen und Tatkraft entfesseln Muss Europa jetzt. Und keineswegs „sich darauf zurückziehen, Risiken zu vermeiden“. – Risiken einzugehen, eröffnet demnach für Europa Chancen und entfesselt Tatkraft. (Nur: Welche Risiken? Und wozu eigentlich?) damit das klar ist „Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen. Meine Damen und Herren, damit das klar ist: Wir halten uns dabei an unsere rechtlichen Verpflichtungen. Wir denken dies strikt eingebettet in unsere nukleare Teilhabe innerhalb der NATO.“ – „Damit das klar ist“: Eine der beliebten Merz‘schen Einleitungsformeln – wie „ein offenes Wort“, „unbequeme Wahrheit“, „brutal, ich weiß“, „lassen Sie mich das so sagen“ oder „ich mein‘ es genau, wie ich es sage“ –, die ankündigen soll: Jetzt geht es zur Sache. Und zwar klar, offen, ehrlich und brutal! das erste Mal Dem wohnt bekanntlich immer ein ganz besond‘rer Zauber inne. „Wir stärken die Ostflanke der NATO. Dafür entsteht unsere Brigade in Litauen – das erste Mal, dass in der Geschichte der Bundeswehr ein ganzer Großverband außerhalb unseres eigenen Territoriums aufgestellt wird.“ – Und gleich direkt vor der russischen Haustür. (Nicht das erste Mal.) den Schalter im Kopf umlegen „Wir legen den Schalter im Kopf um. – Wir haben begriffen: In der Ära der Großmächte ist unsere Freiheit nicht mehr einfach so gegeben. Sie ist gefährdet. Es wird Festigkeit und Willenskraft brauchen, um diese Freiheit zu behaupten. Das wird uns die Bereitschaft zu Aufbruch, Veränderung und, ja, auch zu Opfern abverlangen, und zwar nicht eines Tages, sondern jetzt.“ – Also: Aufrüsten! Aufrüsten!! Aufrüsten!!! Aber subito. die Freiheit des Wortes Die „endet hier bei uns [im Gegensatz zum Kulturkampf der MAGA-Bewegung], wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet.“ – Einspruch, Euer Ehren! Die Freiheit des (offenen) Wortes endet bei uns in der EU – siehe Jacques Baud [https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/eu-sanktionen-jacques-baud-meinungsfreiheit-li.10010883] – genau dort, wo jemand beispielsweise das offizielle Narrativ zum Ukrainekrieg nicht teilt. Und das auch noch öffentlich verbreitet! Die Strafe (die offiziell keine ist): Komplette zeitgemäße Ächtung der betreffenden Person – bis an den Rand der Vernichtung ihrer bürgerlichen Existenz. drei große S „Die europäische Verteidigungsindustrie muss schließlich ihre Pferdestärken auf die Straße bringen. Drei ‚große S‘ – Standardisierung, Skalierung und Simplifizierung von Waffensystemen – werden wir deshalb europäischer organisieren. Wir heben damit ein ungeheuer großes Potenzial.“ – Welch ein Glück, dass es ihrer drei und nicht etwa nur zwei ‚große S‘ sind! ein offenes Wort (vgl. „damit das klar ist“, „unbequeme Wahrheit“) gemeinsamer Außenauftritt „Diese Kraft [der drei ‚großen S‘] übersetzen wir in einen gemeinsamen Außenauftritt, der unsere strategischen Partner einschließt.“ – Da werden die Russen und Chinesen aber staunen, wenn sie uns gemeinsam auftreten sehen – nein: vor Angst schlottern! globaler Gestaltungsanspruch Den erhebt, laut Merz, die Volksrepublik China. Und das geht nun gar nicht! handfest, nicht esoterisch „Meine Damen und Herren, wenn unsere Partnerschaft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir sie im doppelten Sinn neu begründen. Diese Begründung muss handfest sein, nicht esoterisch.“ – Was auch immer das bedeuten mag. im Inneren und Äußeren „Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen wir gegen ihre Feinde im Inneren und Äußeren. Unter anderem werden wir unsere Nachrichtendienste stärken.“ – Und wer die „Feinde im Inneren“ sind, bestimmen wir. Die stellen wir dann kalt! Via EU-Sanktionen, haarscharf am nationalen Rechtsweg vorbei. (vgl. „widerstandsfähiger“) investieren „Deutschland allein wird in den nächsten Jahren mehrere Hundert Milliarden Euro investieren.“ In „glaubhafte Abschreckung“. Genauer: fünf Prozent des BIPs, wie (fast) alle Alliierten. Und dazu hat Deutschland sogar „seine Verfassung verändert“! – Kleine volkswirtschaftliche Erinnerung der Schweizer Weltwoche [https://weltwoche.de/daily/deutschland-im-ruestungs-fieber-verteidigungshaushalt-soll-von-52-milliarden-auf-153-milliarden-wachsen/], Herr BlackRot-Kanzler: „Jeder Euro in Bildung kommt zehnfach zurück. Jeder Euro in einen Panzer dagegen bleibt ein Euro, denn der Panzer steht im besten Fall herum, bis er rostet. Im schlechtesten wird er vorher zerschossen. Es gibt aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive wenige Investitionen, die sich so schlecht rechnen wie die in Rüstungsgüter.“ ja, auch Opfer! „Das wird uns die Bereitschaft zu Aufbruch, Veränderung und, ja, auch zu Opfern abverlangen. Und zwar nicht eines Tages, sondern jetzt.“ – Der poetische Fingerabdruck des Bundeskanzlers erweist sich in der Miniphrase „ja, auch“: „Ja“ soll eventuellen Einwänden im Vorfeld die Spitze abbrechen, während „auch“ die unangenehmen Opfer relativierend in eine Reihe mit „Aufbruch“ und „Veränderung“ stellt. Chapeau, Herr Poeta laureatus! länger als der Zweite Weltkrieg Dauert, wie der verhinderte Mathematiklehrer Friedrich Merz im Anschlussgespräch an seine Rede ausführte, bereits der Krieg in der Ukraine. langer Urlaub von der Weltgeschichte Den hat – der belesene Kanzler zitiert hier den Philosophen Peter Sloterdijk – Europa nun beendet. Merz: „Wir haben gemeinsam die Schwelle in eine Zeit überschritten, die wieder einmal offen von Macht und vor allem Großmachtpolitik geprägt ist.“ – Jammerschade, dass der Kanzler bei dieser Gelegenheit den Trost [https://www.koha.net/de/bote/peter-sloterdijk-shumica-e-europianeve-nuk-e-dine-me-qe-urrejtja-ndaj-europes-ne-lindje-ka-filluar-ne-levizjen-pansllaviste] des Meisterdenkers nicht gleich mitlieferte: „Europa erlebt derzeit, historisch gesehen, etwas, das einem Glück gleicht. Wir haben wieder Feinde. Echte Feinde.“ lassen Sie mich das so sagen (vgl. „ein offenes Wort“, „damit das klar ist“) lieber heute als morgen „Aber diesen Zustand [die selbst verschuldete ‚übermäßige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten‘] lassen wir jetzt hinter uns, und zwar lieber heute als morgen. Das tun wir nicht, indem wir die NATO abschreiben. Wir tun es, indem wir im Bündnis, im eigenen Interesse, einen starken, selbsttragenden europäischen Pfeiler errichten.“ (vgl. „nicht eines Tages, sondern jetzt“, „schnellstmöglich“) Moskau ungeahnte Verluste und Kosten aufgezwungen „Übrigens, seit einem Jahr leisten Deutschland und Europa hier [bei der Unterstützung der ‚Ukraine in ihrem tapferen Widerstand gegen den russischen Imperialismus‘] die wichtigste Führungsarbeit. Wir haben Moskau ungeahnte Verluste und Kosten aufgezwungen. Wenn Moskau endlich einem Frieden zustimmt, dann auch deshalb. Denn das ist Ausdruck europäischer Selbstbehauptung.“ – Auf Deutsch: Wir haben die Russen mal (wieder) richtig rangenommen. Aber das reicht natürlich noch lange nicht! neue Stärke, neue Achtung und Selbstachtung „Wenn wir das mit neuer Stärke, neuer Achtung und Selbstachtung tun [d.h. auf der Basis unterschiedlicher Meinungen mit den USA verhandeln], dann ist es zum Vorteil beider Seiten.“ – Ende Januar hatte der Kanzler sogar vom „Glück der Selbstachtung“ [https://www.sueddeutsche.de/politik/merz-bundestag-regierungserklaerung-europa-selbstbehauptung-chance-deutschland-li.3377904?reduced=true] im Bundestag geschwärmt! nicht eines Tages, sondern jetzt (vgl. „den Schalter im Kopf umlegen“, „lieber heute als morgen“, „schnellstmöglich“) nicht zehnmal so stark wie Russland „Das Bruttoinlandsprodukt Russlands beläuft sich zurzeit auf etwa zwei Billionen Euro. Das der Europäischen Union ist fast zehnmal so hoch. Und doch ist Europa heute nicht zehnmal so stark wie Russland. Unser militärisches, unser politisches, unser ökonomisches und unser technologisches Potenzial ist enorm. Aber wir haben es noch lange nicht im erforderlichen Maß ausgeschöpft.“ – Gemein und unverantwortlich. Bitte „schnellstmöglich“ verändern! Damit wir „Moskau noch ungeahntere Verluste und Kosten aufzwingen“ können … nie wieder! „Nie wieder Krieg“? Falsch gedacht, Leser-Doppelpunkt-innen! – „Nie wieder werden wir Deutsche allein gehen. Das ist bleibende Lehre aus unserer Geschichte. Unsere Freiheit behaupten wir mit unseren Nachbarn, nur mit unseren Nachbarn und Verbündeten und unseren Partnern.“ – Kurz: „Nie wieder Krieg – alleine!“ normativer Überschuss „Gemessen an ihren Machtmitteln hatte die deutsche Außenpolitik der letzten Jahrzehnte – lassen Sie mich das so sagen – einen normativen Überschuss.“ – Soll wohl heißen, dass die berühmte Ex-Außenministerin mit dem Klassensprecher*innen-Habitus öfter mal weit über das Ziel hinausgeschossen ist (oder hat). – „Mit den besten Absichten hat sie [die deutsche Außenpolitik, nicht die betreffende Dame!] Verletzungen der internationalen Ordnung in aller Welt kritisiert. Sie hat oft gemahnt, gefordert und gemaßregelt. Aber sie war nicht besorgt genug darüber, dass oft die Mittel fehlten, Abhilfe zu schaffen. Diese Schere zwischen Anspruch und Möglichkeiten hat sich zu weit geöffnet. Wir schließen sie.“ – Kurz: Wir beenden jetzt den militärpolitischen Unterschuss! Partnerschaft „Partnerschaft ist dabei kein absoluter Begriff. Partnerschaft setzt keine vollkommene Übereinstimmung aller Werte und Interessen voraus.“ – Warum dann nicht gleich auch wieder eine Partnerschaft mit Russland? partnerschaftliche Führung „Partnerschaftliche Führung, ja. Hegemoniale Fantasien, nein.“ – Das hatte einst der klagefreudige Philosoph auf dem Ministerthron noch etwas poetischer formuliert: Der sprach von „dienender Führung“ [https://www.focus.de/politik/deutschland/besuch-in-den-usa-habeck-sieht-deutschland-in-einer-dienenden-fuehrungsrolle_id_61552626.html]. (Aber so prätentiös klein will sich Herr Merz nun doch nicht machen.) prinzipienfester Realismus „Wir tun es mit prinzipienfestem Realismus.“ Nämlich: „Wir bauen auf unsere Stärke, unsere Souveränität und unsere Fähigkeit zu gegenseitiger Solidarität in Europa.“ Quadratur des Kreises „Diplomatisch gelingt uns damit in Europa in diesen Tagen eine Quadratur des Kreises. In der Arbeit für Frieden in der Ukraine wird das auch spürbar. Wo wir agil sein müssen, gehen wir in kleinen Gruppen voran, mit den E3, also mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien, aber auch mit Italien und Polen als europäischen Spielmachern.“ – Nur nicht mit den Spielverderbern Ungarn und der Slowakei, wahrscheinlich auch nicht mit Spanien und Tschechien. Mit denen lässt sich einfach kein Kreis quadrieren. schnellstmöglich „Die Bundeswehr werden wir – ich habe es häufig gesagt und wiederhole es hier – schnellstmöglich zur stärksten konventionellen Armee Europas machen. Einer Armee, die standhält, wenn sie muss.“ – Letzteres hatte der frischgebackene Inspekteur des Heeres, Christian Freuding, in seiner Antrittsrede noch einen Tick unmissverständlicher formuliert [https://www.bundeswehr.de/resource/blob/6001402/0cd0079e2f0862e0cfe3c37277fc8cbe/download-tagesbefehl-genlt-dr-freuding-deutsch-data.pdf]: „Ich will für ein Heer arbeiten, das bereit ist zum Kampf, das sich durchsetzt, das gewinnt.“ (By the way: „Schnellstmöglich“ und auch noch gleich die „stärkste“ Armee Europas. Es sind immer die Kleingeister, die in Superlativen schwelgen!) selbst verschuldete Unmündigkeit „Ein wahrer Verbündeter nimmt seine Verpflichtungen ernst. Niemand hat uns in die übermäßige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten gezwungen, in der wir uns zuletzt befunden haben. Diese Unmündigkeit war selbst verschuldet.“ – Frohe Botschaft: Merz hat nicht nur Sloterdijk, sondern auch Kant gelesen! Tragweite des Augenblicks „Ich appelliere aber auch an unsere Partner. Seht die Tragweite des Augenblicks. Bahnt auch ihr den Weg für ein starkes, souveränes Europa.“ – Dann sehen wir, wie weit der Augenblick tragen wird … unbequeme Wahrheit „Lassen Sie mich mit der unbequemen Wahrheit einfach beginnen. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben, aufgetan.“ – „Ein offenes Wort“ oder „brutal, ich weiß“ hätten es auch getan. unsere Verantwortung „Die sich aus Grundgesetz, Geschichte und Geografie ergibt. Wir nehmen diese Verantwortung an.“ – Man beachte: Es gibt für Merz nicht nur die drei „großen S“, sondern auch die drei „großen G“! weltpolitischer Faktor Ein solcher muss Europa jetzt werden „mit einer eigenen sicherheitspolitischen Strategie“. – „Ausbuchstabiert“ heißt das: „In Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union verpflichten wir uns, einander im Fall eines bewaffneten Angriffs in Europa beizustehen.“ Wettbewerbspolitik ist Sicherheitspolitik „In dieser neuen Welt ist Wettbewerbspolitik Sicherheitspolitik und Sicherheitspolitik Wettbewerbspolitik. Beides dient unserer Freiheit.“ – Kürzlich hatte Merz seinen Lieblingsgedanken so formuliert [https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/statement-vor-informellem-europaeischen-rat-2403700]: „Verteidigungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille.“ Wettbewerbsvorteil für Europa „Liebe Freunde, Teil der NATO zu sein, ist nicht nur ein Wettbewerbsvorteil für Europa, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil für die Vereinigten Staaten.“ – (Die das nur noch nicht kapiert haben.) widerstandsfähiger „Gleichzeitig machen wir unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft widerstandsfähiger. Wir bringen neue Gesetze auf den Weg, um unsere Netze und unsere kritische Infrastruktur gegen hybride Schläge zu härten.“ – Zum Beispiel den EU-Digital Services Act (DSA) [https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_digitale_Dienste], das Netzwerkdurchsetzungsgesetz [https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkdurchsetzungsgesetz], den seit Herbst 2022 um die „Leugnung und Verharmlosung von Kriegsverbrechen“ erweiterten § 130 StGB (Volksverhetzung), § 129a StGB (Billigung terroristischer Vereinigungen), § 99 StGB (Geheimdienstliche Agententätigkeit), unterstützt von Heerscharen als NGO getarnter digitaler Blockwarte, bis hin zu EU-Sanktionen – bekanntlich „keine Strafen, sondern außenpolitische Abwehrmaßnahmen“, weshalb man juristisch kaum gegen sie vorgehen kann – am nationalen Rechtsweg schnurstracks vorbei … (vgl. „im Inneren und Äußeren“) zerreißt Europa, zerreißt Deutschland Genau! Und: „Scheitert der Euro, scheitert Europa“ [https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2010/29826227_kw20_de_stabilisierungsmechanismus-201760]! zu neuem Leben erwecken „Wir erwecken unsere Verteidigungsindustrie zu neuem Leben. Neue Werke eröffnen, neue Arbeitsplätze entstehen, neue Technologien kommen hinzu.“ – Kurz: Wir haben die Tötungsindustrie zu neuem Leben erweckt. zur stärksten konventionellen Armee Europas machen Die Bundeswehr. „Schnellstmöglich“ natürlich. „Eine Armee, die standhält, wenn sie muss.“ Mit freundlicher Genehmigung von Globalbridge [https://globalbridge.ch/das-woerterbuch-der-kriegstuechtigkeit-sonderausgabe-friedrich-merz-auf-der-muenchner-sicherheitskonferenz-2026/]. Alle bisher erschienenen Folgen der Serie „Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit“ von Leo Ensel können Sie in dieser Übersicht finden [https://www.nachdenkseiten.de/?tag=woerterbuch-der-kriegstuechtigkeit] und diese auch einzeln darüber aufrufen. Titelbild: Bundesregierung/Steffen Kugler
Die Hölle von Verdun – Die Hölle des Krieges
Am 21. Februar ist es 110 Jahre her, dass die Schlacht um Verdun begonnen hat. Verdun wurde zum Beispiel für die Mischung aus mittelalterlicher Brutalität und industriellen Tötungswaffen wurde. Vor allem aber muss die Hölle von Verdun als abschreckendes Beispiel für Krieg in Erinnerung bleiben. Von Reiner Braun und Michael Müller. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Vergessen, verdrängt, verantwortungslos? Am 21. Februar 1916 begann der Morgen mit dem ohrenbetäubenden Lärm von 1.220 deutschen Artilleriegeschützen. Es folgte die extrem brutale Schlacht um die 40 Fortanlagen von Verdun, die nach der Niederlage von 1870/71 von Frankreich ausgebaut worden waren. Verdun wurde durch die entmenschlichten und verlustreichen Kämpfe über zehn Monate zum Symbol der mörderischen Ergebnislosigkeit der Materialschlachten im Ersten Weltkrieg. Um 17:00 Uhr desselben Tages startete die erste Angriffswelle der deutschen Infanterie im eisigen Schlamm der schnell entwaldeten Hügel rund um die Forts. Eine sterbende Landschaft, die schon bald von den Stümpfen zerschossener Bäume gezeichnet war. Trotz der verlustreichen Marne-Schlachten oder der Kämpfe an der Somme hat sich vor allem die Hölle von Verdun, bei der junge Männer hemmungslos ins Feuer geschickt wurden, tief in das deutsche und französische Bewusstsein für das Grauen des Ersten Weltkriegs eingegraben. Die Orte der Unmenschlichkeit hießen Fort Douaumont oder Fort Vaux. Erstmals wurden Flammenwerfer als Waffe eingesetzt. Die Soldaten mussten in vielen Nächten mit Gasmasken schlafen, blieben in der Kraterlandschaft oft tagelang ohne Nahrung, konnten den penetranten Geruch der herumliegenden Leichen nur schwer ertragen und wurden bei Verletzungen oftmals gar nicht medizinisch betreut. In den acht Monaten der Schlacht um Verdun wurden 50 Divisionen auf deutscher und 75 Divisionen auf französischer Seite eingesetzt. Jede Division umfasste zwischen 15.000 und 18.000 Soldaten, auf französischer Seite auch zwangsrekrutierte Männer aus den afrikanischen Kolonien (Armée d’Afrique). Nach den Schätzungen verloren zwischen 377.000 und 540.000 Soldaten für Frankreich und zwischen 337.000 und 434.000 Angehörige des Deutschen Heeres ihr Leben oder wurden schwer verletzt. Und doch wurde gerade Verdun zum Ort der deutsch-französischen Aussöhnung, das Memorial de Verdun zum Mahnmal gegen Krieg. Alle, die heute so leichtfertig von Krieg reden, sollten diesen Ort nicht nur besuchen, sondern sich die Todesnarben des Krieges ansehen, wie zum Beispiel die Orte lebendig begrabener Soldaten mit ihren hochgereckten Bajonetten, um von dem Irrsinn eines Krieges gegen Russland wegzukommen und sich für Frieden einzusetzen. Verdun ist der Ort, der uns alle zum Frieden mahnt; der Ort, der uns seit 110 Jahren vor Augen führt, wie gnadenlos und unsinnig Krieg ist, der doch irgendwann mit großen Schmerzen und unsäglichen Verlusten enden muss. Damit enden aber noch lange nicht das Leid und die Trauer der Familien, die ihre Söhne verloren haben oder die sich um die kriegsversehrten Angehörigen kümmern müssen. Wofür nur? Wie dürfte uns heute das Leben auch nur eines ukrainischen oder russischen Soldaten auch nur eine Sekunde egal sein, von denen aber so viele seit nunmehr vier Jahren ihr Leben lassen? Und wie sollte es uns gleichgültig sein, wenn jetzt auch von unseren Jugendlichen eine „Kriegstüchtigkeit“ gefordert wird, einsatzbereit für einen irrsinnigen Krieg gegen Russland? Jedes leichtfertige Gerede über „Krieg“ verbietet sich angesichts der Hölle von Verdun. Verdun mahnt uns: „Nie wieder Krieg!“ Es gibt nichts Wichtigeres als Frieden in der Ukraine, im Nahen und Mittleren Osten, im Iran, im Sudan und in Venezuela. Und in all den anderen Schauplätzen aktueller Kriege und mörderischer Konflikte. Reiner Braun ist Vorstandsmitglied des Internationalen Friedensbüros (IPB) und der Naturwissenschaftlerinitiative Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit. Michael Müller ist Bundesvorsitzender der Naturfreunde, Mitglied des Deutschen Bundestages von 1983 bis 2009 und ehemaliger Staatssekretär im Umweltministerium. Titelbild: Catalin.Bogdan / Shutterstock
Nord Stream, das Zwiebelprinzip und die größtmögliche Demütigung
Laut aktuellen Recherchen des SPIEGEL [https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nord-stream-cia-war-offenbar-frueh-in-plaene-der-angreifer-eingeweiht-a-d95f5682-dc5b-47a7-82e2-5bb09661b210] soll die CIA bereits früh in die Anschlagspläne auf die Nord-Stream-Pipelines eingeweiht gewesen sein und ihnen zumindest anfangs auch grünes Licht gegeben zu haben. Das wird nicht die letzte „Enthüllung“ gewesen sein und die gesamte Geschichte ist auch noch lange nicht auserzählt. Wie bei einer Zwiebel wird Schicht um Schicht die Wahrheit freigelegt. So kommt es zumindest zu keinem „Realitätsschock“. Derweil betreiben die USA und Russland hinter den Kulissen eifrig ihre Schattendiplomatie. Dass Nord Stream künftig wieder Gas liefern wird, ist durchaus möglich – dann jedoch unter Kontrolle der USA. So droht Nord Stream zu einem Mahnmal der Demütigung und des europäischen Versagens zu werden. Von Jens Berger. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Kurz nach der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines stand für Politik und Medien fest: Der Russe war’s! Was auch sonst? Nachdem Indizien oder gar Beweise ausblieben und man keine Erklärung für das offensichtlich fehlende Tatmotiv Russlands fand, versuchte man den Sabotageakt so gut wie möglich zu verdrängen und kleinzuspielen. Man wolle ja ohnehin kein Gas mehr aus Russland beziehen, da sei es letztlich auch egal, ob die Ostseepipelines nun intakt oder zerstört seien. So ganz ignorieren konnte man die Anschläge aber dennoch nicht, zumal erste Ermittlungsergebnisse an die Öffentlichkeit drangen, die auf eine ukrainische Täterschaft hinwiesen. Nun machte die Geschichte von ukrainischen Hobbytauchern die Runde. In den Medien keimte damals sogar Sympathie für die Täter auf. Wahnsinn. Aus den Hobbytauchern wurden dann bald Angehörige ukrainischer Spezialeinheiten. Zunächst hieß es, sie hätten vollkommen auf sich allein gestellt gehandelt. Dann kam langsam heraus, dass sie auf Anweisung des damaligen ukrainischen Oberbefehlshabers handelten. Angeblich wusste die politische Führung jedoch nichts davon. Wer’s glaubt. Warten wir auch die nächste Schicht der Zwiebel ab. Bislang hielt sich auch die Erzählung wacker, dass weder die USA noch sonstige westliche Staaten in die Planung eingeweiht oder gar aktiv daran beteiligt waren. Zumindest diese Erzählung ist jetzt auch Geschichte. Glaubt man dem SPIEGEL, der sich auf „vertrauenswürdige ukrainische Quellen“ beruft, war die CIA schon sehr früh in die Planung einbezogen. Es gab demnach einen regelmäßigen Austausch und die Amerikaner hatten den Anschlagsplänen wohl auch grünes Licht gegeben. Doch dann sollen sie sich – warum, das bleibt offen – plötzlich anders entschieden haben. Wer’s glaubt. Ob die CIA oder die US-Regierung dieser Version folgend die Pläne daraufhin aktiv verhindert oder ihre Verbündeten in Deutschland informiert haben, bleibt offen. Aber diese Fragen stellen sich ohnehin nur, wenn man die jetzige Version wirklich glaubt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch dies nur eine Schicht der Zwiebel ist und tieferliegende Schichten derartige Fragen ohnehin obsolet machen. Spannender als die derzeitige Geschichte selbst sind daher auch eher die Sätze zwischen den Zeilen. So heißt es im SPIEGEL-Artikel [https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nord-stream-cia-war-offenbar-frueh-in-plaene-der-angreifer-eingeweiht-a-d95f5682-dc5b-47a7-82e2-5bb09661b210] beispielsweise, dass der ukrainische Drahtzieher hinter dem Anschlag zu einer „Elitetruppe“ gehörte, „die von der CIA nach der Maidan-Revolution 2014“ aufgebaut wurde und die spätestens ab 2019 „oft mit Hilfe der USA“ verdeckt „gegen Moskau“ gearbeitet habe. Eine Quelle wird mit den Worten zitiert, man habe „gemeinsam mit den Amerikanern gearbeitet“ und „im Prinzip sei es über die Jahre egal gewesen, zu welchem Dienst (also CIA oder ukrainischer Dienst, Anm. d. Red.) man gehörte“. Interessant. Widerspricht das nicht der auch heute noch in Medien und Politik erzählten Geschichte, die USA hätten sich nicht aktiv am ukrainischen Bürgerkrieg und an Operationen gegen Russland beteiligt? Wenn man diese Sätze ernst nimmt, ist es übrigens auch unerheblich, ob die CIA oder die US-Regierung die ukrainischen Nord-Stream-Saboteure nun direkt angewiesen haben. Es ist ja eh egal, zu welchem Dienst man nun konkret gehört. Und wie reagiert das politische Deutschland auf die nun entfernte Schicht der Zwiebel? Gar nicht. Was auch sonst! Es ist schließlich auch klar, dass die Entscheidungsträger ohnehin wissen, was sich noch in den inneren Schichten der Zwiebel befindet. Am liebsten würde man das ganze Thema totschweigen. Aber wenn man das schon nicht kann, so scheint es zumindest strategisch klüger zu sein, die Schichten Teil für Teil und mit größerem zeitlichen Abstand offenzulegen. Die Öffentlichkeit vergisst schnell. Denn eins ist klar: Je näher man dem Kern der Wahrheit kommt, desto stärker gerät man in Erklärungsnot. Warum unterstützt man einen Staat, der mittels Staatsterrorismus schwere Straftaten gegen Deutschland begangen hat? Erst vor kurzen stellte der BGH fest [https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-stb6025-nord-stream-anschlag-2022-haftbeschwerde-immunitaet-ukraine-russland], dass „dringende Gründe dafür sprächen, dass der ukrainische Staat den Sabotageakt initiiert und gesteuert habe“. Und unsere Regierung sieht diesen ukrainischen Staat immer noch als besten Verbündeten? Kaum zu glauben. Noch größer wäre die Erklärungsnot, wenn nun auch offiziell offenbar würde, dass unser allerbester Verbündeter, die USA, den Anschlag nicht nur toleriert, sondern womöglich auch initiiert und gesteuert haben. Aber es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Stelle keine Fragen, deren Antwort du nicht ertragen kannst. Derweil findet das Thema Nord Stream auch auf einer ganz anderen Ebene statt, die der deutschen Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Dazu ist in der letzten Woche ein überaus lesenswerter Artikel [https://monde-diplomatique.de/artikel/!6143866?fbclid=IwY2xjawQEyvRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETJJNkhmYWczaUNSVHhrb3M5c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuzITGAYNxMHGacGUa5C29vwSM6qMiZjBAWbZjIhlHa8OnkAretCaLXTXae__aem_luWybruBQmFzBJrhYpcAnw] in der Le Monde diplomatique erschienen. Der Artikel behandelt die Schattendiplomatie zwischen Russland und den USA über eine mögliche Reparatur und Wiederinbetriebnahme der Pipelines. Hierfür gibt es nicht nur in Russland, sondern auch in den USA großes Interesse und die normative Kraft des Faktischen wird die EU ohnehin bald zwingen, sich diesem Unterfangen nicht mehr zu verschließen. In Alaska stand die gemeinsame russisch-amerikanische Wiederinbetriebnahme von Nord Stream bereits auf der Agenda. Auch dieser Artikel glänzt aber durch das, was dort zwischen den Zeilen geschrieben ist. So wird beispielsweise unter Verweis auf amerikanische Geheimdienstquellen behauptet, dass die USA schon 2024 – also vor Trumps Wiederwahl – aktiv Interesse an einer Wiederinbetriebnahme von Nord Stream gezeigt haben, um – und hier wird es besonders interessant – „die Pipelines als politischen Hebel gegen Europa zu nutzen“. Das ist durchaus glaubhaft und vervollständigt das Mosaik. Während man in Deutschland immer noch glaubt, es ginge bei dem Anschlag um Russland, wird immer deutlicher, dass Europa das eigentliche Ziel ist. Es ging nie darum, Russland zu schwächen. Es ging den Amerikanern zu jedem Zeitpunkt nur darum, die europäische Energieversorgung zu steuern und Europa so in der Hand zu haben. > Jetzt aber, da Trump sich von der transatlantischen Partnerschaft abwendet, begnügen sich die USA nicht mehr damit, den Europäern LNG zu verkaufen und einer russisch-europäischen Annäherung entgegenzuarbeiten. Sie wollen mehr: eine verstärkte Kontrolle der Energieinfrastrukturen – und zwar auch in Europa. > Quelle: LMd [https://monde-diplomatique.de/artikel/!6143866?fbclid=IwY2xjawQEyvRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETJJNkhmYWczaUNSVHhrb3M5c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuzITGAYNxMHGacGUa5C29vwSM6qMiZjBAWbZjIhlHa8OnkAretCaLXTXae__aem_luWybruBQmFzBJrhYpcAnw] Zählt man eins und eins zusammen, ergibt sich hieraus die größtmögliche Demütigung Europas. Henry Kissinger soll einst gesagt haben: „Wer die Energie beherrscht, beherrscht die Welt“. Er hatte damit nicht ganz unrecht. Nord Stream zeigt, dass Europa die Energie nicht beherrscht. Doch wo bleibt die Diskussion? Wo bleibt der Aufschrei? Titelbild: Frame Stock Footage/shutterstock.com[http://vg04.met.vgwort.de/na/c823a06d9ea845fa8a2f4bb816b97975]
Tilo Jung will dafür „kämpfen“, dass Florian Warweg aus der BPK ausgeschlossen wird
Es gebe „kein Recht“ darauf, Mitglied der Bundespressekonferenz (BPK) zu werden, „insbesondere nicht als ehemaliger Mitarbeiter eines russischen Propagandasenders“. Das sagt der Journalist Tilo Jung, der sich gleichzeitig an anderer Stelle als Streiter für die Rechte von Journalisten aufspielen will. Diese Doppelmoral ist ein Zeichen der Zeit. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Der Journalist Tilo Jung hat – bezogen auf den Journalisten und ehemaligen Redakteur der NachDenkSeiten Florian Warweg – kürzlich auf X mitgeteilt [https://x.com/TiloJung/status/2024139845287714904]: > „Als Mitglied des Vereins der BPK ist es mein gutes Recht gegen die Aufnahme neuer Mitglieder Einspruch einzulegen, da Warweg aus meiner Sicht nichts im Verein zu suchen hat. Das gilt auch weiterhin und dafür kämpfe ich. Befasse dich mit den Tatsachen.“ Er fährt fort: > „Es gibt kein Recht Mitglied der BPK zu werden. insbesondere nicht als ehemaliger Mitarbeiter eines russischen Propagandasenders.“ Ein anderer Nutzer fragt: „Mit welchem Recht bist du dann Mitglied?“ Jung: antwortet: > „Ich habe die Zugangsvoraussetzungen erfüllt“ Ausgelöst wurden die Äußerungen durch Kritik an doppelten Standards: Kürzlich hatte Jung Ausführungen des Filmjournalisten Rüdiger Suchsland kritisiert. Der hatte gesagt, man solle künftig den Zugang zu Pressekonferenzen selektiver gestalten, zu sehen in diesem Ausschnitt [https://x.com/TiloJung/status/2024069919348830470]. Jung hatte dazu geschrieben: > „Manche meiner Kollegen sind sich wirklich für nichts zu dumm: Journalisten fordern die Beschneidung von Rechten von Journalisten.“ Einerseits gegen die Aufnahme von bestimmten Kollegen in die BPK zu trommeln und sich andererseits mit Sprüchen gegen die Zugangsbeschränkung von Pressekonferenzen als Kämpfer für Journalisten-Rechte aufzuspielen, diese Doppelmoral hat die Journalistin Aya Velazquez in diesem Beitrag auf X [https://x.com/aya_velazquez/status/2024160360018608430?s=46] so illustriert: [https://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/269220-jung.jpg] In diesem X-Beitrag [https://x.com/aya_velazquez/status/2024498740715835819] geht Velazquez näher auf die Vorgänge ein. Florian Warweg hat sich in diesem X-Beitrag [https://x.com/fwarweg/status/2024174611428970749?s=43&t=a7Mtaj64iAIk-uNWh6pS0g] dazu geäußert. Der Rechtsanwalt Markus Kompa geht in diesem Interview [https://www.telepolis.de/article/Bundespressekonferenz-gegen-Journalist-Das-ist-Realsatire-vom-Allerfeinsten-9305438.html] auf juristische Fragen des Zugangs zur BPK ein. Warweg ist nicht der erste Journalist, dessen Anwesenheit in der BPK Widerstand hervorruft, erinnert sei etwa auch an die Vorgänge um Boris Reitschuster [https://www.nachdenkseiten.de/?p=70046]. Doppelte Standards Was soll das eigentlich heißen, wenn Jung schreibt, Warweg „hat dort nichts zu suchen“? Und wer definiert eigentlich, wer ein „echter“ Journalist ist und wer nicht? Und würde sich eine restriktive Auslegung dieser Definition nicht auch gegen Jung selber wenden? Auffällig ist die offensive Art, mit der Jung seine doppelten Standards verteidigt. Das ist ein Zeichen der Zeit: Dinge wie freie Meinungsäußerung, gleichberechtigter Zugang zur Monopolveranstaltung BPK etc. werden ganz offen bekämpft, ohne Scham zu empfinden – und dabei wird auch noch so getan, als würde man für eine gute Sache streiten. Die Beurteilung des Vorgangs hat nichts mit inhaltlichen Standpunkten zu tun: Alle Journalisten müssen Zutritt zur BPK erhalten – egal, welche Meinung sie vertreten und wo sie vorher gearbeitet haben, solange sich das im Rahmen der Verfassung bewegt. Wenn einigen Journalisten die Anwesenheit von kritischen Kollegen nicht gefällt, weil das auch ein peinliches Licht auf ihre eigenen angepassten Fragen wirft, dann ist das deren persönliches Problem. Ein Problem für das Prinzip Meinungsfreiheit entsteht erst, wenn schon das Stellen von (bestimmten) Fragen skandalisiert wird. Welpenschutz für Regierungssprecher Die NachDenkSeiten üben viel Kritik an Inhalten in den „etablierten“ Medien – aber wir fordern doch nicht den Ausschluss von deren Personal oder dass sie im Meinungskampf benachteiligt werden. Ich würde nie auf die Idee kommen, für den Ausschluss von Tilo Jung aus der BPK zu trommeln. Viele seiner Inhalte (nicht alle) widersprechen meiner Meinung, z.B. sein angepasstes Verhalten während der Corona-Zeit. Trotzdem wäre auch sein Ausschluss natürlich eine Art der Zensur. Und dafür zu werben, würde ich zusätzlich als unkollegial empfinden. Dass Jung anscheinend denkt, dass er mit diesem Verhalten irgendwo Punkte machen kann, ist bedenklich. Der „Kampf“ dafür, kritischen Journalisten den Zugang zur BPK zur verwehren, erscheint auch wie ein übertriebener Schutz-Reflex für die Regierungssprecher, die auf deren Fragen antworten müssen. Können die sich nicht mit Argumenten „wehren“? Wenn ihre Position so unangreifbar wäre, dann sollte es doch ein Leichtes sein, sie in der BPK zu verteidigen. Der von Tilo Jung und Anderen „bekämpfte“ Florian Warweg hat in der BPK für die NachDenkSeiten guten und seriösen Journalismus gemacht, davon können sich die Leser unter diesem Link [https://www.nachdenkseiten.de/?tag=bundespressekonferenz] überzeugen. Seit seinem Wechsel zur OAZ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=145045] führt er diese Arbeit dort fort – man kann für die Meinungsfreiheit nur hoffen, dass der „Kampf“ des Tilo Jung keinen Erfolg hat. Titelbild: Screenshot NachDenkSeiten, Bundespressekonferenz 21.01.2026 Mehr zum Thema: Die NachDenkSeiten auf der BPK [https://www.nachdenkseiten.de/?tag=bundespressekonferenz] [https://vg08.met.vgwort.de/na/c230ae7e50f94921a63f3bce682f90d3]
Merz will Klarnamenpflicht im Internet – diese Forderung kommt dem Austritt aus der Demokratie gleich
„Aber ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte wissen, wer da sich zu Wort meldet“ [https://x.com/AMoehnle/status/2024224990594314667] – das sagte Friedrich Merz am politischen Aschermittwoch in Trier. Auf schwerste Grundrechtseingriffe während der Coronazeit und der Unterstützung des EU-„Desinformationssanktionsregimes“ folgt nun also ein weiterer Angriff auf die Demokratie. Klarnamenpflicht im Internet: Das ist so, als müsste sich jemand, der auf dem Marktplatz Merz‘ Rücktritt fordert, vorher ein Namensschild umhängen. Hat der Bundeskanzler schon mal etwas von der „Speakers‘ Corner“ in England gehört? Dort gibt es auch keine Klarnamenpflicht. Eine solche würde den Geist der Demokratie beschämen. Die Klarnamenpflicht im Internet ist demokratisch untragbar – wer sie fordert, verabschiedet sich aus der Demokratie. Ein Kommentar von Marcus Klöckner. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Klarnamenpflicht im Internet – das will der Bundeskanzler. Klarnamenpflicht im Internet – das widerspricht dem demokratischen Geist. Klarnamenpflicht im Internet – das ist so, als müsste sich jemand, der auf dem Marktplatz sagt, Merz solle zurücktreten, vorher ein Namensschild umhängen. Wie soll es weitergehen? Sollen demnächst Wahlen nicht mehr geheim sein? Wahlen nur noch unter öffentlicher Bekanntgabe, wer wie gewählt hat? Peter Maier hat die CDU gewählt: Applaus! Eva Maier hat die AfD oder das BSW gewählt: öffentliche Beschämung und Verfolgung? So langsam sollte es jedem klar werden: Den Kampf um die jämmerlichen Reste der öffentlichen Debattenräume versucht die Politik mit immer dreckigeren Mitteln für sich zu entscheiden. In einer freien, offenen, demokratischen Gesellschaft muss es für jeden Staatsbürger möglich sein, seine Meinung öffentlich ohne Nennung seines Namens kundzutun. Die Anonymität ist ein Schutzraum, der für eine Demokratie von elementarer Bedeutung ist. Politische Meinungsäußerungen kommen längst einem Gang durch ein Minenfeld gleich. Nicht jeder hat den Mut und die Kraft, seine politische Position öffentlich unter seinem vollen Namen zu äußern. Deshalb hat eine demokratische Gesellschaft den Raum des Anonymen zu gewähren. Wer nämlich befürchten muss, dass auf die Äußerung der eigenen politischen Meinung die Knute folgt, wird sich aus der öffentlichen Diskussion zurückziehen – und damit wird die Demokratie erstickt. Hat Friedrich Merz jemals etwas von der Speakers‘ Corner in England gehört? Die Speakers‘ Corner ist ein weltberühmter Ort, an dem der Geist der Demokratie zelebriert wird. Speakers‘ Corner – das ist jene Stelle im Londoner Hyde Park, wo auf einer freien Fläche jeder Mensch sich auf eine Kiste stellen darf, um frei öffentlich das zu sagen, was er denkt. Persönlichkeiten wie Karl Marx, Lenin, George Orwell oder Emma Goldman haben dort vorgetragen. Alles kann an der Speakers‘ Corner frei gesagt werden: Geniales und Abgedrehtes, Höfliches und Unverschämtes – alles darf und soll gehört werden. Gerade dadurch, dass an diesem Ort jeder anonym sprechen darf, ist die Speakers‘ Corner zum Symbol für Meinungsfreiheit geworden. Eine „Klarnamenpflicht“ gibt es dort nicht. Bei allen autoritären Entwicklungen, die auch in Großbritannien zu beobachten sind: Klarnamenpflicht an der Speakers‘ Corner? Ein Unding! Der Jurist Niko Härting [https://www.nachdenkseiten.de/?p=68202] spricht von einem „Menschenrecht“ [https://x.com/nhaerting/status/2024321286953177386] in Bezug auf die anonyme Rede. Doch eine Klarnamenpflicht im Internet wäre noch schlimmer als die Pflicht zum Umhängen eines Namensschildes bei einer Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit. Wer seinen Namen in der Internetöffentlichkeit unter jedem Posting angeben muss, wird für die gesamte Welt sichtbar – und wird es bleiben, solange es das Internet gibt. Arbeitgeber könnten so nach der politischen Gesinnung ihrer Mitarbeiter oder von Bewerbern Ausschau halten – und entsprechend agieren. Längst liegen die Karten auf dem Tisch. Der Politik schmeckt nicht, dass sie kritisiert wird. Sie hat ein Problem damit, dass sie nicht die Kontrolle über die Debattenräume im Internet hat. Die öffentliche Diskussion auf den großen Plattformen der öffentlich-rechtlichen Medien ist ohnehin längst abgewürgt. Das ist im Sinne der Politik. Dass im Internet Max Mustermann vor den Gefahren der Corona-Impfung warnt, Lieschen Müller sich traut, „Stellvertreterkrieg“ zu sagen und Heiner Maier den Rücktritt der Regierung fordert, soll verhindert werden. Um nichts anderes geht es bei der Klarnamenpflicht im Internet. Die Klarnamenpflicht im Internet ist demokratisch untragbar – wer sie fordert, verabschiedet sich aus der Demokratie. Titelbild: penofoto / Shutterstock
Kies je abonnement
Tijdelijke aanbieding
Premium
20 uur aan luisterboeken
Podcasts die je alleen op Podimo hoort
Gratis podcasts
Elk moment opzegbaar
2 maanden voor € 1
Daarna € 9,99 / maand
Premium Plus
Onbeperkt luisterboeken
Podcasts die je alleen op Podimo hoort
Gratis podcasts
Elk moment opzegbaar
Probeer 30 dagen gratis
Daarna € 11,99 / maand
2 maanden voor € 1. Daarna € 9,99 / maand. Elk moment opzegbaar.