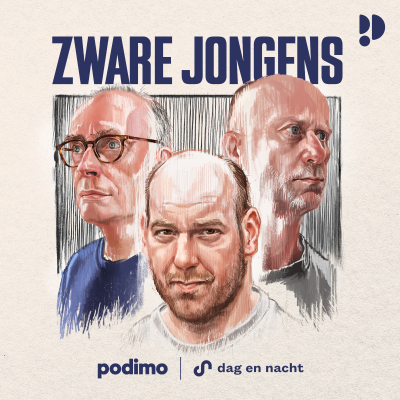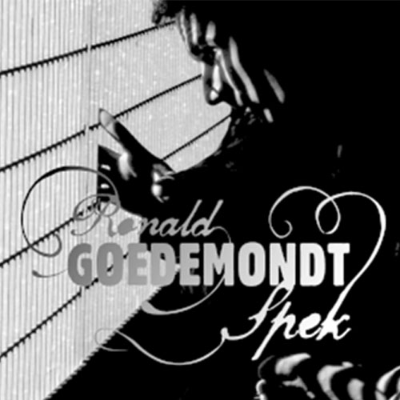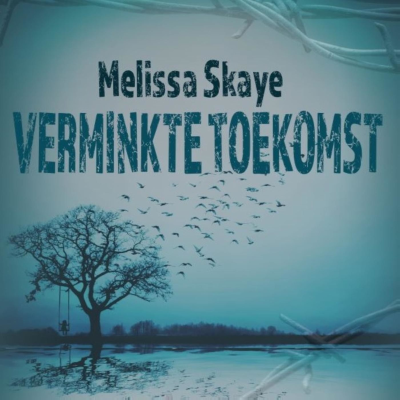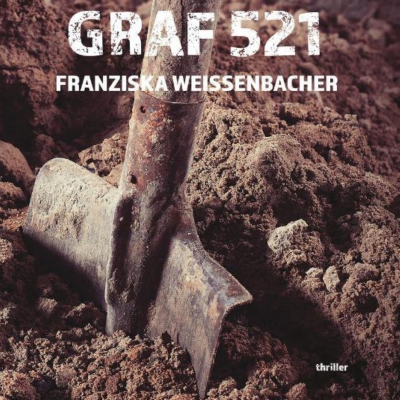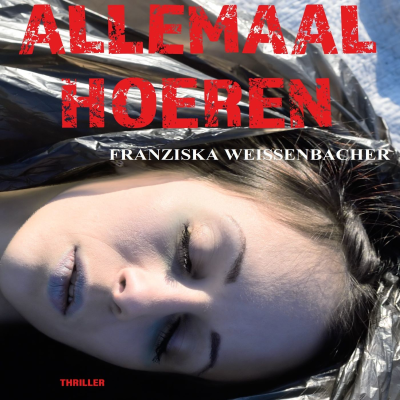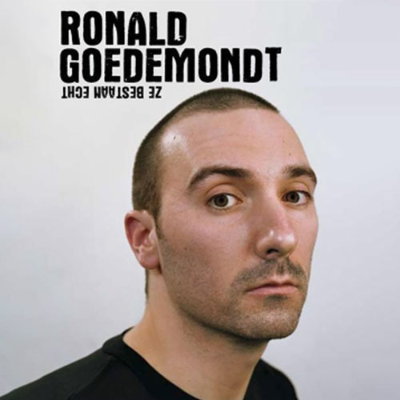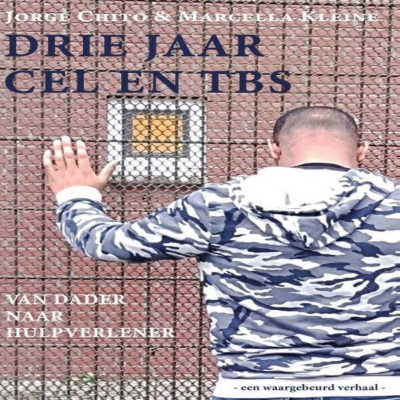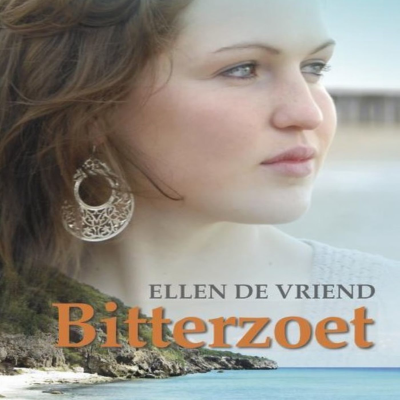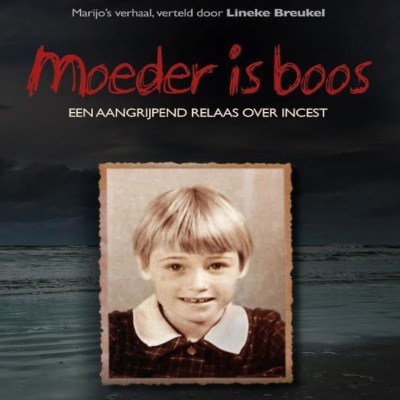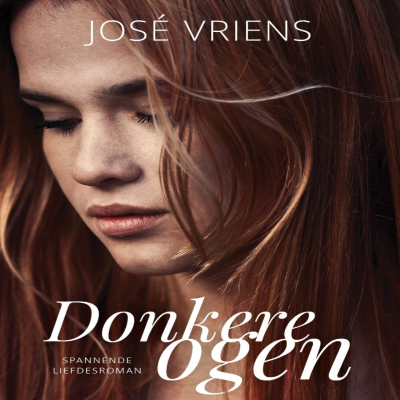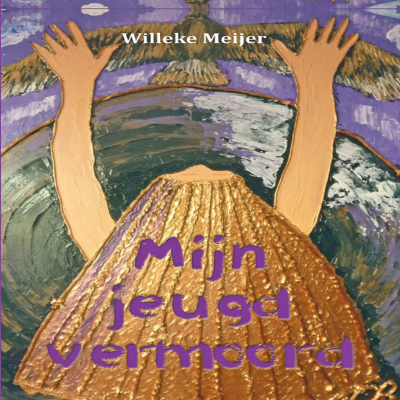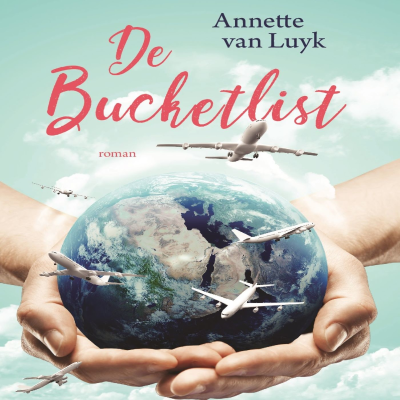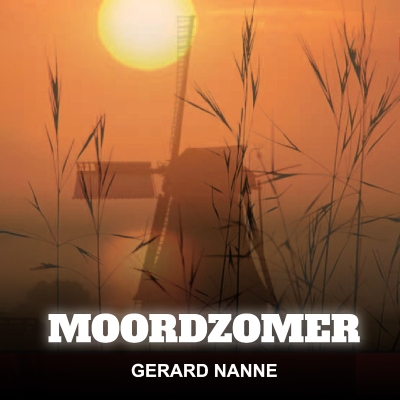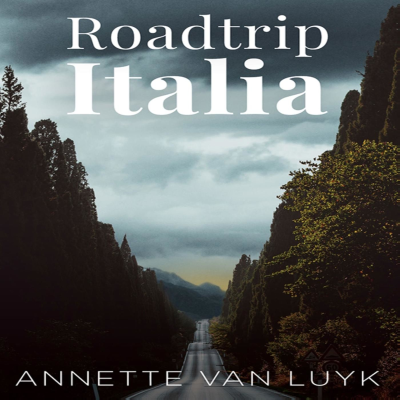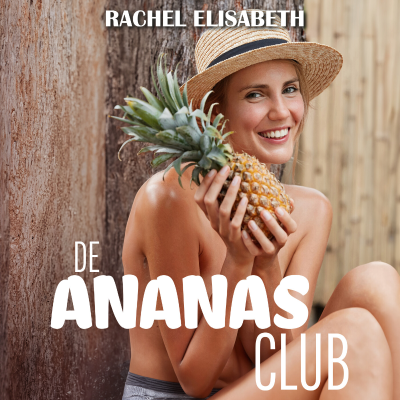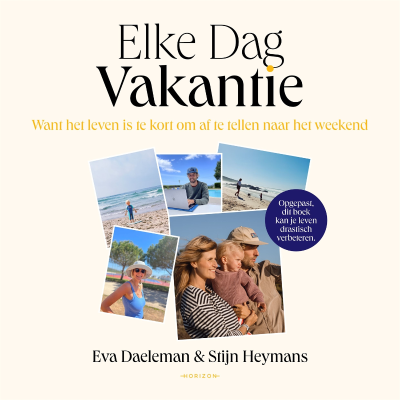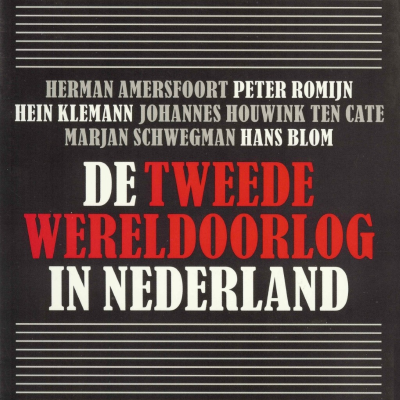provisorisch legal - der Drogen-Podcast
Podcast door Lidia Polito, Tom Dietrich
Probeer 14 dagen gratis
€ 9,99 / maand na proefperiode.Elk moment opzegbaar.
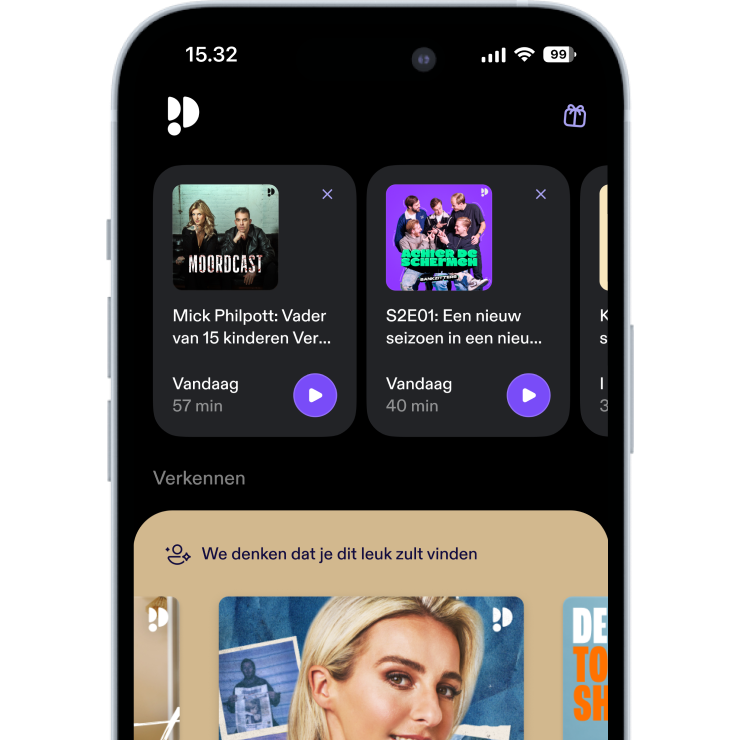
Meer dan 1 miljoen luisteraars
Je zult van Podimo houden en je bent niet de enige
Rated 4.7 in the App Store
Over provisorisch legal - der Drogen-Podcast
Der Podcast über Drogen und alles, was damit zu tun hat: Substanzforschung, Geschichte, Substitution, Rausch, Abhängigkeit, Legalisierung. Einmal im Monat erzählt ein Gast neuen Input aus der Welt der bewusstseinserweiternden Substanzen. Ihr könnt provisorisch legal per E-Mail erreichen: provisorischlegal@gmail.com
Alle afleveringen
32 afleveringen„Die Obdachlosen sind die Zeugen der Wahrheit, die die Gesellschaft nicht hören will“, schreibt Adorno in seinen Minima Moralia. Diese Wahrheit ist unbequem. Sie zeigt sich im öffentlichen Raum, in Großstädten, in Köln etwa an Orten wie dem Neumarkt oder dem Wiener Platz. In dieser Folge fragen wir: Wem gehört der öffentliche Raum? Und was bedeutet er für diejenigen, die keinen privaten Raum haben? Gemeinsam mit Claudia und Bina von Vision e.V. [https://www.vision-ev.de] und dem Journalisten Max Hübner sprechen wir über die aktuelle Situation wohnungsloser und konsumierender Menschen am Beispiel Köln, über Rückzugsorte, Drogenkonsumräume – und darüber, was sich ändern muss. Diese Folge wurde am 19.6.2025 live in der Grotte des Schauspiel Köln im Rahmen der Veranstaltungsreihe Studiobüdchen [https://www.schauspiel.koeln/spielplan/a-z/das-studiobuedchen/] aufgenommen.
In dieser Folge erzählt der Anthropologe Nicolas Langlitz von seiner Forschung und aktuellen Entwicklungen im Feld der Psychedelika. Nicolas Langlitz ist Professor für Anthropologie an der New Yorker Universität The New School for Social Research. 2012 erschien sein Buch »Neuropsychedelia«, eine anthropologische Studie über die die Wiederaufnahme der Psychedelika-Forschung. Seitdem hat er zahlreiche weitere Artikel zum Thema Psychedelika veröffentlicht. Im Gespräch geht es um Feldforschung in neurowissenschaftlichen Laboren, die psychedelische Renaissance, Forschung zwischen Mystik und Materialismus, Aldous Huxley und seine perenniale Philosophie, psychedelische Plattitüden, die Paradoxien der geisteswissenschaftlichen Psychedelika-Forschung, Ich-Auflösungen in Zeiten von Identitätspolitik, das Interesse der politischen Rechten an Psychedelika und deren Liberalisierungsvorhaben, die Krise der Psychopharmakologie, nicht-psychedelische Psychedelika, der Stand von Psychedelika in Deutschland und das Buch als extrapharmakologischen Faktor. Literatur: Nicolas Langlitz: »Neuropsychedelia. The Revival of Hallucinogen Research since the Decade of the Brain«. Berkeley 2012. –: »Rightist Psychedelia«. In: Cultural Anthropology, Hot Spots, Fieldsights, 10 July 2020. –: »What Good Are Psychedelic Humanities?«. In: Frontiers in Psychology 14 (2023). –: »The Paradoxes of Psychedelic Humanities«. In: Rob Lovering (Hrsg.), Palgrave Handbook of Philosophy and Psychoactive Drug Use. Cham 2024. S. 281-297. –: »Psychedelic Innovations and the Crisis of Psychopharmacology«. In: BioSocieties 19 (2024), S. 37-58. –: »Das Buch als extrapharmakologischer Faktor«. In: Ines Barner et al.(Hrsg.): Über Bücher. 101 Texte und Bilder für Michael Hagner. Göttingen 2025. S. 39-42. Auf Nicolas' Website könnt ihr viele seiner Artikel herunterladen: http://www.nicolaslanglitz.de/ [http://www.nicolaslanglitz.de/]
Augenringe, blasse Haut, extrem schlanke Körper – inszeniert vor heruntergekommenen Industriefassaden. Der Heroin Chic war eines der prägendsten und umstrittensten Modephänomene der 90er-Jahre und zumindest der Begriff erlebt seit kurzem ein Comeback. Aber wie genau funktioniert der Heroin Chic eigentlich? Warum kaufen wir Kleidung, die von kränklich wirkenden Models beworben wird? Und was verrät das über unsere Gesellschaft? Darum geht es im Gespräch mit Melanie Haller, Professorin für Geschichte und Theorie der Mode, des Designs und der Ästhetik an der Akademie Mode und Design der Fresenius Hochschule in Hamburg. Wir sprechen ausführlich über die Entstehungsgeschichte des Heroin Chic, seine Abgrenzung zur Mode der 80er-Jahre, Fotografien von Corinne Day und Mario Sorrenti, Bill Clintons Kritik an der Modeindustrie, Mode und Vergänglichkeit, die Ästhetik des Krankseins, den Emo-Style, Ozempic Chic, Raf Simons, Christiane F. und den nicht-drogeninduzierten Rausch der Mode. Corinne Day – Georgina, Brixton: https://collections.vam.ac.uk/item/O83171/georgina-brixton-photograph-day-corinne/ [https://collections.vam.ac.uk/item/O83171/georgina-brixton-photograph-day-corinne/] Calvin Klein Kampagne mit Kate Moss: https://beauty.at/parfum/woman/Calvin-Klein-Obsessed.html [https://beauty.at/parfum/woman/Calvin-Klein-Obsessed.html] Raf Simons Kampagne: https://www.vogue.de/mode/artikel/raf-simons-christiane-f-herbst-winter-kollektion [https://www.vogue.de/mode/artikel/raf-simons-christiane-f-herbst-winter-kollektion] Bill Clinton Rede: https://www.c-span.org/video/?81488-1/administration-drug-policy [https://www.c-span.org/video/?81488-1/administration-drug-policy] Literatur: Arnold, Rebecca: Heroin Chic. In: Fashion Theory. The Journal of Dress, Body & Culture. 3 (1990), S. 279-295. Sontag, Susan: Krankheit als Metapher. Frankfurt 1996. Weis, Diana: Somästhetik. Moderne, Drogen und Depression. In: Pop. Kultur und Kritik. Bielefeld 2019. 14 (2019), S. 25-35.
Aus den Blättern des Kratombaums wird in Indonesien, Thailand und Malaysia traditionell ein Tee gekocht, der Schmerzen lindert und entspannt. Verbreitet ist außerdem die Blätter zu kauen, um länger wach bleiben und schwere körperliche Arbeit besser aushalten zu können. Kratom ist ein leichtes Opioid und wird deshalb vor allem in den USA immer beliebter: Die Opioidkrise lässt Menschen nach Alternativen zu etwa Fentanyl suchen. Unternehmen entwickeln Kratom-Extrakte, die sehr viel potenter sind, als die reinen Blätter oder das daraus gewonnene Pulver. Kratom gewinnt auch in Deutschland mehr Aufmerksamkeit. Toxikologe Fabian Steinmetz erklärt in dieser Folge, warum das so ist und warum Kratom ihn schon sehr viel länger interessiert. Fabian Steinmetz arbeitet als Toxikologie bei Delphic HSE und engagiert sich als aktives Mitglied beim Drogenexperten-Netzwerk Schildower Kreis [https://schildower-kreis.de] und beim Deutschen Hanfverband Darmstadt [https://dhv-da.de]. Ihr könnt ihm auf X [https://x.com/docsteinmetz] und Instagram [https://www.instagram.com/docsteinmetz?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==] folgen.
Obwohl Khat in manchen Ländern von mehr als der Hälfte der Bevölkerung konsumiert wird, ist es hierzulande kaum jemandem ein Begriff. Im Interview erzählt der Psychologe Michael Odenwald, was Khat ist und wie es in den Ländern Ostafrikas und der arabischen Halbinsel den Alltag prägt. Außerdem geht es unter anderem um die Bedeutung des Kauens als primäre Konsumform, Khat als „milde Droge“, Khatkonsum in militärischen Konflikten, Konsum unter Frauen und der Prohibition von Khat in Europa.
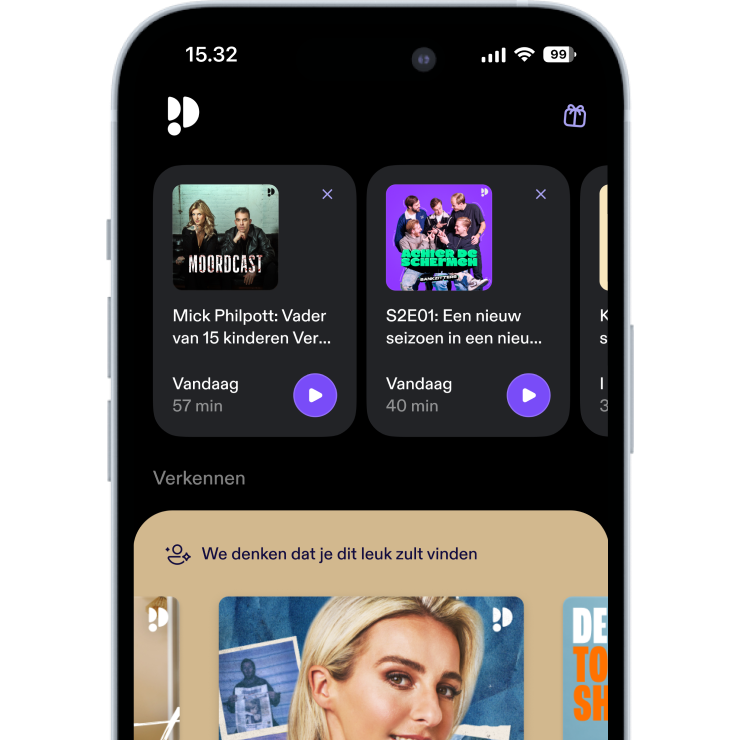
Rated 4.7 in the App Store
Probeer 14 dagen gratis
€ 9,99 / maand na proefperiode.Elk moment opzegbaar.
Exclusieve podcasts
Advertentievrij
Gratis podcasts
Luisterboeken
20 uur / maand