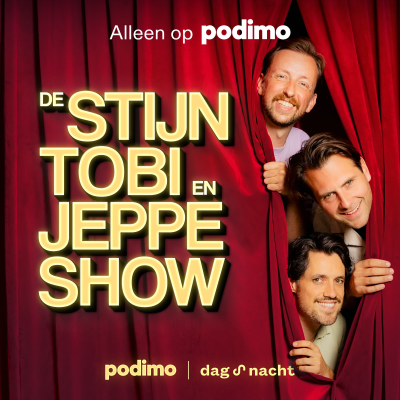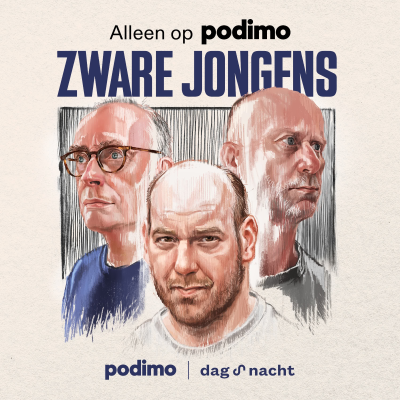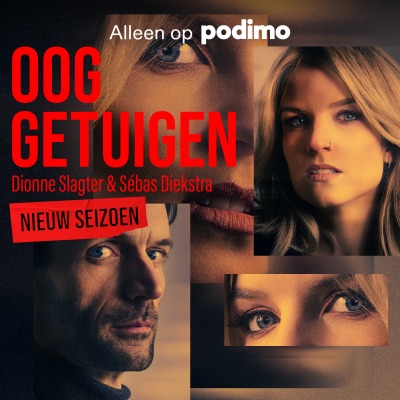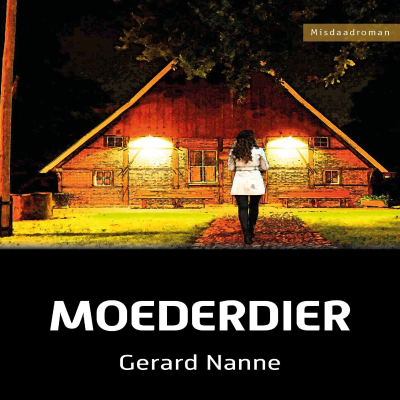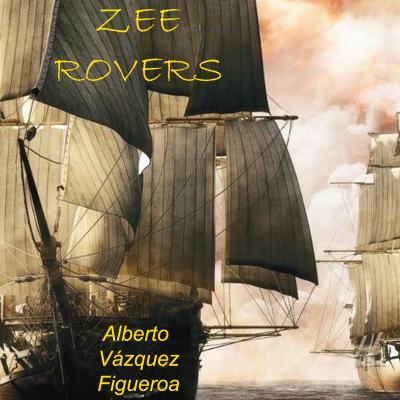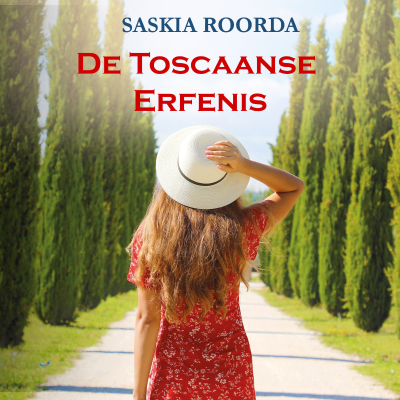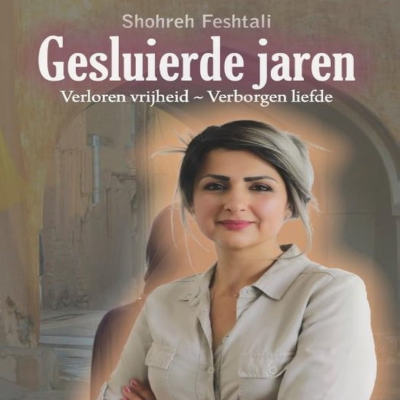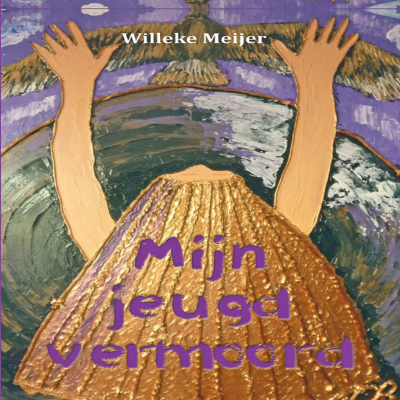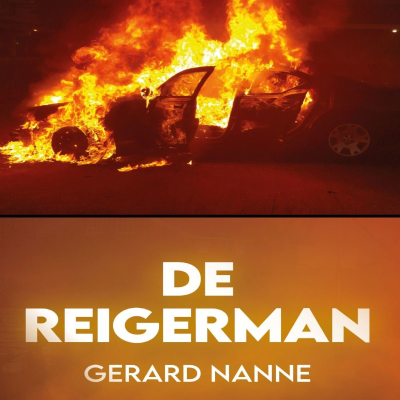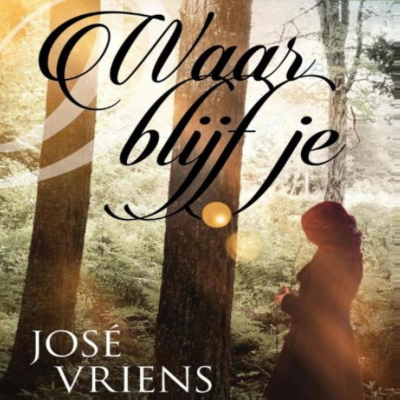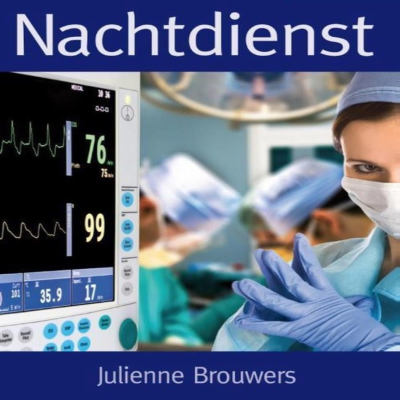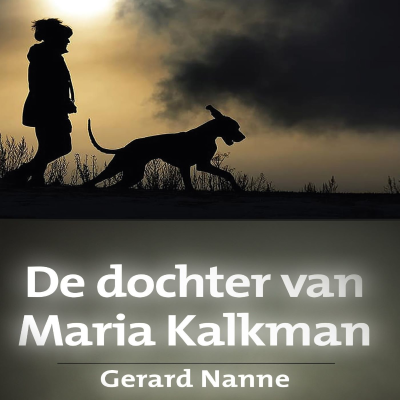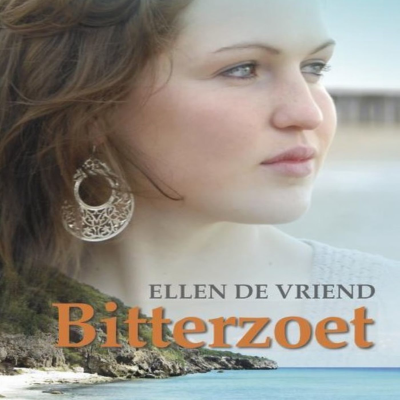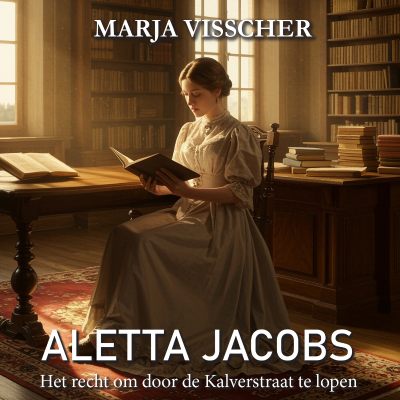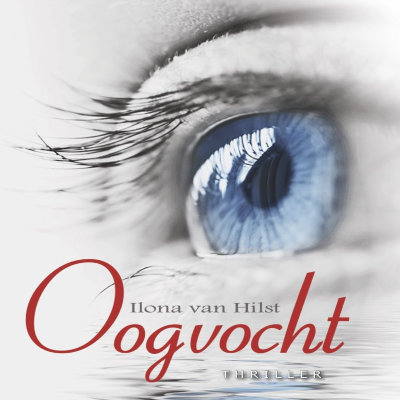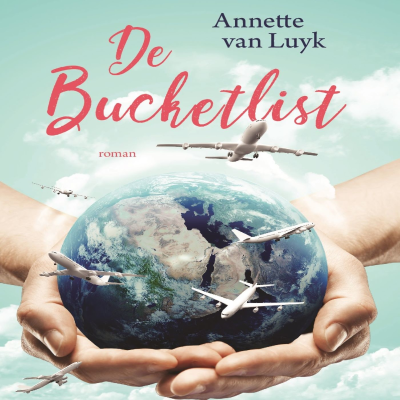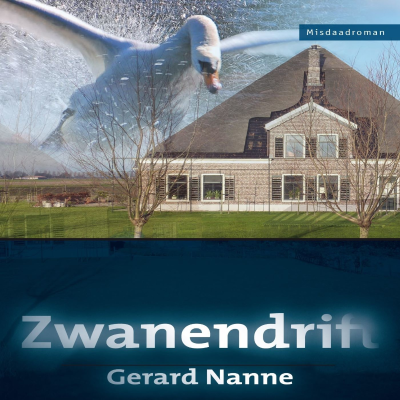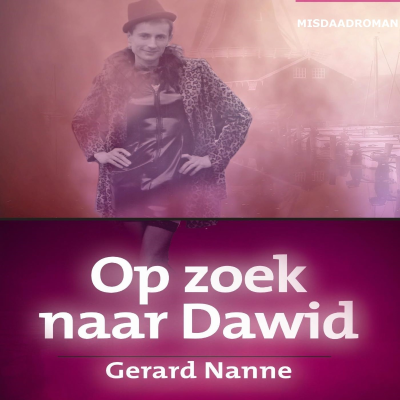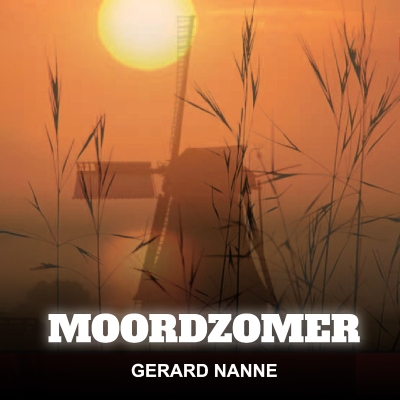Radiowissen
Duits
Technologie en Wetenschap
Tijdelijke aanbieding
1 maand voor € 1
Daarna € 9,99 / maandElk moment opzegbaar.
- 20 uur luisterboeken / maand
- Podcasts die je alleen op Podimo hoort
- Gratis podcasts
Over Radiowissen
Die ganze Welt des Wissens, gut recherchiert, spannend erzählt. Interessantes aus Geschichte und Archäologie, Literatur, Architektur, Film und Musik, Beiträge aus Philosophie und Psychologie. Wissenswertes über Natur, Biologie und Umwelt, Hintergründe zu Wirtschaft und Politik. Und immer ein sinnliches Hörerlebnis.
Alle afleveringen
298 afleveringenMusikhören früher - Als es nur Live-Musik gab
Musik ist allgegenwärtig. Immer und überall werden wir mit Musik beschallt: im Radio, im Kaufhaus, im Supermarkt oder in der U-Bahn. Heute ist Musik außerdem unendlich kopier- und speicherbar. Doch wie war das in früheren Jahrhunderten? Credits: Autor: Markus Mähner Regie: Sabine Kienhöfer Sprecher/-innen: Rahel Comtesse, Thomas Birnstiel und Peter Weiß Technik: Moritz Herrmann Redaktion: Thomas Morawetz Interview mit: Prof. Dr. Joachim Eibach, Extraordinariat Neuere und Neueste Geschichte am Institut für Geschichte, Universität Bern Literatur: Joachim Eibach: Fragile Familien. Ehe und häusliche Lebenswelt in der bürgerlichen Moderne. De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2022. ISBN 9783110749373 Joan Marie Bloderer: Zitterspiel in Wien 1800-1850, Schneider Verlag 2008 Sebastian Franz von Daxenberger alias Carl Fernau (1809-1878): (Münchner Jurist & Politiker): Münchner Hundert und Eins. (1841) I, S. 23-25 Johann Gabriel Seidl (1804-1875): (Archäologe, Schriftsteller und Textdichter von "Gott Erhalte Franz den Kaiser): Altwiener Novellen (1839) Charles Sealsfield (1793-1864): (Pseud. für Karl Postl, Schriftsteller, der 1823 aus dem KuK-Kaiserreich in die USA floh): Österreich, wie es ist oder: Skizzen von Fürstenhöfen des Kontinents von einem Augenzeugen. London 1828.S.131 Carl Maria von Weber (1786-1826) Brief an seine Frau: London den 23. März 1826. Abends 10 Uhr. Brief No.13 Linktipp: Synthesizer und Co - Elektronische Musikerzeugung Der Synthesizer: Heute hauptsächlich in der Pop-Musik benutzt, war er ursprünglich Instrument der experimentellen klassischen Musik. Der Synthesizer für jedermann kam erst in den 1960er Jahren auf den Markt. Von Markus Mähner (BR 2019) https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:24b5e4e0effb26dd/ Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de [radiowissen@br.de]. Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek. [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/urn:ard:show:a5369fa8556fcd7b/] Das vollständige Manuskript gibt es hier. [https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/manuskripte/index.html] Wir freuen uns über eure Kommentare und Diskussionsbeiträge. Bitte beachtet unsere Netiquette [https://www.br.de/service/kommentare-netiquette-richtlinien-110.html]und Tipps für Kommentare.
Gastarbeiterinnen in Deutschland (2/2)
Als die Griechin Irina Vavitsa von einer freiwilligen Zulage nur für Deutsche erfährt, ist das Fass voll. In Lippstadt kommt es zum "wilden Streik" und nicht nur dort. Gastarbeiterinnen kämpften für bessere Arbeitsbedingungen - für alle. Credits: Autorin: Silke Wolfrum Redaktion: Thomas Morawetz Regie: Kirsten Böttcher Technik: Susanne Harasim Sprecher/-innen: Xenia Tiling, Christian Schuler, Katja Schild Interviews mit: Irina Vavitsa: Gastarbeiterin aus Griechenland, arbeitete bei Hella in Lippstadt, Gewerkschaftsmitglied Dr. Simon Goeke: Kurator für Migrationsgeschichte am Münchner Stadtmuseum, Autor des Buches „Wir sind alle Fremdarbeiter! Gewerkschaften, migrantische Kämpfe und soziale Bewegungen in Westdeutschland 1960-1980 Archivmaterial: Titel: „Tagesschau vom 17.08.1973“ – „Wilder Streik bei der Firma Pierburg in Neuss“ Literatur: Simon Goeke, „Wir sind alle Fremdarbeiter. Gewerkschaften, migrantische Kämpfe und soziale Bewegungen in Westdeutschland 1960-1980“, eine umfassende Darstellung der Geschichte der sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik in Verbindung mit der Migrationsgeschichte Jochen Oltmer, „Migration. Geschichte und Zukunft der Gegenwart“, eine Einbettung der Debatten der Gegenwart in die Geschichte der Migration als zentrales Element gesellschaftlicher Veränderung Gün Tank, „Die Optimistinnen: Roman unserer Mütter“, Roman über den erfolgreichen Kampf junger Gastarbeiterinnen gegen Lohndiskriminierung bei Pierburg in Neuss Kölnischer Kunstverein (Hrsg): „Projekt Migration“ (Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung von 2005/2006 im Kölner Kunstverein). Darin zahlreiche interessante Artikel, z.B. von Helmut Dietrich über Ausländerpolitik in der BRD oder von Manuel Gogos über die deutsche Besatzung in Griechenland und die griechische Arbeitsmigration nach Deutschland Weiterführender Link: Millionen von Afroamerikanern verließen zwischen 1910 und 1970 den Süden der USA und zogen in den industriell geprägten Norden und Westen des Landes. Sie flohen vor Rassismus und suchten neue Hoffnung: Die "Große Migration" - Afroamerikaner ziehen in den Norden der USA: [https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:1fea391dd4b2f098/xx] Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de [radiowissen@br.de]. Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek. [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/urn:ard:show:a5369fa8556fcd7b/] Das vollständige Manuskript gibt es hier. [https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/manuskripte/index.html] Wir freuen uns über eure Kommentare und Diskussionsbeiträge. Bitte beachtet unsere Netiquette [https://www.br.de/service/kommentare-netiquette-richtlinien-110.html]und Tipps für Kommentare.
Quantenphysik - Wahr, aber verrückt
In der Quantenwelt sind Dinge möglich, die völlig absurd erscheinen. Teilchenpaare sind etwa auf rätselhafte Weise miteinander verbunden, trotz riesiger Distanz zwischen ihnen. Die Quantenphysik hat unser gesamtes Weltbild verändert. Credits: Autor: David Globig Redaktion: Nicole Ruchlak Regie: Martin Trauner Technik: Fabian Zweck Sprecher/-innen: Katja Amberger, Florian Schwarz Linktipp: Spanende Berichte über aktuelle Forschung und Kontroversen aus allen relevanten Bereichen wie Medizin, Klima, Astronomie, Technik und Gesellschaft gibt es bei IQ - Wissenschaft und Forschung: BAYERN 2 | IQ - WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG [https://www.ardaudiothek.de/sendung/iq-wissenschaft-und-forschung/5941402/] Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de [radiowissen@br.de]. Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek. [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/urn:ard:show:a5369fa8556fcd7b/] Das vollständige Manuskript gibt es hier. [https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/manuskripte/index.html] Wir freuen uns über eure Kommentare und Diskussionsbeiträge. Bitte beachtet unsere Netiquette [https://www.br.de/service/kommentare-netiquette-richtlinien-110.html]und Tipps für Kommentare.
Gastarbeiterinnen in Deutschland (1/1)
Mit 21 bricht die Griechin Irina Vavitsa ins Paradies auf und landet in Deutschland am Fließband - wie so viele Frauen. "Gastarbeit" war für sie ein Weg in die Unabhängigkeit und Ausbeutung zugleich. Und in den Arbeitskampf. Credits: Autorin: Silke Wolfrum Redaktion: Thomas Morawetz Regie: Kirsten Böttcher Technik: Susanne Harasim Sprecher/-innen: Xenia Tiling, Christian Schuler, Katja Schild Interviews mit: Irina Vavitsa: Gastarbeiterin aus Griechenland, arbeitete bei Hella in Lippstadt, Gewerkschaftsmitglied Prof. Dr. Jochen Oltmer, Historiker und Migrationsforscher, Universität Osnabrück, Mitglied des Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien Literatur-Tipps: Simon Goeke, „Wir sind alle Fremdarbeiter. Gewerkschaften, migrantische Kämpfe und soziale Bewegungen in Westdeutschland 1960-1980“, eine umfassende Darstellung der Geschichte der sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik in Verbindung mit der Migrationsgeschichte Jochen Oltmer, „Migration. Geschichte und Zukunft der Gegenwart“, eine Einbettung der Debatten der Gegenwart in die Geschichte der Migration als zentrales Element gesellschaftlicher Veränderung Gün Tank, „Die Optimistinnen: Roman unserer Mütter“, Roman über den erfolgreichen Kampf junger Gastarbeiterinnen gegen Lohndiskriminierung bei Pierburg in Neuss Kölnischer Kunstverein (Hrsg): „Projekt Migration“ (Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung von 2005/2006 im Kölner Kunstverein). Darin zahlreiche interessante Artikel, z.B. von Helmut Dietrich über Ausländerpolitik in der BRD oder von Manuel Gogos über die deutsche Besatzung in Griechenland und die griechische Arbeitsmigration nach Deutschland Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de [radiowissen@br.de]. Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek. [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/urn:ard:show:a5369fa8556fcd7b/] Das vollständige Manuskript gibt es hier. [https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/manuskripte/index.html] Wir freuen uns über eure Kommentare und Diskussionsbeiträge. Bitte beachtet unsere Netiquette [https://www.br.de/service/kommentare-netiquette-richtlinien-110.html]und Tipps für Kommentare.
Das Massaker von Wolhynien - Erinnerung in Polen und der Ukraine
Während des Zweiten Weltkrieges wurden auf dem Gebiet der heutigen Westukraine zwischen 60.000 und 120.000 Polen von der ukrainischen Untergrundorganisation OUN ermordet. Als Vergeltung brachten polnische Kämpfer bis zu 15.000 Ukrainer um. Autorin: Jochen Rack Redaktion: Thomas Morawetz Regie: Anja Scheifinger Technik: Susanne Harasim Sprecher/-innen: Christian Baumann, Katja Schild, Patrick Zeilhofer, Johannes Hitzelberger Interviews mit: Stephan Lehnstaedt, Osteuropahistoriker Andrzej Nowak, Historiker an der Universität Krakau Miroslaw Skorka, Vorsitzender der Union der Ukrainer in Polen Thomas Urban, ehemaliger Osteuropa-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung Weiterführender Link: Polen und Russland - Im Schatten des imperialen Nachbarn Polens Kampf um nationale Souveränität wurde über die Jahrhunderte vor allem gegen das russische Imperium geführt. Traumatische Erfahrungen der Polen mit dem imperialen Nachbarn haben sich durch den russischen Krieg gegen die Ukraine erneut ins Bewusstsein gerufen. Von Jochen Rack (BR 2024) [https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:72d5d969eae6b9b9/] Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de [radiowissen@br.de]. Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek. [https://www.ardaudiothek.de/sendung/radiowissen/urn:ard:show:a5369fa8556fcd7b/] Das vollständige Manuskript gibt es hier. [https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/manuskripte/index.html] Wir freuen uns über eure Kommentare und Diskussionsbeiträge. Bitte beachtet unsere Netiquette [https://www.br.de/service/kommentare-netiquette-richtlinien-110.html]und Tipps für Kommentare.
Kies je abonnement
Tijdelijke aanbieding
Premium
20 uur aan luisterboeken
Podcasts die je alleen op Podimo hoort
Gratis podcasts
Elk moment opzegbaar
1 maand voor € 1
Daarna € 9,99 / maand
Premium Plus
Onbeperkt luisterboeken
Podcasts die je alleen op Podimo hoort
Gratis podcasts
Elk moment opzegbaar
Probeer 30 dagen gratis
Daarna € 11,99 / month
1 maand voor € 1. Daarna € 9,99 / maand. Elk moment opzegbaar.