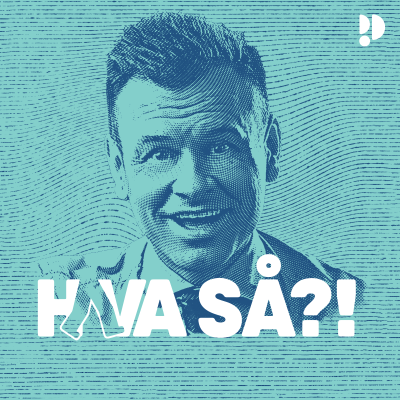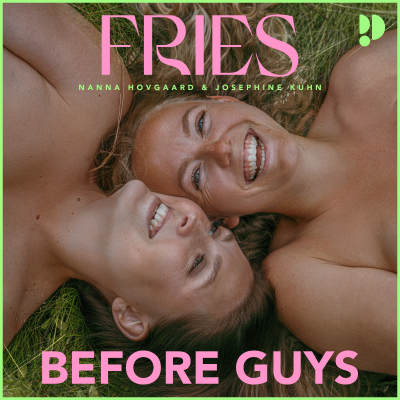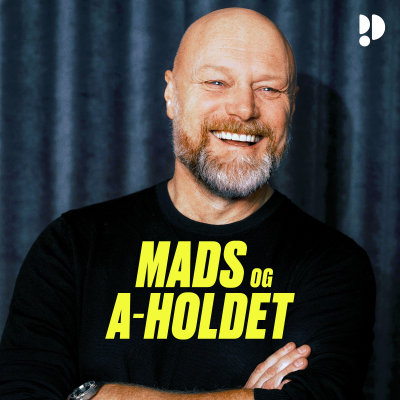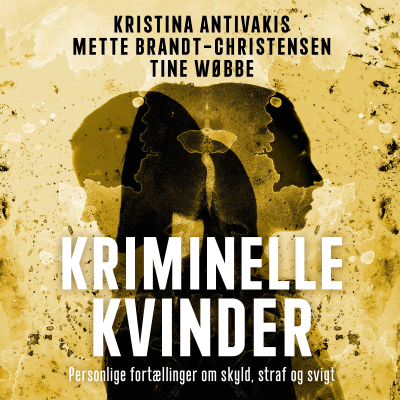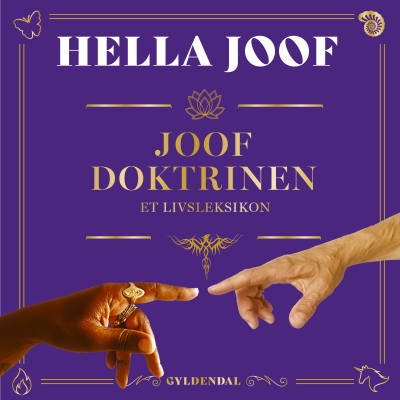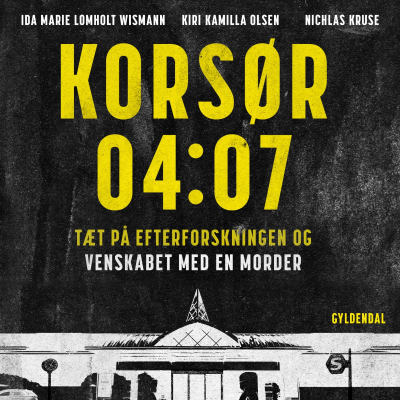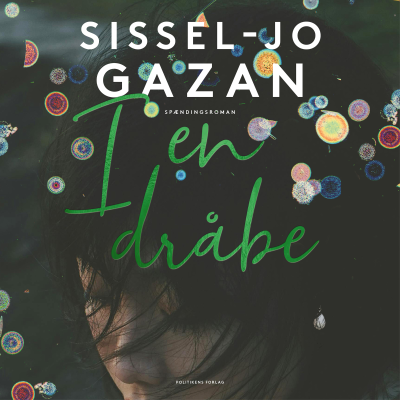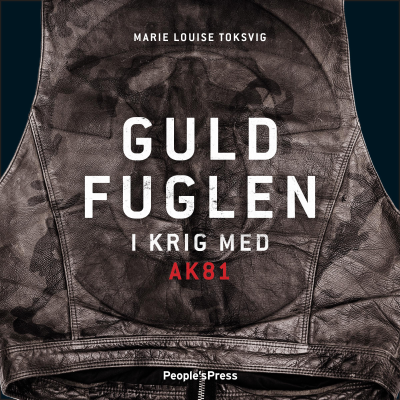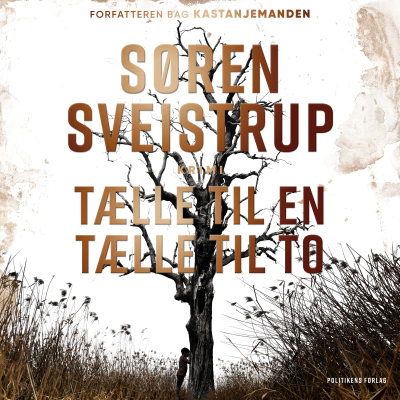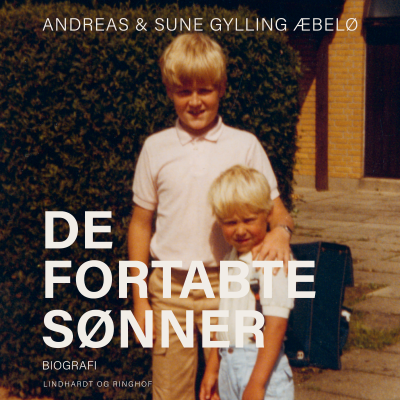Die Geschichtsgreißlerei
Podcast by Andreas Filipovic, Walter Szevera
History goes Grätzl! - Ausgehend von Wiener Orten behandelt die Geschichtsgreißlerei historische Themen und aktuelle gesellschaftspolitische Fragen. Sie erzählt Unbekanntes und Unerhörtes über Wien und spannt den Bogen weit darüber hinaus.
Start 60 days free trial
99,00 kr. / month after trial.Cancel anytime.
All episodes
46 episodesDer Inhalt: Während des Nationalsozialismus entwickelten sich verschiedenste Formen des Widerstandes gegen Diktatur und Terrorherrschaft. Der Historiker Manfred Mugrauer wurde vom Bezirksrat des 15.Bezirks beauftragt, eine Dokumentation zu diesem Thema zu erstellen. Im Zuge seiner Recherche zeigte sich, dass den Hauptanteil des aktiven Widerstandes Angehörige der illegalen Kommunistischen Partei stellten. Aber das politische Spektrum war auch breiter gefächert. So gab es auch SozialdemokratInnen, MonarchistInnen oder auch Einzelpersonen, die aus ethischen und religiösen Gründen sich gegen das Regime stellten. Verfolgt wurden aber nicht nur aktive Oppositionelle, zum Teil musste man schon harte Strafen nur wegen einer unbedachten Bemerkung oder wegen eines Witzes auf sich nehmen. Hochburg des Widerstandes war neben den Bahnhöfen und Werkstätten der Wiener Linien der Westbahnhof, auf dem vor allem kommunistische Eisenbahner versuchten, antifaschistische Aktivitäten zu entwickeln. Aufgrund der kriegswichtigen Funktion des Bahnhofes reagierte der faschistische Apparat mit voller Härte und sprach zahlreiche Todesurteile aus. Manfred Mugrauer sammelte in seiner Publikation über 500 Einzelschicksale und gibt in Kurzbiografien auch oft persönliche und emotional anrührende Einblicke in das Schicksal dieser tapferen Frauen und Männer. Der Gast: Manfred Mugrauer ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Dokumentationsarchives des österreichischen Widerstandes
Der Inhalt: Der Weg zur Wiener U-Bahn war ein langer und komplizierter. Obwohl mit der Errichtung der Stadtbahn im 19.Jahrhundert der Grundstein für ein einheitliches städtisches Schnellverbindungskonzept gelegt wurde, wurde erst 1978 die erste U-Bahnstrecke zwischen Karlsplatz und Reumannplatz eröffnet. Aufgrund der beiden Weltkriege wurden die Anläufe für den Bau eines U-Bahnnetzes immer wieder unterbrochen. Nach dem 2.Weltkrieg versucht die Stadtregierung alternative Verkehrskonzepte zu entwickeln. Dies reichte von der Errichtung einer einspurigen Bahn auf Stelzen bis zum Ausbau von unterirdisch verlaufenden Straßenbahnlinien. Ab Mitte der 1960er stand jedoch die bisherige Verkehrspolitik, die auf Autoverkehr und Straßenbahn, unter Kritik, da die innerstädtische Mobilität vor dem Kollaps stand. 1968 beschließt das Stadtparlament den Bau eines U-Bahnnetzes, welches auch zukünftig weiter ausgebaut wird. Die Errichtung eines umfassenden Netzes einer unterirdischen Schnellverbindung stellt die Planung vor großen technischen und städtebaulichen Herausforderungen. Dabei werden aber nicht nur die Mobilität der BürgerInnen verbessert und erhöht, gleichzeitig bringt der U-Bahnbau eine ganze Reihe von sozialen und kulturellen Auswirkungen mit sich. Der Ort: Das Wiener Linien Kunden Center, Erdbergstraße 202, 1030 Wien Tipps und Tricks: Zum Lesen: Johann Hödl: Das Wiener U-Bahn-Netz. 200 Jahre Planungs- und Verkehrsgeschichte. Wien 2009 Zum Schauen: Werbefilm mit Alfred Böhm: https://mediawien-film.at/film/318/ [https://mediawien-film.at/film/318/] Werbefilm der Wiener Linien: https://youtu.be/g45u_-A6qGg [https://youtu.be/g45u_-A6qGg] Verfolgungsjagd in „Scorpio“ (1973): https://www.youtube.com/watch?v=ji09nCyUf2E [https://www.youtube.com/watch?v=ji09nCyUf2E] Zum Hingehen: Informationszentrum Wiener Linien U2xU5: https://www.wienerlinien.at/u2xu5/infocenter [https://www.wienerlinien.at/u2xu5/infocenter]
Der Inhalt: Dem Tod des Ernst Kirchwegers vorausgegangen war die „Affäre Borodajkewicz“. Der Hochschulprofessor hatte gegen einen Zeitungsartikel des jungen Juristen Heinz Fischer geklagt und Recht bekommen. So in seiner reaktionären Weltanschauung bestärkt, trat Borodajkewycz öffentlich weiter mit seiner ideologie auf und sorgte in der sich verändernden Gesellschaft der 1960er Jahre für öffentliche Empörung und Auseinandersetzungen auf der Straße. Der Tod des Ernst Kirchwegers auf einer der Demonstrationen sorgte für eine Zäsur. Der Ort: Hinter der Staatsoper erinnert heute ein „Stolperstein“ an das späte Opfer der NS-Ideologie, Ernst Kirchweger. Die Gäste: Die „Affäre Borodajkewicz“ wird von dem jungen Juristen Heinz Fischer angestoßen, er beruft sich dabei auf Mitschriften des Studenten Ferdinand Lacina, der die antisemitischen und NS-verherrlichenden Aussagen dokumentiert hat. Beide Zeitzeugen sollten später wichtige Akteure der österreichischen Zeitgeschichte werden. Zum Lesen: Michael Graber, Manfred Mugrauer: Der Tote ist auch selber schuld. Zum 50igsten Jahrestag der Ermordung Ernst Kirchwegers. Wien 2015 Heinz Fischer: Einer im Vordergrund: Taras Borodajkewicz.Wien 2015. Zum Schauen: Lukas Ellmer, Andreas Filipovic, Samira Fux: Akademische Abgründe. Rechtsextremismus im Hörsaal. https://www.oeh.ac.at/ueber-uns/oeh-dokumentation/
Der Wiener Narrenturm wird in Ablehnung unwissenschaftlicher und brutaler Behandlung psychisch kranker Menschen 1784 errichtet. Doch dient er auch im selben Maß zur Wiedereingliederung Kranker in den Arbeitsprozess und zur Herausbildung gesunder und wehrtauglicher Staatsbürger*innen.
Der Inhalt: Obwohl wichtige Entscheidungsträger in der Doppelmonarchie mit der 1861 erfundenen „Fernmündlichen Kommunikation“ in Kontakt kommen, war das Interesse an der Errichtung eines allgemeinen Telefonnetzes sehr gering. Als erstes werden Telefonapparate für in bürgerlichen Haushalten oder beim Militär eingesetzt. Telefone dienen primär zur Befehlsausgabe an Dienstboten oder subordinierenden Chargen, also für Kommunikation in eine Richtung. Erst 1881 werden erste private Lizenzen für die Errichtung eines allgemein zugänglichen Netzes vergeben. Der erste öffentliche Anschluss wird 1882 in der Börse installiert, 1895 wird aufgrund des Chaos des privaten Marktes das Fernsprechnetz unter die Verwaltung des Netzes gestellt. Telefonnetze gelten lange Zeit als technisch unzuverlässig und teuer in der Installation. Die Errichtung eines flächendeckenden Netzes geht sehr schleppend voran, Wien hinkt vielen anderen europäischen Hauptstädten hinten nach. Erst in den 1960er beginnt auch der Siegeszug der Telefonie in Wien. Den Höhepunkt der Anzahl öffentlicher Telefonzellen gibt es in den 1980er mit 6000 Telefonzellen, heute existieren noch ungefähr 1500. Der Ort: Ehemalige Telefonzellen am Volkermarkt, 1020 Wien Technische Innovationen und eine veränderte Kommunikationskultur machen eine große Anzahl der öffentlichen Telefonzellen obsolet. Viele werden aus dem Stadtbild entfernt, einige funktional umgewidmet. Eine dieser Neuausrichtungen ist die Umgestaltung in öffentliche Bücherschränke. Aber auch als Lade- oder Defibrillatorenstationen werden die ehemaligen silber-grünen Häuschen verwendet. Der neue Bücherschrank am Volkertmarkt stellt die gelungen Umwidmung einer ehemaligen vitalen Kommunikationseinrichtung dar. Tipps und Tricks: Zum Lesen: Christine Kainz: Geschichte der österreichischen Post. Wien 1995 Sabine Zelger: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Wien 1998 Zum Hören: Karl Valentin: Buchbinder Wanninger. https://www.youtube.com/watch?v=c5SENIhMMvM Zum Schauen: Steven Knight: No turning back. 2013. https://www.youtube.com/watch?v=PVLWX6BtVP4 [https://www.youtube.com/watch?v=PVLWX6BtVP4]
Start 60 days free trial
99,00 kr. / month after trial.Cancel anytime.
Exclusive podcasts
Ad free
Non-Podimo podcasts
Audiobooks
20 hours / month