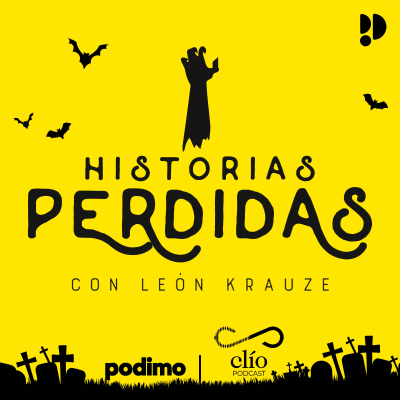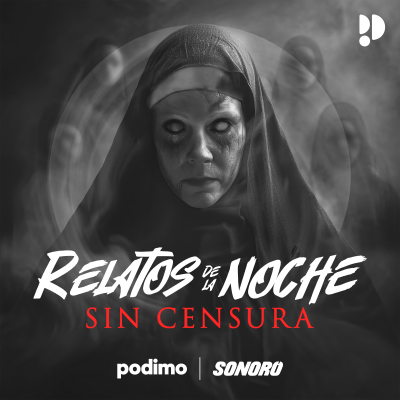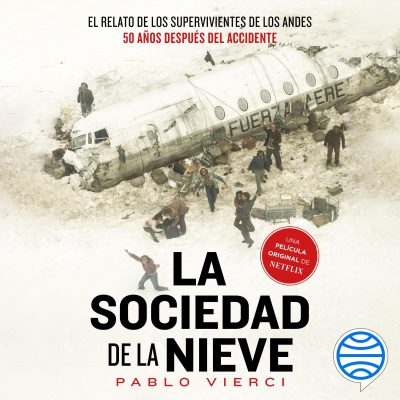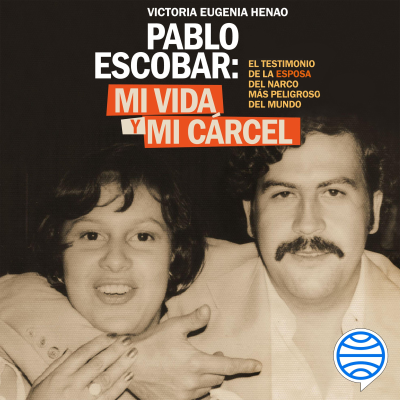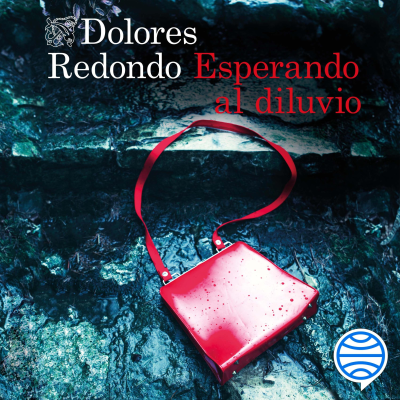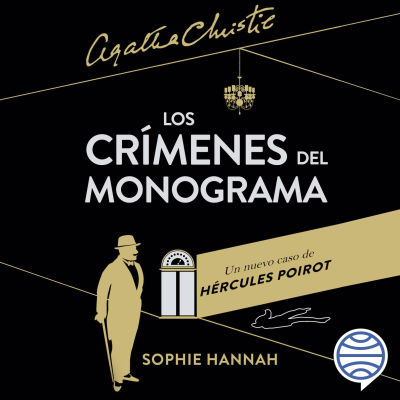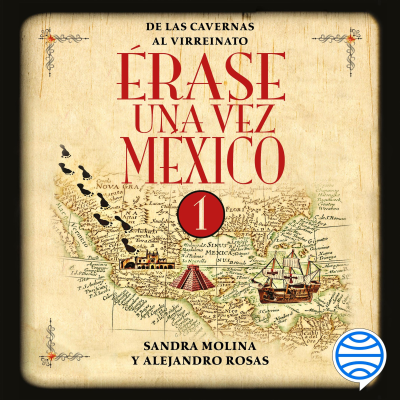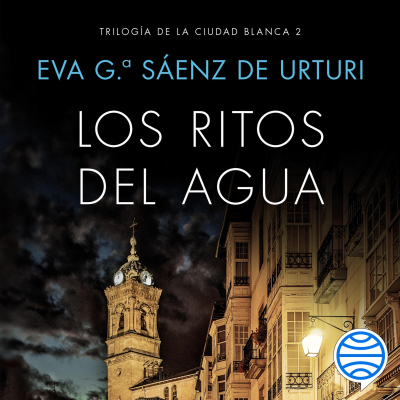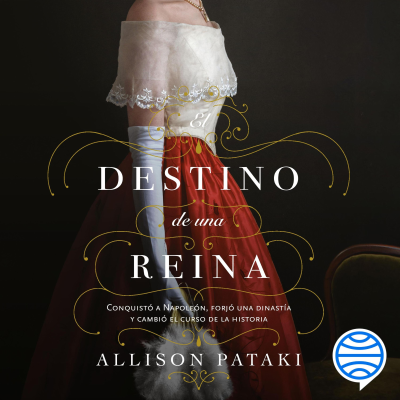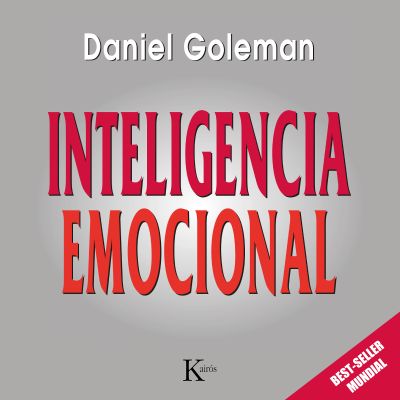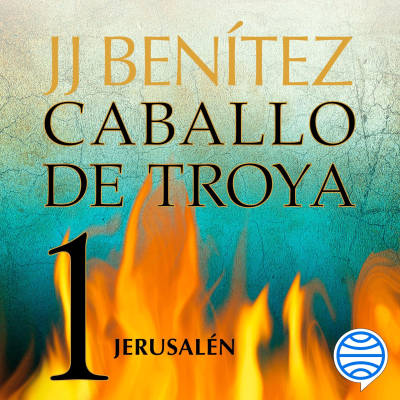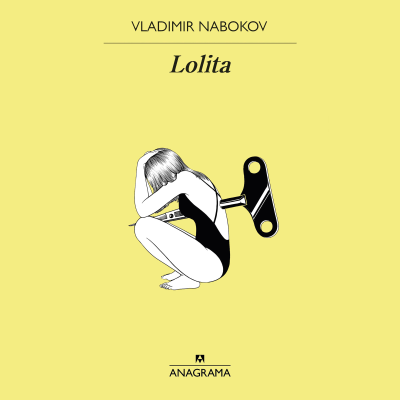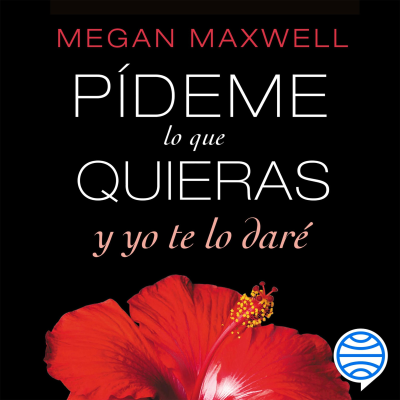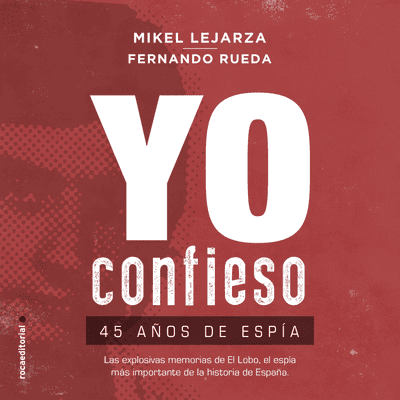NachDenkSeiten – Die kritische Website
Podcast de Redaktion NachDenkSeiten
NachDenkSeiten - Die kritische Website
Empieza 7 días de prueba
$99.00 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
Todos los episodios
4111 episodiosZurzeit zeigt sich ein Riss im scheinbar festen antirussischen Konsens Deutschlands. Ein kontroverser SPD-Parteitag hat jüngst offenbart, dass die Kritik am aktuellen Kurs auch im politischen Mainstream wächst. Trotz harter Rhetorik führender Politiker häufen sich die Stimmen, die eine Überprüfung der Außenpolitik gegenüber Moskau fordern. Artem Sokolow analysiert aus Moskau die komplexen Triebkräfte hinter Berlins Haltung und fragt, ob angesichts dieser Entwicklungen realistische Alternativen für einen Kurswechsel bestehen. Aus dem Russischen übersetzte Éva Péli. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Der Ende Juni abgehaltene Parteitag der deutschen Sozialdemokraten endete in einem Skandal. Parteivorsitzender Lars Klingbeil wurde in seiner Spitzenposition wiedergewählt, jedoch mit einem historisch niedrigen Ergebnis von 64,9 Prozent. Seine Kollegin Bärbel Bas hingegen erhielt 95 Prozent der Stimmen und trat ihr Amt als Co-Vorsitzende der SPD an, gestärkt durch die Unterstützung ihrer Parteikollegen. Die Teilnehmer des Parteitags machten unmissverständlich klar, dass der politische Kurs des rechten Parteiflügels, den Klingbeil repräsentiert, bei Weitem nicht allen gefällt. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Beziehungen zu Russland. Kurz vor dem Parteitag hatte eine Gruppe namhafter SPD-Mitglieder, darunter die Bundestagsabgeordneten Rolf Mützenich und Ralf Stegner, ein Manifest zur Notwendigkeit einer Überarbeitung der deutschen Außenpolitik gegenüber Russland und der Sicherheitspolitik in Europa im Allgemeinen vorbereitet. Die Autoren des Dokuments forderten, diplomatische Kontakte zu Moskau zu intensivieren, Schritte zu vermeiden, die zu einer Eskalation des Ukraine-Konflikts führen, und eine breite Diskussion über Sicherheitsfragen zu organisieren. Das Manifest löste eine Welle der Empörung bei den etablierten politischen Kräften und Medien aus. Ohne sich besonders mit dem Inhalt des Dokuments zu befassen, warfen Kritiker den Autoren die Verbreitung pro-russischer Narrative und fast schon subversive Aktivitäten vor, die dem deutschen Staat schaden würden. Zu den vehementen Gegnern des Aufrufs zu „mehr Diplomatie“ gehörte auch Lars Klingbeil, der die Botschaft seiner Parteikollegen nicht würdigte. Als Co-Vorsitzender der SPD, Vizekanzler und Finanzminister sollte er für Ordnung in seiner Partei sorgen, worauf ihn Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich hingewiesen hatte. Klingbeil machte deutlich, dass die Stimmen der Andersdenkenden die Arbeit der Bundesregierung nicht behindern würden. Seine Parteikollegen dankten es ihm mit demonstrativem Widerstand. Das Ausmaß der Debatte um das Manifest der Sozialdemokraten wurde nicht nur durch seinen Inhalt, sondern auch, so könnte man sagen, durch seinen Ursprung ausgelöst. Zum ersten Mal seit Februar 2022 entstand ein solches Dokument innerhalb des politischen Mainstreams und nicht in Oppositionskreisen. Trotz Stimmenverlusten bei den vorgezogenen Bundestagswahlen im Februar setzte die SPD ihre Arbeit in der Regierung im Status eines Juniorpartners der CDU/CSU-Koalition fort. Die Tradition konstruktiver Beziehungen zu Russland – einst ein wichtiger Teil ihrer ideologischen Positionierung – schien nach der Eskalation der Ukraine-Krise aufgegeben worden zu sein. Das Manifest und seine vergleichsweise breite Unterstützung zeigten, dass dies nicht der Fall ist. Das bedeutet, dass die Kritik an der deutschen Außenpolitik nicht nur an den Oppositionsflügeln, sondern auch im Zentrum der deutschen Politik geteilt wird. Der Schein eines Konsenses: Opposition gegen den antirussischen Kurs in Deutschland Der antirussische außenpolitische Kurs Berlins, der sich mit dem Amtsantritt von Kanzler Friedrich Merz verstärkt hat, scheint sich auf den ersten Blick aus einem breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens in Deutschland abzuleiten. Dieses Bild wird von deutschen Medien, Reden führender Politiker, Expertenkommentaren, einzelnen offiziellen Dokumenten und dem Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung geprägt. Es mag den Anschein haben, dass der Widerstand gegen Russland zu einem existenziellen Ziel Deutschlands geworden ist, dessen Wurzeln bis ins frühe Mittelalter zurückreichen, als germanische Stämme mit slawischen Völkern feindselig waren. Reale Beweise für die Existenz einer „russischen Bedrohung“ werden dabei selbst von den renommiertesten deutschen Think Tanks nicht vorgelegt. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich: Das antirussische Narrativ genießt in der deutschen Gesellschaft keine breite Unterstützung. In diesem Sinne sollten die emotionalen Äußerungen von Kanzler Merz, Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nicht als Indikator antirussischer Stimmungen in Deutschland gewertet werden, sondern als Bestreben dieser Politiker, sich durch aggressive Rhetorik zu profilieren. Die mehrfache Wiederholung antirussischer Passagen ist offensichtlich auf einen psychologischen und nicht auf einen praktischen Effekt ausgelegt. Einer der wichtigsten Indikatoren für die Ablehnung des antirussischen Kurses sind die Ergebnisse der letzten Parlamentswahlen, die aufgrund des Zerfalls der „Ampel“-Regierungskoalition vorgezogen wurden. Rund ein Drittel der Wähler, die an die Urnen gingen, stimmten für Oppositionsparteien am rechten oder linken Flügel: die „Alternative für Deutschland“ (AfD), die „Linke“, das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) und einige Kleinstparteien. Alle diese Parteien kritisieren den außenpolitischen Kurs Deutschlands, nennen ihn schädlich und kurzsichtig. Zuvor war bei mehreren Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern die Kritik an der Berliner Außenpolitik zum Motor des Wahlkampfes der Oppositionsparteien „Alternative für Deutschland“ und „Bündnis Sahra Wagenknecht“ geworden und sicherte dem BSW die Beteiligung an den Koalitionsregierungen von Brandenburg und Thüringen. Und das, obwohl die Bundesländer keine nennenswerten außenpolitischen Befugnisse haben. Antikriegsdemonstrationen, die von Oppositionskräften organisiert werden, können sich noch nicht mit dem Ausmaß der Proteste gegen die Stationierung amerikanischer Raketen auf deutschem Territorium Anfang der 1980er-Jahre vergleichen. Parallelen müssen hier jedoch nicht gezogen werden. Letztendlich konnten selbst die Proteste der Achtzigerjahre die Position der Kanzler Schmidt und Kohl nicht erschüttern. Angesichts neuer Informationstechnologien ist viel wichtiger, dass Veranstaltungen zu einem so brisanten Thema der deutschen Politik überhaupt zahlreiche Menschen anziehen, zumal den Teilnehmenden ernsthafte Schwierigkeiten im Sinne der „Cancel Culture“ drohen. Die Kritik am aufgedrängten antirussischen Konsens innerhalb des politischen Mainstreams der Bundesrepublik Deutschland beschränkt sich nicht nur auf die bereits erwähnten Sozialdemokraten. Auch in den Reihen der CDU werden immer wieder Stimmen laut, die eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Moskau befürworten. So hat sich beispielsweise der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer wiederholt dazu geäußert und unter anderem die Perspektive von Lieferungen russischer Energieträger zur Diskussion gestellt. Mag Friedrich Merz auch ein noch so überzeugter Transatlantiker sein, er kann die Meinung seiner Parteikollegen in Ostdeutschland nicht ignorieren, die der Partei in dieser Region ein akzeptables Ergebnis sichern, da sie die Unzufriedenheit der Wählerschaft mit der antirussischen Politik Berlins berücksichtigen. Das Beispiel der bei den Wahlen auf allen Ebenen scheiternden Freien Demokratischen Partei Deutschlands (FDP), die die Nuancen der Wähleranfragen ignorierte, verpflichtet die ideologisch nahestehenden Christdemokraten zu differenzierten Ansätzen. Merz hat keine Zeit, den Osten Deutschlands „umzuerziehen“, und die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wo CDU und AfD in Umfragen fast gleichauf liegen, finden bereits im nächsten Jahr statt. Kontakte auf zwischengesellschaftlicher Ebene setzen sich inzwischen fort. Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben keine Probleme, Russland zu besuchen, außer denen, die durch Sanktionen verursacht werden (etwa fehlende direkte Flugverbindungen). Mit Ausnahme der von vornherein voreingenommenen Journalisten großer deutscher Medienunternehmen tragen solche Besuche unausweichlich dazu bei, die antirussischen Narrative bei deutschen Bürgern zu überdenken. Warum Berlin am konfrontativen Kurs festhält Warum hält und verstärkt Berlin angesichts so vieler Stimmen, die eine Normalisierung des Dialogs mit Moskau befürworten, weiter seinen konfrontativen Kurs? Erstens beschloss die deutsche Führung 2022, den Ukraine-Konflikt zum Haupttreiber von Veränderungen im Land zu machen. Mit Hilfe der „russischen Bedrohung“ begründeten die Behörden ein umfassendes Bundeswehr-Aufrüstungsprogramm, an dem die deutsche Rüstungsindustrie sehr interessiert war. Darüber hinaus wird die „russische Bedrohung“ als Ursache aller sozioökonomischen Schwierigkeiten in Deutschland, steigender Preise und sinkender Lebensstandards der Bürger genannt. Ohne das Bild des „konstituierenden Anderen“ würde die gesamte deutsche Politik eine sinnvolle Zielsetzung verlieren. Der Abbruch etablierter Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Moskau ist die deutsche Wirtschaft teuer zu stehen gekommen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass alle Kosten nach einer Niederlage Russlands mehr als gedeckt sein werden, wenn eine neue sozio-politische und diplomatische Realität Deutschland begünstigt, wie es nach dem Zerfall der Sowjetunion der Fall war. Deutschland ist viel tiefer in den Ukraine-Konflikt verwickelt als die USA und hat wenig Chancen, ohne Reputations- und Finanzverluste aus ihm herauszukommen. Selbst Befürworter einer Normalisierung der russisch-deutschen Beziehungen müssen den allgemeinen Kontext der modernen deutschen Diplomatie berücksichtigen und eine abwartende Haltung einnehmen, in der Hoffnung auf eine Stärkung der Verhandlungspositionen Berlins. Zweitens hängt die Dynamik der russisch-deutschen Beziehungen stark vom Zustand der euroatlantischen Gemeinschaft ab. In Berlin verfolgt man die teils atemberaubenden Kapriolen der Donald-Trump-Administration mit erheblicher Sorge. Das erste Treffen des amerikanischen Präsidenten mit Kanzler Merz verlief zwar skandalfrei, löste aber die aufgestauten Probleme nicht. Es gelang nicht, den Geist des Tandems Reagan-Kohl wiederzubeleben. Angesichts der Ungewissheit in der US-amerikanischen Außenpolitik zieht es die deutsche Führung vor, nicht „mit der Parteilinie zu schwanken“, sondern unbeirrt an den transatlantischen Grundsätzen festzuhalten – zumal dies bei einem beträchtlichen Teil des amerikanischen Establishments Unterstützung findet. Eine Normalisierung der Beziehungen zu Moskau könnte zwar einen Durchbruch für die deutsche Diplomatie bedeuten, doch birgt sie das Risiko, dass dieser Schritt weder den traditionellen Partnern der führenden politischen Kreise Deutschlands in Washington noch Trump gefallen würde. Letzterer könnte dann befinden, die Deutschen hätten warten sollen, bis er selbst die Beziehungen zu den Russen regelt. Drittens hat die Idee einer Normalisierung des Dialogs mit Moskau in der Bundesrepublik Deutschland noch keine kritische Masse an interessierten Personen in Politik, Wirtschaft und unter den Meinungsführern erreicht. Die konstruktiven Kräfte sind zersplittert, werden von den Medien behindert und marginalisiert oder werden sogar Opfer von Gerichtsverfahren. Die Verluste der deutschen Wirtschaft durch die Einstellung russischer Energielieferungen sind spürbar, aber nicht katastrophal. Große Hoffnungen werden auf die deutsche Rüstungsindustrie gesetzt, die angeblich die deutsche Wirtschaft aus der Krise ziehen kann. Und hier kommt man um antirussische Rhetorik nicht herum. Die Zahl der Befürworter einer Normalisierung der Beziehungen zu Russland ist groß und wird weiter wachsen. Die systemischen Bedingungen der deutschen Politik hingegen zementieren ihren konfrontativen Charakter. Ihre Veränderungen würden einen Übergang Deutschlands in einen qualitativ neuen Zustand bedeuten, analog zur Kanzlerschaft Brandts oder dem Beitritt der DDR. Derzeit setzt Berlin jedoch auf den Konflikt als Motor für Veränderungen im Land. Über den Autor: Artem Sokolow, Senior Researcher am Institut für Internationale Studien des MGIMO, ist ein ausgewiesener Experte für internationale Beziehungen. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die deutsche Außen- und Innenpolitik, die deutsche Geschichte sowie die europäische Integration. Der Beitrag ist im russischen Original auf dem Portal Profil erschienen [https://profile.ru/abroad/vrag-ponevole-est-li-alternativa-antirossijskomu-kursu-frg-1726956/]. Titelbild: Shutterstock / lightspring Mehr zum Thema Außenminister Lawrow im Interview: Moskau fordert dauerhaften Frieden statt Waffenpause [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135749] Auf welcher völkerrechtlichen Grundlage verweigert die Bundespolizei Seeleuten mit russischer Staatsbürgerschaft den Landgang? [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135798] Prinzipien im freien Fall: Wie der Westen die internationale Ordnung untergräbt [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135064] „Russland hat Wehrpflicht auf zwei Jahre erhöht“ – Die Fake News des Bundeswehr-Inspekteurs Alfons Mais bei Maybrit Illner [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135540] [https://vg01.met.vgwort.de/na/75f53188a1a04269a5b3ff40406a4c70]
Der öffentlich-rechtliche Deutschlandfunk erscheint kritischen Hörern entgegen seines Auftrags (Rundfunkstaatsvertrag) wie ein Regierungssender, ein Verbreitungsmedium genehmer Nachrichten, Meinungen und „Einordnungen“: „Da geht es lang, liebe Mitbürger“, tönen DLF-Wortmeldungen oft. Da wütet in Gaza eine gemachte Katastrophe, die zum Monstrum der Unmenschlichkeit für die Ewigkeit auswuchert. Dennoch kommen zahlreiche Berichte und Nachrichten des DLF (und vieler anderer Medien) bislang im kühlen Stil daher, als braucht es Sachlichkeit und regierungsfreundliche Kunst, Böses zu relativieren, um sich so wegzuducken. Nun hörte ich einen Kommentar, der mich aufhorchen ließ, weil der kritisierte, dass „Gaza“ möglich gemacht (!) wurde durch Rhetorik, Wegsehen, Doppelmoral und Schweigen. Ein Zwischenruf von Frank Blenz. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Vorab: Die Sätze der Kommentatorin des Deutschlandfunks sind an sich beeindruckend. Allein sie kommen viel zu spät, schieben nichts an und ändern auch nichts (mehr). Sie lösen bei potenziellen Adressaten (Politiker der Regierung) keinen oder kaum Handlungsdruck aus. Das Schweigen, das Nichtstun bleibt, das Agieren für die Katastrophe setzt sich fort. Tag für Tag. Diese Katastrophe, das Unrecht, das Verbrechen in Gaza setzt sich fort – bis zur kompletten Vollendung, die sich Mensch nicht ausmalen kann und will. Der DLF-Kommentar endet zumindest zaghaft, dass das Schweigen die Idee, dass es so etwas wie universelle Menschenrechte je gegeben hat, zerstört. Richtiger muss es heißen: schon lange zerstört hat. Wir haben uns daran gewöhnt? Nein, die, die immer wegschauen, wenn es unbequem wird Vielleicht kennen Sie das Gefühl, wenn beim Medienkonsum ein (seltener) Lichtblick zutage tritt. Ich erlebte jüngst beim regelmäßigen wie anstrengenden Hören des Deutschlandfunks einen solchen, als ich den hier nachfolgend aufgeschriebenen Text (Kommentar) vernahm. Immer und immer wieder hörte ich beim Notieren die Sätze der Kommentatorin und spürte ein heftiges Hin und Her der Gefühle: Schön, dass es so einen Kommentar gibt – schlimm, dass das so lange braucht, bis sich jemand vom Lager der öffentlich-rechtlichen Einordner, Erklärer, Regierungsversteher usw. aus der Deckung wagt, dachte ich. Die Katastrophe Gaza ist ohnehin im Gang, der Kommentar nahm sich dieser wenigstens an – und doch zu spät. Ich nahm ihr ihre Worte folglich auch nicht wirklich ab, schon gar nicht akzeptierte ich, dass die Kommentatorin im „Wir“-Modus sprach. Ihr Kommentar: Welche Farce und Verhöhnung – eine „humanitäre Stadt“, und doch findet es statt > Israels Militär soll jetzt konkret planen, wie mindestens 600.000 Palästinenser aus Gaza in eine sogenannte „humanitäre Stadt“ zwangsvertrieben werden können. Ein Lager auf den Ruinen Rafahs, in dem Palästinenser eingesperrt und auf ihre Ausreise vorbereitet werden sollen. Das hat Verteidigungsminister Katz Journalisten am Montag vertraulich mitgeteilt. Der Begriff „humanitäre Stadt“ – eine Farce, eine Verhöhnung, der Gipfel einer bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Reinterpretation des Völkerrechts. Er steht exemplarisch für eine Strategie, in der Schutz zur Kontrolle und Hilfe zur Internierung wird. > > Und der Aufschrei? Bleibt aus. Wir haben uns an diese Rhetorik gewöhnt. Wir zucken kaum noch, wenn Israels Verteidigungsminister so eine Ankündigung macht, auch weil die Idee nicht neu ist. Sie wurde monatelang angekündigt, sprachlich getestet, ihre Umsetzung dadurch vorbereitet. Seit bald zwei Jahren hört man von Hardlinern wie dem rechtsextremen Finanzminister Smotrich, die Bevölkerung Gazas solle konzentriert und zur (Zitat) „freiwilligen Ausreise gedrängt werden“. Je öfter man diese Rhetorik hört, desto sagbarer wird das Unsagbare, desto mehr stumpft man ab. Und das Unvorstellbare wird Realität. Und es funktioniert. > > Der Plan soll jetzt umgesetzt werden, weil die internationale Gemeinschaft dem nie mit der nötigen Empörung und Konsequenz entgegengetreten ist. Konsequenz hieße etwa, keine Waffenlieferungen mehr und keine Statements, die mit „Wir sind besorgt“ beginnen und mit der immer gleichen Formel vom Selbstverteidigungsrecht enden. Die Solidarität nach den Schrecken des 7. Oktober war richtig, doch längst ist die Verhältnismäßigkeit überschritten, das Unvorstellbare wird zur Routine, weil wir nicht nur tatenlos zuschauen, sondern weil Politiker wie Friedrich Merz die Sprache dieser Gewalt akzeptieren. Sie sprechen von Solidarität – und meinen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der Palästinenser. Sie sprechen von Israels Sicherheit und schweigen über eine Regierung, die ethnische Vertreibung forciert und weiterplant. > > Der bedeutungsschwangere Begriff „humanitäre Verantwortung“ verkommt zur Floskel. Er bedeutet nichts mehr, wenn wir heute zulassen, dass Menschen in Lager gesperrt werden unter dem Etikett „humanitär“, wenn wir hinnehmen, dass das Völkerrecht nicht mehr zählt, solange es der richtige Bündnispartner ist, der es bricht. > > Was in Gaza passiert ist, war nicht plötzlich da, es wurde möglich gemacht, durch Rhetorik, durch Wegsehen, durch Doppelmoral, durch Schweigen. Und wer jetzt noch schweigt, der darf sich nicht wundern, dass am Ende nicht nur eine Region zerstört ist, sondern auch die Idee, dass es so etwas wie universelle Menschenrechte je gegeben hat. (Hanna Resch, Kommentar Deutschlandfunk) > > (Quelle: DLF [https://www.deutschlandfunk.de/kommentar-zu-humantitaerer-stadt-in-gaza-vertreibung-anders-etikettiert-100.html]) Nicht wundern? Am Ende eine Region zerstört? Wenn wir zulassen? Die Sätze lassen mich mehr und mehr betroffen und wütend zurück. Die an und für sich offene, ungeschönt wirkende Wortmeldung sehe ich eher als einen Beleg der Ohnmacht und Folgsamkeit. Keine Konsequenzen werden gefordert, das Unheil wird kritisiert, aber hingenommen, das Handeln der Verantwortlichen ebenso. Die Sätze mit all diesen „Wenn“ klingen, als sind sie jetzt schnell noch formuliert worden, um sagen zu können: Das ist aber auch schlimm, habe ich ja schon immer so gedacht. Ich finde das bequem und wenig mutig, weil der Kommentar in einem zeitlichen Verlauf, in dem sowieso schon alles kaputt ist, in die Öffentlichkeit gelang. Warum gab es nicht schon ab Oktober 2023 derartige Kommentare, Worte, Mahnungen, Forderungen, Appelle aufzuhören, innezuhalten mit dem Wahnsinn der Rache, der Vergeltung, den Angriffen, die in ihrer Wucht und perspektivischen Ausrichtung genau zum Ziel hatten, was im DLF-Kommentar nun bilanziert wird? Ich lese: „Wenn wir hinnehmen, dass das Völkerrecht nicht mehr zählt, solange es der richtige Bündnispartner ist, der es bricht. Was in Gaza passiert ist, war nicht plötzlich da. Es wurde möglich gemacht, durch Rhetorik, durch Wegsehen, durch Doppelmoral, durch Schweigen.“ Nicht wenn, sondern weil „wir“ hinnehmen, passiert das, denke ich. Das „Wir“ personifiziere ich nicht mit den vielen Menschen in unserem Land und überall um uns herum, die nicht „hinnehmen“. Doch da gibt es ein Problem. Was nützt es der einfachen Bevölkerung hier und sonst wo, für Frieden, Verständigung, Miteinander, Solidarität und Fairness einzustehen, all dieses zu verlangen und auch zu verdienen, wenn ihr mächtiges Führungspersonal und deren Gefolgschaften ihre unheilvolle Politik und deren „Verkauf“ unbeeindruckt umsetzen? Die „Verkäufer“ – etablierte Medien, die mitmachen und sich manchmal humanistisch geben Dem Fußvolk wird tatsächlich offeriert, was fern von Frieden, Verständigung usw. richtig ist. Alle die spielen mit, die etabliert und weich gepolstert arbeiten können und „dazugehören“. Ich höre DLF, ich lese Zeitungen wie die Süddeutsche – stets schwingt das Gefühl des Unwohlseins mit und die Frage: Warum reden, schreiben die so, warum protestieren sie nicht, warum schreien sie nicht auf, warum machen sie keinen Rabatz? Sie machen das halt lieber so: Ein Verbrechen anzukündigen, zu planen und zu realisieren, heißt dann „erwägt“? > Israels Regierung erwägt, im Süden des Gazastreifens ein Lager für 600.000 Menschen zu errichten. Premier Netanjahu sagt, er suche auch nach Ländern, die bereit seien, die Palästinenser aufzunehmen. > > (Quelle: Süddeutsche [https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-gaza-lager-rafah-umsiedlung-li.3281381?reduced=true]) Das Ende ist da, das nächste Ende schließt sich an – welches wohl? Von den so genannten Leitmedien, eher Leid-Medien, erwarte ich im jetzigen Zustand nichts. Ich sehe nur deren Nicht-Agieren und ihr tatenloses Zuschauen, das scheinbare Reagieren der Profis in Wort, Bild und Ton, wenn es denn mal gar nicht anders geht. Doch das erste Ende ist schon längst da – in Nahost zum Beispiel ganz konkret und bitter. Ich habe die Worte von NachDenkSeiten-Chefredakteur Jens Berger vor mir und seinen Artikel: > Nach 21 Monaten israelischer Bombardements, Bodenoffensiven und Besatzung hat der Gazastreifen sein Gesicht verändert. Wo noch 2023 dicht besiedelte Wohngebiete, Sportanlagen, Souks, Schulen und kleinere Gewerbegebiete waren, ist heute eine dystopische Trümmerlandschaft. Wo einst Strand, Freiflächen und kleine Parks waren, stehen heute unzählige Reihen von Zelten und provisorischen Verschlägen, die den Flüchtlingen rudimentären Schutz bieten. Mit Googles Dienst Google Earth können Sie sich dank der Zeitleiste, mit der sie Satellitenbilder unterschiedlicher Jahre für den gewählten Bildausschnitt betrachten können, selbst ein Bild von der Zerstörung machen – eine schreckliche Erfahrung, die einen wütend und hilflos zurücklässt. (Quelle: NachDenkSeiten [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135806]) Zerstörung. Menschen, Gebäude, Heimat. Das war die Heimat von Menschen. Es könnte die eigene Heimat sein. Ich schrieb anfangs, dass der DLF-Kommentar zumindest zaghaft endet, dass Schweigen die Idee, dass es so etwas wie universelle Menschenrechte je gegeben hat, zerstört; und dass es richtiger heißen muss: schon lange zerstört hat. Offensichtlich ist das, was in den nächsten Monaten, Jahren folgen wird, weil die Politik nicht einlenken wird: viele weitere Tote in Gaza und im Nahen Osten, eine komplette Besetzung, die Vertreibung, ja das Verjagen der verbliebenen Palästinenser, eine weitere Fluchtbewegung zum Beispiel Richtung Europa. Tatsachen werden geschaffen. Nachdem in Gaza alles kaputt ist, bekommen die Menschen dort „erstmals“ den Flüchtlingsstatus zuerkannt. Zynismus pur. Herr Macron, ist das ein bisschen von der Idee, dass es so etwas wie universelle Menschenrechte je gegeben hat? > Gaza-Bewohner können in Frankreich aufgrund „israelischer Verfolgung“ Flüchtlingsstatus erhalten, urteilt ein Gericht. Dies ist das erste Mal in Frankreich, dass Staatsangehörigen des Gazastreifens vom Nationalen Asylgerichtshof (CNDA) der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde. > (Quelle: The Jerusalem Post [https://www-jpost-com.translate.goog/diaspora/antisemitism/article-861014?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=rq&_x_tr_hist=true])
Die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht, die Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf, hat sich in einem Interview mit der Tagesschau verteidigt. Siehe hier [https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/brosius-gersdorf-rueckzug-100.html]. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Und hier einige Zitate aus der einschlägigen Berichterstattung: > Die Juristin hatte bereits in einer schriftlichen Stellungnahme [https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/brosius-gersdorf-brief-100.html] gegen sie erhobene Vorwürfe deutlich zurückgewiesen. „Die Bezeichnung meiner Person als ‘ultralinks’ oder ‘linksradikal’ ist diffamierend und realitätsfern“, heißt es darin. > > „Ordnet man meine wissenschaftlichen Positionen in ihrer Breite politisch zu, zeigt sich ein Bild der demokratischen Mitte.“ Zuschreibungen wie „ultralinks“ oder „linksradikal“ beruhten „auf einer punktuellen und unvollständigen Auswahl einzelner Themen und Thesen, zu denen einzelne Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden, um ein Zerrbild zu zeichnen“. Brosius-Gersdorf kritisiert Berichterstattung über sich scharf | tagesschau.de [https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/brosius-gersdorf-brief-100.html] Das klingt nicht gerade ermutigend. Brauchen wir Personen in wichtigen Ämtern wie als Richterin am Bundesverfassungsgericht, die beispielsweise die aktuelle Einkommens- und Vermögensverteilung entsprechend dem Denken der „gemäßigten Mitte“ für grundsätzlich in Ordnung halten? Brauchen wir Personen in diesem Amt, die ein paar gelegentliche Drohnenangriffe gegen Russland sowie den Erwerb der Kriegstüchtigkeit für angebracht, wenn auch den richtigen großen Krieg gegen Russland nicht für sinnvoll halten? – Das brauchen wir nicht. Brauchen wir beim Bundesverfassungsgericht Personen der „gemäßigten Mitte“, die im Blick auf den Kapitalmarkt von marktwirtschaftlichen Verhältnissen sprechen, obwohl einige wenige große Kapitalsammelstellen wie BlackRock schon mit relativ geringen Anteilen das Geschehen beherrschen? Wer so „gemäßigt mittig“ denkt, wird den jetzigen Bundeskanzler Merz, der früher einmal Aufsichtsratschef bei BlackRock Europa war, ohne das notwendige Misstrauen begleiten. Solche Personen brauchen wir als Richter am Bundesverfassungsgericht nicht. Jedenfalls lohnt sich für solche der politische Kampf nicht. Titelbild: Sendungsbild / ARD-aktuell
Die Bundesrepublik versteht sich als soziale Marktwirtschaft, als Rechtsstaat und als Demokratie. Ihre Verfassung verpflichtet sie zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und zur Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Doch diese Versprechen sind eine Verhöhnung der Urteilskraft unserer Bürger – und das nicht zufällig. Hinter der Fassade ordnungspolitischer Rhetorik hat sich ein System etabliert, das Reichtum schützt, Umverteilung nach oben organisiert und demokratische Einflussmöglichkeiten systematisch untergräbt. Von Detlef Koch. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Wir erleben ein System, das den Interessen der finanzstarken Minderheit dient – nicht dem Gemeinwohl. In seiner Ausgestaltung ist es nicht nur ungerecht, sondern zutiefst verfassungswidrig und demokratiezersetzend. Die AfD wird es uns danken! Dieser Artikel rekonstruiert, wie kleine Machtzirkel aus Wirtschaft, Politik und Medien das Steuerrecht zur strategischen Selbstentlastung instrumentalisiert – und wie dabei ein Gesellschaftsvertrag zerfällt, der ohnehin nur für wenige galt. 1. Die juristische Entkernung des Leistungsprinzips Die Grundidee des deutschen Steuerrechts ist einfach: Wer mehr leisten kann, soll mehr zum Gemeinwesen beitragen. Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip bildet die Legitimationsbasis der progressiven Einkommensteuer. Doch gerade an der Spitze der Einkommensverteilung wurde dieses Prinzip systematisch unterlaufen. Die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge (25 Prozent pauschal) erlaubt es schon Multimillionären, mit ihren Dividenden und Spekulationsgewinnen unterhalb der Belastung von Pflegekräften, Lehrern oder Ingenieur:innen zu bleiben. Gleichzeitig werden Kapitalgesellschaften und Holdings mit effektiven Steuersätzen im einstelligen Prozentbereich belastet – ein Umstand, den sich weder Handwerksbetriebe noch mittlere Angestellte vorstellen können. Besonders drastisch ist die Umgehung der Grunderwerbsteuer durch sogenannte Share Deals: Während jede Privatperson beim Immobilienkauf zwischen 3,5 und 6,5 Prozent an den Fiskus zahlt, kaufen Großinvestoren Anteile an Immobiliengesellschaften – steuerfrei. Ja, richtig gehört – steuerfrei[1]. Die Regelung war politisch gewollt und blieb trotz Kritik jahrelang unangetastet. Auch im Erbschaftssteuerrecht offenbart sich die doppelte Moral: Große Unternehmensvermögen können über die sogenannten Verschonungsregelungen nahezu steuerfrei übertragen werden. Die Bedürftigkeitsprüfung, eingeführt nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ist so konzipiert, dass sie selbst von Milliardenerben mit Leichtigkeit bestanden wird. Der Steuerstaat schützt dynastische Vermögensübertragung[2] – er unterbindet sie nicht. Wer bei „dynastische Vermögensübertragung“ an feudale Zeiten erinnert wird … Ja, so ist das auch gedacht! 2. Architektur der Selbstentlastung: Ein steuerpolitisches Kartell Die Frage, wem diese Steuerpolitik nützt, beantwortet sich empirisch und strukturell: Sie nützt den reichsten 1 Prozent der Bevölkerung – insbesondere den oberen 0,1 Prozent. Diese Gruppe verfügt über Kapitalgesellschaften, internationale Wohnsitze, spezialisierte Steuerkanzleien, Vermögensverwalter und politische Zugänge. Sie ist in der Lage, selbst komplexe Steuerregime strategisch zu nutzen oder gar mitzugestalten. Der Fall der Stiftung Familienunternehmen zeigt exemplarisch, wie Gesetze im Dialog mit den Profiteuren entstehen. Als das Bundesverfassungsgericht 2014 entschied, dass die Verschonung von Betriebsvermögen zu weit geht, war die Reaktion kein Umsteuern, sondern eine gezielte Anpassung: Die Stiftung hatte frühzeitig Änderungswünsche formuliert – und unsere loyalitätsgestörten Volksvertreter lieferten. Auch international bekannte Skandale wie Cum-Ex oder Cum-Cum waren keine Randphänomene, sondern Ausdruck einer Haltung: Steuervermeidung ist kein Notbehelf, sondern Bestandteil eines feudalen, ideologisch aufgeladenen Selbstverständnisses, das öffentliches Eigentum als Beute begreift, auf das man aufgrund seines Standes Anspruch hat. Die juristische Umgehung geht Hand in Hand mit der politischen: Lobbyisten aus Banken und Kanzleien schreiben mit an Gesetzestexten. Ex-Minister finden sich wenige Monate nach Amtsende in Aufsichtsräten. Eine Trennung zwischen legislativer Sphäre und wirtschaftlichen Interessen existiert allenfalls nur auf dem Papier. 3. Lobbyismus als Machttechnologie Die gezielte Einflussnahme ökonomischer Machtzirkel auf die Gesetzgebung ist in Deutschland weder Zufall noch Ausnahme – sie ist Teil einer durchrationalisierten Machtstrategie. Lobbyarbeit wird in Stiftungen, Verbänden, Denkfabriken und Beratungsnetzwerken organisiert. Besonders effektiv zeigt sich dieses Netzwerk in der Steuerpolitik. Zwischen 2012 und 2017 flossen allein aus dem Umfeld der Stiftung Familienunternehmen mindestens 2,8 Millionen Euro an CDU, CSU und FDP[3]. Parteispenden, Gutachten, Kanzleramtstreffen – es ist ein informeller Komplex der Nähe, der mit demokratischer Aushandlung wenig zu tun hat. Der politische Erfolg dieser Netzwerke zeigt sich nicht nur im Gesetzeswortlaut, sondern auch im Unterlassen: Share Deals wurden jahrelang nicht verhindert, die Abgeltungsteuer trotz verfassungsrechtlicher Zweifel nicht reformiert, die Gemeinnützigkeit wirtschaftslobbyistischer Stiftungen nicht hinterfragt. Die Vorstellung, dass es sich bei all dem um technische Details handele, ist gelinde gesagt naiv. Steuerpolitik ist Machtpolitik – und ihre Ausgestaltung Ausdruck gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. 4. Klassismus in Reinform: Das Framing der Ungleichheit Entsprechende Machtzirkel begnügen sich nicht mit ökonomischer Dominanz – sie schaffen die semantischen Rahmen, in denen ihre feudalen Privilegien als normal, gerecht oder notwendig erscheinen. Der Begriff „Leistungsträger“ wurde in den 2000er Jahren gezielt propagiert, um hohe Einkommen und Vermögen moralisch aufzuwerten. Wer Reichtum besteuern will, gilt als „neidisch“ oder „wirtschaftsfeindlich“. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), eine von Arbeitgeberverbänden finanzierte PR-Initiative, suggeriert regelmäßig, dass höhere Steuern auf Kapitalflucht und Standortschwäche hinauslaufen. Dass viele dieser Narrative empirisch nicht haltbar sind, stört dabei nicht – entscheidend ist ihre diskursive Funktion: Umverteilung wird zur Gefahr erklärt, Besitzstandswahrung zur Leistung. Die Erzählung vom bedrohten Mittelstand ist ein weiterer Baustein. Reiche Familienunternehmen inszenieren sich als Rückgrat der Gesellschaft, obwohl ihre Eigentumsverhältnisse und Steuerstrukturen mit dem klassischen Mittelstand nichts mehr zu tun haben. Diese rhetorische Gleichsetzung vernebelt die Realität: Dass sich in Deutschland rund ein Drittel des gesamten Nettovermögens in den Händen des obersten Prozents konzentriert, bleibt in der öffentlichen Debatte weitgehend ausgeblendet. 5. Verfassungsbruch mit Ansage – und ohne Konsequenz Es sind nicht nur ethische Fragen, die sich hier stellen, sondern auch rechtliche. Der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG), das Sozialstaatsgebot (Art. 20 GG), das Leistungsfähigkeitsprinzip – sie alle wurden durch die bestehende Steuerarchitektur ausgehöhlt. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach gerügt, dass bestimmte Regelungen zu einseitig zugunsten hoher Vermögen ausgestaltet sind. Doch eine gerechte Reaktion des Gesetzgebers blieb aus – oder die Korrektur des Unrechts wurde gleich von den Steuerbegünstigten selbst beeinflusst. Was blieb, war ein durch Missachtung sozialer Verpflichtungen gekennzeichnetes Demokratieverständnis. Die Verfassungswidrigkeit wird hingenommen, wenn sie den Richtigen dient. Die Rechtsordnung erscheint selektiv. Während Sozialleistungsbeziehende unter Generalverdacht stehen, wird bei Steuervermeidern auf Augenhöhe verhandelt. Es ist ein doppelter Standard, der das Vertrauen in den Rechtsstaat untergräbt und manche Menschen in die Arme des Faschismus treibt. 6. Demokratie ohne Demos? Wenn politische Teilhabe ökonomisch vergiftet ist Die ökonomische „Elite“ hat nicht nur mehr Geld – sie hat auch mehr Zugang, mehr Gehör, mehr Einfluss. Studien zeigen, dass politische Entscheidungen in Deutschland fast ausschließlich den Interessen der Vermögenden folgen als denen der Mehrheit[4]. Wenn das Steuerrecht de facto im Dialog mit den Reichsten entsteht, ist die parlamentarische Repräsentation ausgehöhlt. Wenn der politische Raum durch Parteispenden, Expertengutachten und Medienkooperationen kontrolliert wird, reduziert sich das Spektrum demokratischer Willensbildung auf fast null. Besonders alarmierend ist die mediale Normalisierung dieser Zustände. Hans-Werner Sinn oder andere treten in Talkshows als „neutrale Experten“ auf, während kapitalismuskritische Stimmen marginalisiert oder als populistisch diffamiert werden. So entsteht eine Meinungshegemonie, die Reformforderungen schon im Vorfeld delegitimiert. Die Demokratie wird nicht per Staatsstreich beschädigt, sondern durch informelle Herrschaftsverhältnisse vernichtet – und das ganz ohne Beobachtung durch den Verfassungsschutz. 7. Jenseits der Parteinahme – Warum ein neuer Gesellschaftsvertrag überfällig ist Diese Zustände sind keine Betriebsunfälle – sie sind das Ergebnis einer langfristigen Verschiebung der politischen Ökonomie. Sie zeugen von elitären Machtzirkeln, die sich von der Idee des Gemeinwohls verabschiedet haben, ohne es offen einzugestehen. Die Elite glaubt, sich das leisten zu können – ökonomisch wie ethisch. Doch dieser feudalistische Hochmut ist gefährlich. Denn das Vertrauen in die demokratische Ordnung erodiert nicht nur in sozialen Randgruppen, sondern auch in der Mitte. Wenn Gerechtigkeit zur Simulation verkommt, wenn Gesetze vor allem den Besitzenden dienen, wenn politische Macht käuflich wird, dann steht mehr auf dem Spiel als nur fiskalische Fairness. Dann ist die Idee der Demokratie selbst beschädigt. Es braucht eine radikale Revision der Steuerpolitik – nicht als technokratische Maßnahme, sondern als gesellschaftspolitisches Signal. Progression, Vermögensbesteuerung, die Schließung von Schlupflöchern, solide Personaldecke für die Steuerfahndung: All das sind keine Neidprojekte, sondern Voraussetzungen für eine Gesellschaft, in der Gleichheit mehr ist als ein Wort im Grundgesetz. Ein neuer Gesellschaftsvertrag ist überfällig. Einer, der nicht fragt, wie viel Reichtum möglich ist, sondern wie viel Konzentration von Reichtum eine Demokratie erträgt. Ein Gesellschaftsvertrag, der Eigentum nicht abschafft, aber seine Grenzen klar definiert, und einer, der den Anspruch erhebt, Politik für alle zu machen – nicht nur für jene, die es sich leisten können, mitzureden. Noch hält die Bevölkerung still, aber wie lange wird das Unrecht ertragen? Titelbild: Thorsten Schier/shutterstock.com ---------------------------------------- [«1] Während Privatpersonen beim Immobilienkauf stets der vollen Grunderwerbsteuerpflicht (zwischen 3,5 Prozent und 6,5 Prozent) unterliegen, nutzen Großinvestoren sogenannte Share Deals, bei denen statt des Grundstücks Anteile an grundbesitzenden Gesellschaften übertragen werden. Solange die Beteiligung unter 90 Prozent bleibt (bis Juli 2021: unter 95 Prozent), fällt keine Grunderwerbsteuer an. Diese legalen Gestaltungen führen laut Bundesfinanzministerium jährlich zu Steuerausfällen von bis zu 1 Mrd. Euro. Vgl. Bundesministerium der Finanzen: Interview [https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/10/Inhalte/Kapitel-2b-Schlaglicht/2b-interview-sarah-ryglewski.html] mit Staatssekretärin Sarah Ryglewski zum Gesetz gegen Share Deals, Monatsbericht Oktober 2021, online: bundesfinanzministerium.de [http://www.bundesfinanzministerium.de] (Zugriff: 11.07.2025). [«2] Das deutsche Erbschaftsteuerrecht gewährt für Betriebsvermögen weitreichende Steuervergünstigungen, die in der Praxis häufig zur nahezu steuerfreien Übertragung großer Familienvermögen führen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 (Az. 1 BvL 21/12) verstießen die damals geltenden Verschonungsregelungen gegen den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG), insbesondere weil selbst große Unternehmensvermögen ohne Bedürfnisprüfung vollständig steuerfrei bleiben konnten. Zwar wurde das Gesetz 2016 novelliert, doch zentrale Begünstigungen – etwa die Optionsverschonung – blieben erhalten. Laut Bundesfinanzministerium entfällt der Großteil des übertragenen Betriebsvermögens weiterhin auf verschonungsfähige Fälle. Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014, 1 BvL 21/12; Bundesministerium der Finanzen: Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, BT-Drs. 18/5923, S. 34 f. [«3] Laut Auswertung der Rechenschaftsberichte der CDU, CSU und FDP durch Finanzwende e. V. gingen zwischen 2012 und 2017 mindestens 2,8 Mio. € aus dem Umfeld der Stiftung Familienunternehmen an diese Parteien (CDU: 1,898 Mio. €, CSU: 85.000 €, FDP: 974.000 €). Diese Spenden stammen von Kuratoriums- oder Geschäftsführungsmitgliedern der Stiftung und belegen eine regelmäßige politisch-finanzielle Zuwendung. Vgl. Finanzwende e. V.: Analyse Parteispenden aus dem Umfeld der Stiftung Familienunternehmen, August 2024, online: Lobbypedia-Eintrag „Stiftung Familienunternehmen [https://lobbypedia.de/wiki/Stiftung_Familienunternehmen?utm_source=chatgpt.com] – Hohe Spenden an CDU, CSU und FDP“ [«4] „Dem Deutschen Volke“? Die ungleiche Responsivität des Bundestags – Lea Elsässer · Svenja Hense · Armin Schäfer
Während die verheerenden Folgen der Sanktionen gegen Syrien lange Zeit ignoriert oder geleugnet wurden, bedeutete der Sturz der Assad-Regierung, dass es plötzlich politisch opportun war, zuzugeben, was viele schon die ganze Zeit wussten. Die Funktion von Sanktionen ist es, den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu befördern. Das ist kein Kollateralschaden, es ist der Mechanismus des Drucks. Sanktionen sind eine Waffe der wirtschaftlichen Kriegsführung. Es ist längst an der Zeit, sie als solche zu behandeln. Von Michael Galant und Eleonora Piergallini. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Am 30. Juni unterzeichnete Präsident Donald Trump ein Dekret, das die meisten US-Sanktionen gegen Syrien aufhebt. Mit diesem Schritt, der noch vor wenigen Monaten undenkbar gewesen wäre, löste er ein Versprechen ein, das er im Mai auf einem Investitionsforum in Riad gegeben hatte. Vor einem Publikum aus hauptsächlich saudischen Geschäftsleuten erklärte [https://www.youtube.com/watch?v=aM8mNAuwCX0] er: „Die Sanktionen waren brutal und lähmend.“ Ihre Aufhebung werde „Syrien die Chance geben, groß zu werden“. Die Bedeutung dieser Aussage liegt nicht nur in der Erleichterung, die sie dem syrischen Volk bringen wird. Sie offenbart auch eine implizite, aber selten zugegebene Wahrheit: Sanktionen werden oft als eine zurückhaltende, friedliche Alternative zum Krieg dargestellt, real haben sie dem syrischen Volk aber die ganze Zeit über schwer geschadet. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Zerstörung Syriens kann kaum geleugnet werden. Die Größe der syrischen Wirtschaft hat sich zwischen 2010 und 2021 mehr als halbiert. Etwa 70 Prozent [https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/24/syria-growth-contraction-deepens-and-the-welfare-of-syrian-households-deteriorates] der Syrer leben in Armut und die Hälfte der Bevölkerung in Ernährungsunsicherheit [https://www.wfp.org/news/half-syrias-population-faces-hunger-conflict-passes-12-year-milestone-and-earthquakes-deepen]. Die Befürworter behaupten meist, dass die Sanktionen nicht für zivile Schäden verantwortlich sind. „Die heutigen Maßnahmen zielen darauf ab, das mörderische Assad-Regime zur Rechenschaft zu ziehen. Sie richten sich nicht gegen das syrische Volk“, lautet eine typische Mitteilung [https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-the-press-secretary-regarding-continued-treasury-and-state-sanctions-the-assad?utm_source=chatgpt.com] des Weißen Hauses zur Verhängung neuer Sanktionen im Jahr 2020. Das Europäische Parlament behauptet [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/749765/EPRS_BRI(2023)749765_EN.pdf] in ähnlicher Weise, dass seine Sanktionen gegen Syrien „so angelegt wurden, dass sie nur minimale Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben“. Es ist natürlich schwierig, genau zu bestimmen, wie viel von Syriens wirtschaftlichem Zusammenbruch auf den Bürgerkrieg und Assads Regierung zurückzuführen ist und wie viel auf die Sanktionen des Westens. Es gibt jedoch überwältigende Beweise [https://cepr.net/report/the-human-consequences-of-economic-sanctions/] dafür, dass weitreichende Wirtschaftssanktionen der Zivilbevölkerung immensen Schaden zufügen: Sie verlangsamen das Wirtschaftswachstum, erschweren den Zugang zu Nahrungsmitteln, Treibstoff und Medikamenten und tragen letztlich zu einem Massensterben [https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf] bei. In einigen Fällen sind die Auswirkungen von Sanktionen mit denen von Krieg vergleichbar [https://sanctionsandsecurity.org/wp-content/uploads/2022/01/January-2022-Venezuela-Case_Rodriguez.pdf]. Insbesondere die Sanktionen gegen Syrien haben die humanitären Bemühungen behindert [https://www.hrw.org/news/2023/06/22/questions-and-answers-how-sanctions-affect-humanitarian-response-syria], die Inflation [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7524540/] bei Lebensmitteln angeheizt und zum Kollaps des Gesundheitswesens [https://www.washingtonpost.com/world/2025/01/10/syria-sanctions-health-care-hospitals/] des Landes geführt. Während diese Auswirkungen lange Zeit ignoriert oder geleugnet wurden, bedeutete der Sturz der Assad-Regierung, dass es plötzlich politisch opportun war, zuzugeben, was viele schon die ganze Zeit wussten. Zwei Mitglieder des US-Kongresses, die sich vor dem Sturz Assads für Sanktionen eingesetzt hatten [https://foreignaffairs.house.gov/press-release/mccaul-wilson-gonzalez-hill-boyle-introduce-bipartisan-bill-to-hold-assad-regime-accountable/], haben seitdem argumentiert [https://news.az/news/two-us-lawmakers-call-for-deliberate-and-phased-lifting-of-syria-sanctions], dass eine Lockerung der Sanktionen „die Stabilisierung, den Wiederaufbau, internationale Investitionen [und] die humanitäre Erholung“ erleichtern und den „Zugang zu Wirtschaft und Finanzen für einfache Syrer“ verbessern würde. Nach Trumps Ankündigung erklärte [https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/05/providing-sanctions-relief-for-the-syrian-people/] sein Außenminister Rubio, dass die Aufhebung der Sanktionen „die Bereitstellung von Elektrizität, Energie, Wasser und sanitären Einrichtungen erleichtern und eine effektivere humanitäre Reaktion in ganz Syrien ermöglichen würde“. Bei einer Anhörung im Senat sagte [https://www.youtube.com/watch?v=gO3ZbXIV1AA] er weiter, dass „die Nationen in der Region Hilfe leisten wollen, ihnen helfen wollen und es nicht können, weil sie Angst vor unseren Sanktionen haben“. Rubio führt hier aus, wie die US-Sanktionen als eine Form der wirtschaftlichen Belagerung funktionieren: Sie behindern humanitäre Hilfe und isolieren sanktionierte Länder effektiv von wirtschaftlicher und diplomatischer Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Dorothy Shea, erklärte [https://web.archive.org/web/20250619050006/https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-the-political-and-humanitarian-situations-in-syria-13/] letzten Monat: > „Die Beendigung der US-Sanktionen gegen Syrien wird dem Land eine Chance auf Erfolg geben.“ Es ist schwierig, solche Stellungnahmen mit der Behauptung unter einen Hut zu bringen, Sanktionen würden der Zivilbevölkerung nicht schaden. Wenn die Aufhebung der Sanktionen der Zivilbevölkerung zugutekommt, dann muss ihre Verhängung Schaden verursacht haben. Das schmutzige Geheimnis der Sanktionspolitik ist, dass diese Schäden beabsichtigt sind. Die Funktion von Sanktionen ist es, den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu befördern. Das ist kein Kollateralschaden, es ist der Mechanismus des Drucks. Vereinzelt haben die politischen Entscheidungsträger dies auch zugegeben. In einem Memo des Außenministeriums aus der Anfangszeit [https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v06/d499] des Embargos gegen Kuba wurde vorgeschlagen, „Kuba Geld und Lieferungen zu verweigern, um Geld und die Lieferung von Versorgungsgütern zu verweigern, um Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung herbeizuführen.“ Auf die Frage nach der Wirksamkeit der Sanktionen der Trump-Administration gegen den Iran sagte [https://x.com/CBSEveningNews/status/1095986045324349440?s=20] der damalige Außenminister Mike Pompeo: „Die Dinge sind für das iranische Volk viel schlimmer geworden, und wir sind überzeugt, dass es sich erheben und das Verhalten des Regimes ändern wird.“ Ähnlich zustimmend [https://2017-2021.state.gov/remarks-to-the-press-5/index.html] äußerte er sich über das Leiden der venezolanischen Bevölkerung unter den US-Sanktionen – eine Auffassung, die auch Trump teilte, der später hämisch sagte [https://x.com/Acyn/status/1667682589333659648]: „Als ich aus dem Amt schied, stand Venezuela kurz vor dem Zusammenbruch. Wir hätten es übernommen.“ Während Trumps Regierungsvertreter besonders offen gewesen sind, verweisen Politiker beider Parteien regelmäßig auf makroökonomische Faktoren wie das BIP [https://x.com/SenatorBanks/status/1174393039642603520], die Ölproduktion [https://www.youtube.com/watch?v=SifAjst6dFI&t=174s], die Devisenreserven [https://www.c-span.org/program/senate-committee/secretary-of-state-nominee-marco-rubio-testifies-at-confirmation-hearing-part-1/654138], die Währungsstabilität [https://x.com/POTUS46Archive/status/1507842574865866763] und die Kosten für Lebensmittel [https://x.com/ericswalwell/status/230194222823768064] – Faktoren, die sich direkt auf das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung auswirken – als Maßstab für den „Erfolg“ der Sanktionen. Der Kongressabgeordnete Jim McGovern, ein Kritiker vieler US-Sanktionen, bemerkte [https://x.com/RepMcGovern/status/1404550214766190592/photo/1] einmal: > „Wirtschaftlicher Schmerz ist das Mittel, mit dem die Sanktionen wirken sollen.“ Aber es gibt einen Grund dafür, dass nur wenige zugeben wollen, wie die Sanktionen in Wirklichkeit funktionieren: weil dies ein Eingeständnis wäre, gegen internationales Recht zu verstoßen. Wie Dutzende von juristischen Organisationen und mehr als 200 Anwälte im vergangenen Jahr in einem Brief [https://drive.google.com/file/d/1pXOnN-V7WOZyMS9EKJIs0pQuTBm4qkMs/view] geschrieben haben, stellt die gezielte Bestrafung von Zivilisten durch Sanktionen eine kollektive Bestrafung dar, die gegen das humanitäre Völkerrecht und die UN-Charta verstößt. Die schwersten Sanktionen gegen Syrien werden nach und nach aufgehoben. Das ist eine gute Nachricht. Aber die Begründungen für ihre Aufhebung sind Eingeständnisse dessen, was Kritiker aus der Zivilgesellschaft und Forscher seit Langem vorbringen: Sanktionen töten dieselben Menschen, die ihre Befürworter angeblich schützen wollen. Syrien dient zwar als Fallstudie, aber das gilt überall dort, wo es umfassende Wirtschaftssanktionen gibt, von Kuba über Venezuela bis zum Iran. Wenn Sanktionen vom Leiden der Zivilbevölkerung abhängen, um zu funktionieren, sind sie kein diplomatisches Instrument – sie sind eine Waffe der wirtschaftlichen Kriegsführung. Es ist längst an der Zeit, sie als solche zu behandeln. Übersetzung: Marta Andujo Über die Autoren: Michael Galant und Eleonora Piergallini sind Mitarbeiter des Center for Economic and Policy Research (CEPR) in Washington. Selbstverständnis: „Faktenbasierte, datengestützte Forschung und Analyse, um die demokratische Debatte über wichtige Themen, die das Leben der Menschen beeinflussen, voranzubringen.“ Der Beitrag ist zuerst auf Englisch bei Responsible Statecraft erschienen [https://responsiblestatecraft.org/syria-sanctions/]. Titelbild: Shutterstock / Novikov Aleksey Mehr zum Thema: EU-Kommission: Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien nur bei Schließung der russischen Militärbasen [https://www.nachdenkseiten.de/?p=126640] Wem gehört Syrien? [https://www.nachdenkseiten.de/?p=133023] Wie weiter in Syrien? Viele haben das Vertrauen in die Vereinten Nationen verloren [https://www.nachdenkseiten.de/?p=130295] Sanktionen gegen das internationale Recht [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135981]
Empieza 7 días de prueba
$99.00 / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
Podcasts exclusivos
Sin anuncios
Podcast gratuitos
Audiolibros
20 horas / mes