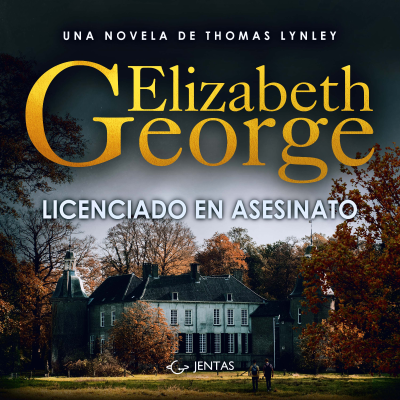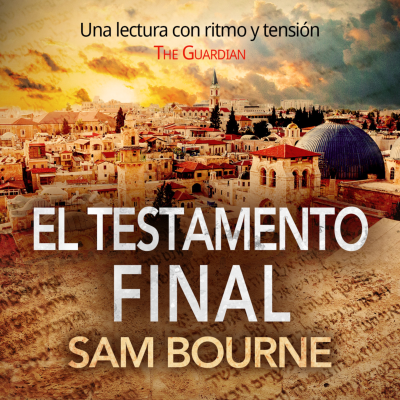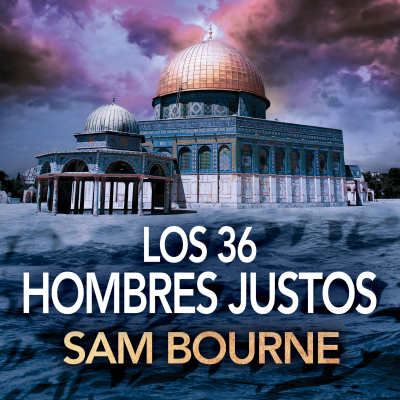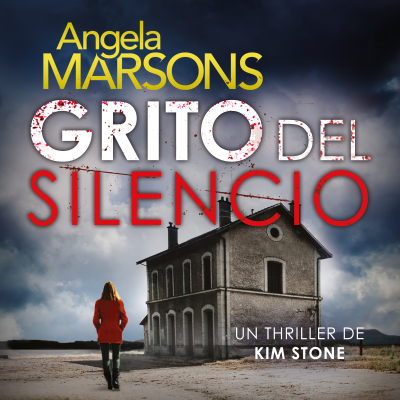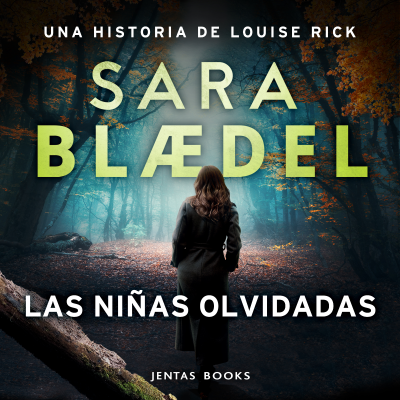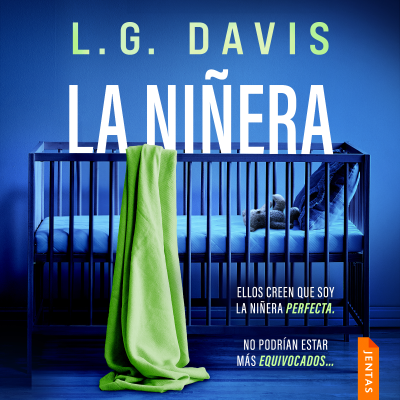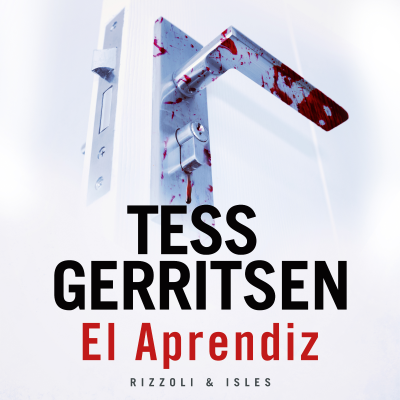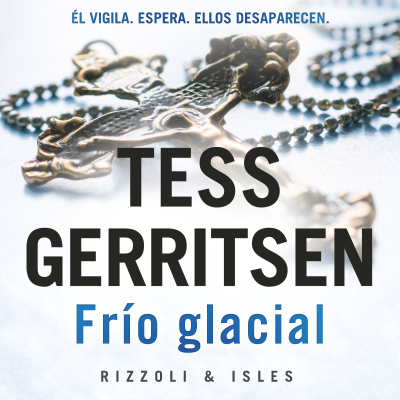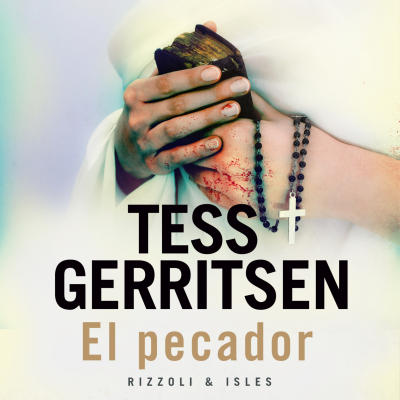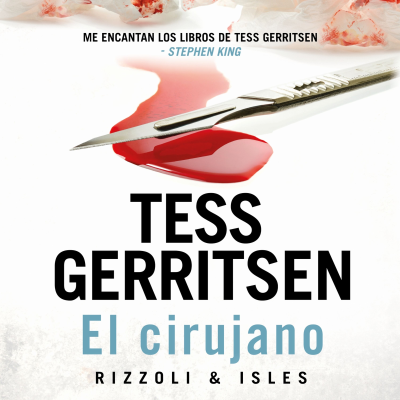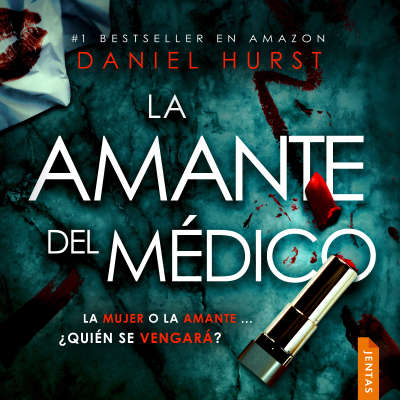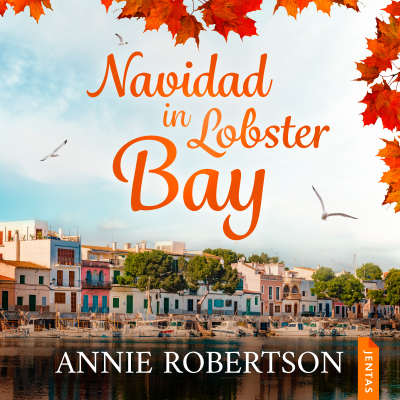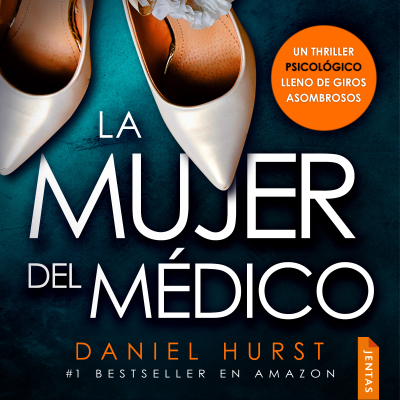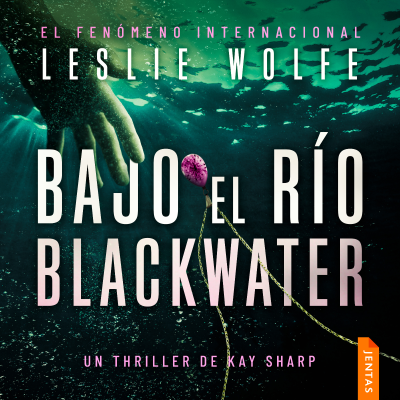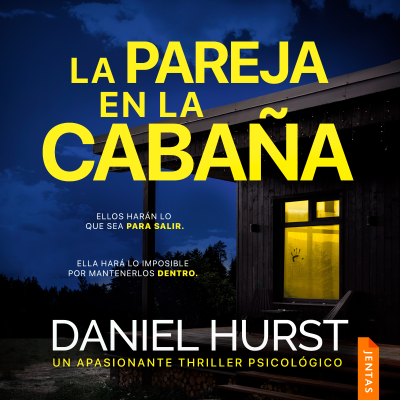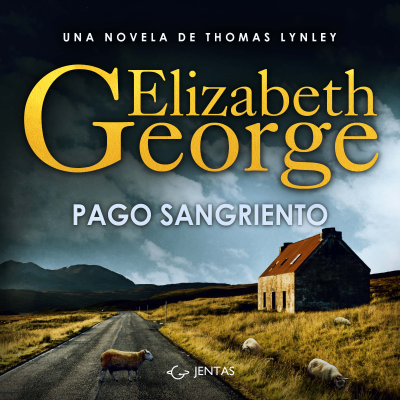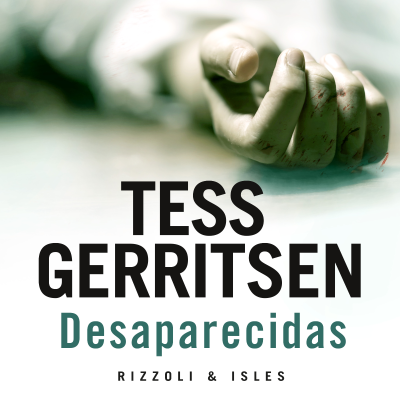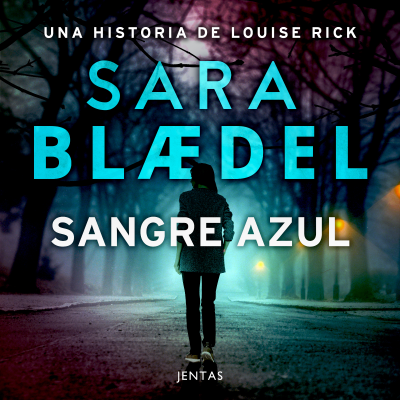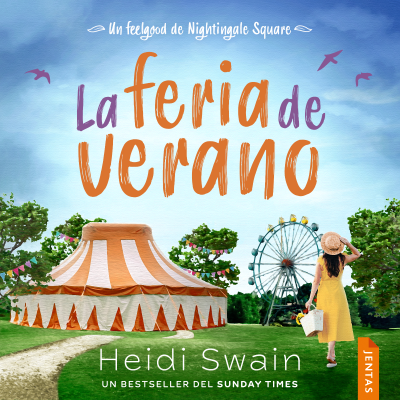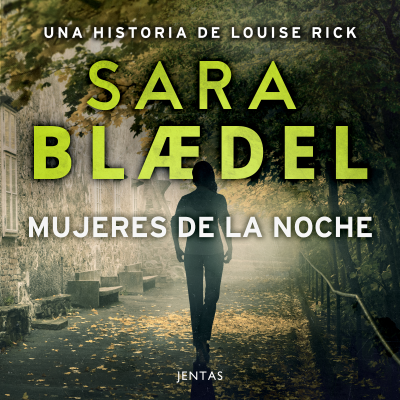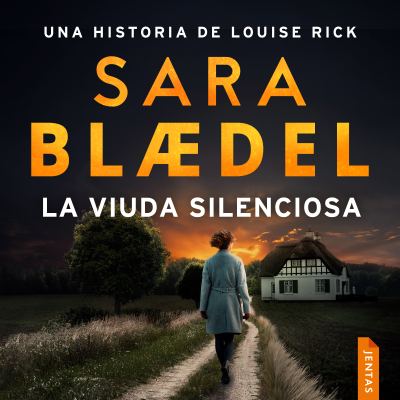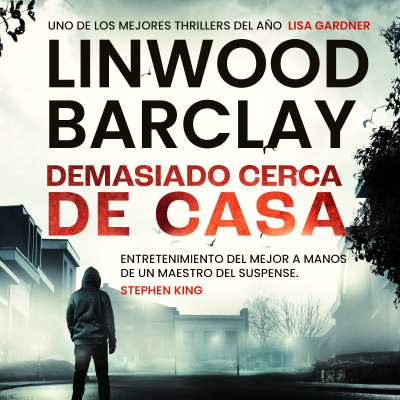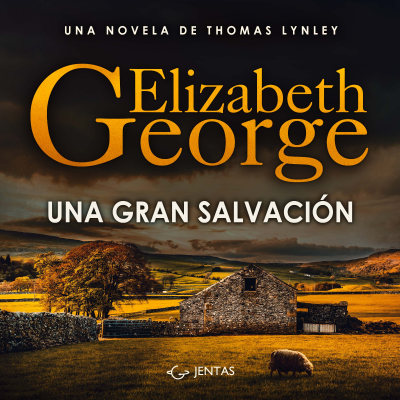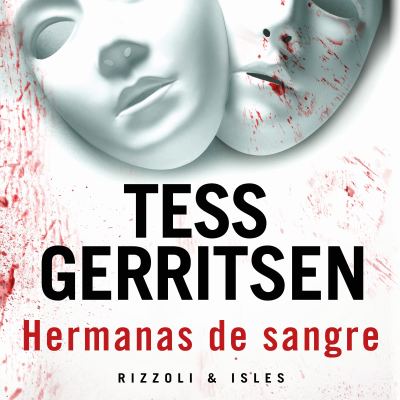NachDenkSeiten – Die kritische Website
Podcast de Redaktion NachDenkSeiten
Disfruta 90 días gratis
4,99 € / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
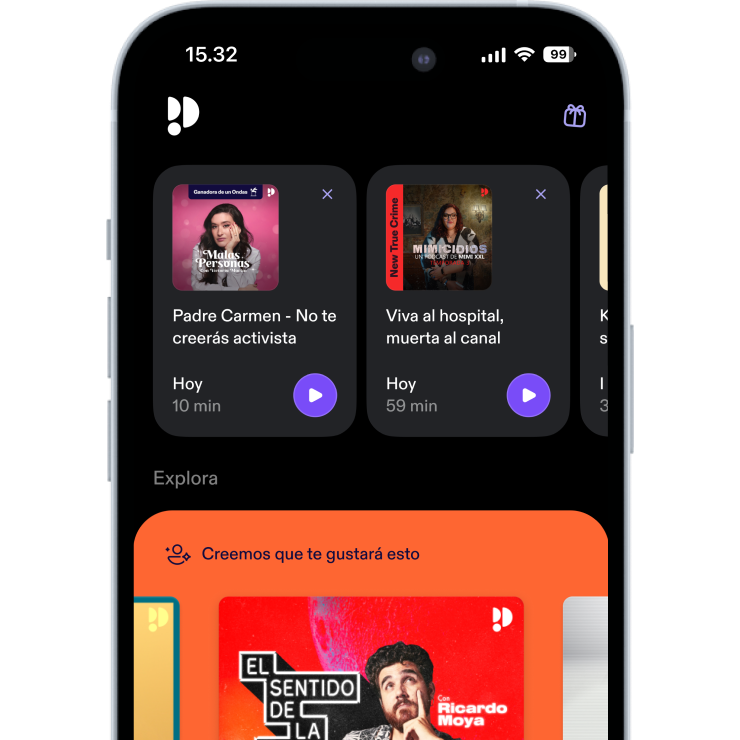
Más de 1 millón de oyentes
Podimo te va a encantar, y no sólo a ti
Valorado con 4,7 en la App Store
Acerca de NachDenkSeiten – Die kritische Website
NachDenkSeiten - Die kritische Website
Todos los episodios
4104 episodiosMit dem Angriff Israels und kurz darauf der USA auf den Iran entdeckten ein paar Schlaumeier, dieser militärische Angriff stelle einen Bruch oder könnte einen Bruch des Völkerrechts darstellen. Für manche schien es wohl der erste Völkerrechtsbruch des Westens überhaupt zu sein. Damit lagen sie zumindest noch vor den Ignoranten, die selbst diesen Angriff auf den Iran noch als völkerrechtlich gedeckt sehen und eine Rechtskonformität des Angriffs herbeiillusionieren wollen. Von Alexander Neu. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Besonders erheiternd empfand ich einen politikwissenschaftlichen Beitrag hierzu in einem der führenden US-amerikanischen Fachmagazine für außen- und sicherheitspolitische Fragen – Foreign Affairs – mit dem zunächst richtigen Titel „Might Unmakes Right – The Catastrophic Collapse of Norms Against the Use of Force“ [https://www.foreignaffairs.com/united-states/might-unmakes-right-hathaway-shapiro] („Macht zerstört Recht – Der katastrophale Zusammenbruch von Normen gegen die Anwendung von Gewalt“) angesichts der Trump‘schen Außenpolitik mit Blick auf territoriale Ansprüche gegenüber Kanada, dem Gazastreifen und Dänemark (Grönland); ganz so, als ob der Bruch grundlegender internationaler Normen wie des Gewaltverbots eine Erfindung des derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump sei. Zwar konzedieren die Autoren im Laufe des Beitrages noch das eine oder andere völkerrechtliche Fehlverhalten der USA, aber den möglichen Dammbruch sehen sie nur jetzt bei Donald Trump. Diese Darstellung über den erst jetzt erkennbaren Völkerrechtsnihilismus ist bei nüchterner Betrachtung nichts weniger als der äußerst durchsichtige Versuch, Sand in die Augen ihrer Leser zu streuen. Den Schwachen vor dem Starken schützen Die Wahrheit aber ist: Seitdem es das Völkerrecht gibt, wird es gebrochen; meist von den Starken gegenüber den Schwachen, obschon der rechtsphilosophische Gedanke hinter einer auf Recht basierten Ordnung (gemeint ist nicht die unsägliche „regelbasierte internationale Ordnung“) den Schwachen vor dem Starken schützen soll. Einer der großen politisch-ideengeschichtlichen Vordenker im Zeitalter der Aufklärung, der dieses formulierte, war der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau. In seinem Werk „Der Gesellschaftsvertrag“ forderte er das Primat des Rechts gegenüber dem anarchischen Naturzustand. Während im Naturzustand das Recht des Stärkeren gelte, müsse das Ziel einer staatlichen Rechtsordnung, die Gleichheit ihrer Bürger vor dem Gesetz und durch das Gesetz, gewährleistet sein. Somit schütze das Recht die Schwachen vor den Starken. Dieser von ihm formulierte Gesellschaftsvertrag lässt sich auch auf die internationale Politik übertragen: Statt Staatenanarchie mit dem Recht des Starken, mithin der Groß- und Supermächte, die den Krieg als legitimes Mittel der Interessendurchsetzung zur Grundlage hat, soll das Völkerrecht, also das Internationale Recht, schwache Staaten vor den starken schützen, also den Krieg als Mittel der Politik vermeiden, ächten, verbieten. UNO als System der kollektiven Sicherheit und das wacklige Gewaltmonopol Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges wurde die UNO geschaffen. Es war ein erneuter Versuch, nach dem Scheitern des Völkerbundes in den 1930er-Jahren, die internationalen Beziehungen, die Anarchie der Staatenwelt zu verrechtlichen und zu institutionalisieren. Das Ziel war es, mit der UNO ein globales System der kollektiven Sicherheit zu schaffen, um den Krieg als „Geißel“ der Menschheit zu überwinden. Im Gegensatz zur staatlichen Verfasstheit existiert ein auf Recht basierendes Gewaltmonopol auf der internationalen Ebene nur rudimentär, da es keinen Weltstaat gibt. Das rudimentäre Element eines Gewaltmonopols, um überhaupt eine Handlungsfähigkeit der UNO herbeizuführen, ist der UNO-Sicherheitsrat als Entscheidungs- und Machtzentrum. Dieses zentrale Machtgremium trägt gemäß Art. 24 Abs. 1 der UNO-Charta die „Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, wurde dem UNO-Sicherheitsrat das ausschließliche Recht zuerkannt, eine „Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung“ festzustellen (Art. 39 UN-Charta) bzw. entsprechende Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Gewalt (Art. 41 – 42 UNO-Charta) gegen den Rechtsbrecher anzuordnen, woraus dem Sicherheitsrat das Gewaltmonopol erwächst. In diesem Sicherheitsrat sitzen die fünf permanenten Mitglieder: Frankreich, Großbritannien, USA, China und die Sowjetunion, später Russland – also die offiziellen Atomwaffenstaaten. Die Schaffung dieses Entscheidungszentrums und besetzt durch die damaligen – teilweise bis heute bestehenden – Großmächte war und ist ein Kompromiss zwischen drei Polen: Der erstens auch in der UNO-Charta fixierten souveränen Gleichheit (Artikel 2, Abs. 1 UNO-Charta) aller Staaten, zweitens der Notwendigkeit eines wie auch immer gearteten Gewaltmonopols der UNO und drittens den realen Machtverhältnissen auf dem Globus nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dass das Gewaltmonopol von den Großmächten beansprucht wurde und wird und nicht durch Wahlen der Gesamtheit der Mitglieder der UNO, ist eben den realpolitischen Machtverhältnissen geschuldet. Und, wie effektiv das ohnehin nur rudimentäre Gewaltmonopol auf politischer Ebene, also im UNO-Sicherheitsrat, funktioniert, hängt ausschließlich von der jeweiligen Interessenkonstellation der fünf permanenten Sicherheitsratsmitglieder ab. Besteht eine umfassende Einigkeit, ist der Sicherheitstrat politisch handlungsfähig. Besteht die Einigkeit nicht, so kann mit Hilfe des Vetos ein Beschluss blockiert werden. Über die Frage, ob das Vetorecht noch zeitgemäß oder überhaupt sinnvoll ist, scheiden sich die Geister. Es wäre ein ganz eigener und sehr umfänglicher Beitrag, der hier indessen nicht abgehandelt werden kann. Die UNO als dem Anspruch nach Garant der kollektiven Sicherheit besitzt entgegen der fixierten Zielsetzung in der Charta (Artikel 43 UNO-Charta) kein eigenes Schwert zur Durchsetzung des Rechts. Dieses Schwert wurde jedoch von Anfang an nicht dem UNO-Sicherheitsrat an die Hand gegeben, da sich die Staaten nicht bereit erklärten, der UNO auch faktisch Truppen unterzuordnen und somit ihre jeweilige Entscheidungs- und Befehlskompetenz über die Truppen an die UNO zu delegieren. Hierdurch kamen die Staaten ihrer Verpflichtung nicht nach, wodurch der Sicherheitsrat zum vorwiegend formalen und somit weitgehend impotenten Inhaber des Gewaltmonopols degradiert wurde, der in Anlehnung an Stalins Machtdefinition, wie viele Panzer denn der Papst habe, nicht die materielle Basis besitzt, das formale Gewaltmonopol auch praktisch durchzusetzen. Wozu sich die Gründungsstaaten der UNO-Charta durchrangen, waren Ersatzlösungen, die bei genauerer Betrachtung der Gründungsphilosophie und dem Ziel der kollektiven Sicherheit eher zuwiderlaufen als diese erfüllen: Die beiden Ersatzlösungen sind die freiwillige und temporäre Zurverfügungstellung militärischer Fähigkeiten und Truppen (Art. 48 und Art. 53. Abs. 1 UN-Charta)) – entweder als UNO-Blauhelmtruppen unter direktem UNO-Kommando (UNO-geführt) oder aber, und das ist der Schwerpunkt, als UNO-mandatierte Truppen, die von Truppenstellerstaaten auch selbst geführt werden und sich militärisch-operationell der Kontrolle der UNO faktisch entziehen. Die Trennschärfe zwischen vom UNO-Sicherheitsrat mandatierter Zwangsmaßnahme (Artikel 43, UNO-Charta) und der kollektiven Selbstverteidigung (Artikel 51 UNO-Charta) zur Unterstützung eines angegriffenen Staates, bei denen die helfenden Staaten mitunter auch eigene Interessen verfolgen, verschwimmt mitunter. Es ist schon auffällig, dass sich bei UNO-mandatierten Einsätzen gerne Großmächte und von Großmächten geführte Staatenkoalitionen so selbstlos anbieten, um ein UNO-Mandat durchzusetzen. Dabei geht es wohl weniger um internationale Solidarität und den Willen zur altruistischen Durchsetzung des UNO-Gewaltmonopols als vielmehr um die militärische Durchsetzung nationaler Interessen, legitimiert durch ein UNO-Mandat. Mit anderen Worten, das Völkerrecht, die UNO und ihre Charta sind der Gefahr der Instrumentalisierung ausgesetzt, indem staatlichen Partikularinteressen ein rechtliches Mäntelchen (UNO-Sicherheitsratsmandat) umgehängt wird. Das wäre das Recht des Stärkeren im rechtlichen Gewande. Respektierung des Rechts Aber auch ungeachtet der ultimativen Machtprojektion, also der Anwendung militärischer Mittel durch die UNO oder im Auftrage derselben, soll der Staatenverkehr unter dem Dach und im Rahmen des UNO-Rechts auch so vonstattengehen. Dies setzt selbstverständlich auch die Zuverlässigkeit gegenüber den Vertragspartnern, d.h. die Vertragstreue hinsichtlich der geschlossenen bilateralen und multilateralen Verträge voraus. Hierzu habe ich diese Rechtspyramide zur Visualisierung der unterschiedlichen Stufen der Zuverlässigkeit im Internationalen Recht entworfen: Rechtspyramide Die Bona-fide-Ebene („Treu und Glauben“ – auch in Artikel 2 Abs. 2 UNO-Charta fixiert) unterstellt ehrenhaftes Verhalten. Jeder Vertragspartner soll sich aufgrund der Ehre an den geschlossenen Vertrag bzw. die Rechtsnormen gebunden fühlen. Der Rechtsgrundsatz der Pacta-sunt-servanda-Ebene unterstellt eine gewisse Rationalität zwischen den Vertragspartnern, aus langfristiger gegenseitiger Berechenbarkeit den Vertrag bzw. die Rechtsnormen zu respektieren. Diese gegenseitige Berechenbarkeit dient dem Wohle aller Vertragspartner. Der Ansatz wirkt auf den ersten Blick altruistisch, beherbergt jedoch einen rational-determinierten egoistischen Kern: Bin ich zuverlässig, so kann ich das von meinem Vertragspartner auch mir gegenüber erwarten. Die materielle Ebene hingegen verweist auf die Kraft der puren Macht, sei es die polizeiliche (innerstaatlich), die militärische oder die wirtschaftliche Potenz (zwischenstaatlich) eines Staates. Diese Macht ist es, die im Zweifelsfall die Respektierung des Rechts erzwingt. Zeithistorisch ist hier auf die Zeit der Bipolarität zu verweisen: Die militärische Macht beider Pole veranlasste beide Blöcke, die internationalen Rechtsnormen, wenn vielleicht nicht aus tiefer Rechtsüberzeugung, so doch aus Furcht vor der Vergeltung des anderen Blocks, weitgehend zu respektieren. Der NATO-Angriffskrieg auf Jugoslawien wäre unter den Bedingungen des Kalten Krieges mit hoher Wahrscheinlichkeit nur um den Preis eines Weltkrieges möglich gewesen. Das Zeitalter der unipolaren Weltordnung verdeutlicht hingegen, dass mit der Abwesenheit der materiellen Gegenmacht die beiden übrigen Ebenen, die Vernunftebene und die Ebene der Ehre, kraftlos bleiben. Der zivilisatorische Gedanke, sich auch ohne Druck rechtskonform zu verhalten, unterliegt der Verlockung, sich in der Gunst der Stunde Vorteile zu verschaffen. Ein Blick in den Melierdialog des Thukydides aus der griechischen Antike offenbart, wie wenig die Menschheit sich doch unter dem zivilisatorischen Gesichtspunkt weiterentwickelt hat: > „(…) da ihr so gut wißt wie wir, daß im menschlichen Verhältnis Recht gilt bei Gleichheit der Kräfte, doch das Mögliche der Überlegene durchsetzt, der Schwache hinnimmt.“ (Thukydides: „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“.). Internationales Recht als Waffe der Großmächte statt der Schwachen Das Recht, welches den Schwachen vor dem Starken schützen soll, kann auch in sein Gegenteil verkehrt werden. Unter den Bedingungen der nun zu Ende gehenden unipolaren Weltordnung gab es zwei Möglichkeiten der Rechtsentwicklung: Die Erste wäre die Wünschenswerte gewesen. Der Westen als Sieger des Kalten Krieges und globaler Hegemon für über 20 Jahre hätte sich an die Spitze der internationalen Rechtsordnung als deren ehrlicher Hüter setzen können. Die übrige Welt hätte sich dem wollend oder gezwungen anpassen können und müssen. Eine internationale Rechtsstaatlichkeit, nicht nur auf dem Papier der UNO-Charta, sondern auch gelebt, hätte etabliert werden können. Die Verbannung des Kriegs wäre auf lange Zeit zur Realität geworden. Die Menschheit hätte sich auf die realen Risiken und Gefahren konzentrieren können, wie Umwelt, Artenerhaltung, Klima, Gesundheit, Bildung und Armutsbekämpfung. Und die andere Möglichkeit, die dann auch tatsächlich umgesetzt wurde: Die Sieger des Kalten Krieges nahmen die Trophäen und wollten der Welt ihre Ordnungsvorstellung aufzwingen, inklusive militärischer Machtprojektion – teils erfolgreich, teils misslungen. Das Internationale Recht wurde nicht gepflegt und vorbildlich gelebt, sondern ganz im Sinne der Denkschule des (Neo-)Realismus für die eigene Machtakkumulation instrumentalisiert. Ein Völkerrechtsbruch jagte den nächsten: * Unterstützung der Sezessionsbestrebungen in Jugoslawien und diplomatische Anerkennung der jugoslawischen Teilrepubliken als neue Staaten. * Völkerrechtswidriger NATO-Angriffskrieg auf die Bundesrepublik Jugoslawien zur gewaltsamen Herauslösung der südserbischen Provinz Kosovo, danach rechtswidrige diplomatische Anerkennung des Kosovo als Staat. * Völkerrechtswidriger Angriff und Regime Change gegen den Irak 2003. * Eigenmächtige Uminterpretation des UNO-Sicherheitsratsmandates zu Libyen 2011 mit anschließendem Regime Change. * Rechtswidrige militärische Einsätze auf dem Staatsgebiet Syriens als Anti-IS-Einsatz deklariert. * Und nicht zuletzt der Angriff Israels auf den Libanon sowie Israels und der USA auf den Iran. * Und nicht zu vergessen die ebenfalls gemachten rechtswidrigen Handlungen Russlands, die den Rechtsbrüchen des Westens folgten, nachdem diese die Präzedenzfälle geschaffen hatten: diplomatische Anerkennung Süd-Ossetiens, Abchasiens, der östlichen und südlichen Territorien der Ukraine mit anschließender Annexion. Die völkerrechtswidrige Integration der Krim in die Russische Föderation sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine selbst. Nun hörte ich im Bundestag wie auch von einigen Völkerrechtlern immer wieder das Argument: „Keine Gleichheit im Unrecht“, soll heißen, wenn Akteur A sich rechtswidrig verhält, ist das keine Berechtigung für Akteur B, es auch zu tun. „Keine Gleichheit im Unrecht“ – Widerspruch Dem halte ich Folgendes entgegen: Im innerstaatlichen Recht ist das tatsächlich so; wie sollte ein Staat auch anders funktionieren. Ansonsten bricht die Staatlichkeit zusammen. Aber, im innerstaatlichen Recht einer repräsentativen Demokratie ist zwischen Rechtssetzenden und Rechtsunterworfenen dahingehend zu unterscheiden, dass zwar alle Rechtsunterworfene, aber nur einige Hundert Bundestagsabgeordnete auch die Rechtssetzenden sind – es ist eine fiktive Identität. Die rechtliche Verbindlichkeit gilt für alle. Rechtsbrüche haben keine dem Internationalem Recht vergleichbare Präzedenzfallwirkung. Im Internationalen Recht sind nicht nur alle Rechtsetzenden auch Rechtsunterworfene, sondern alle Rechtsunterworfene sind auch Rechtsetzende. Es handelt sich also um ein konsensuales Recht – ein Recht, dass nur dann in Kraft tritt, wenn alle zustimmen oder aber auch Mehrheiten souverän akzeptiert werden. Selbst wenn ein Staat nachträglich einem Vertragswerk beitreten will, er also an der konsensualen Ausarbeitung nicht beteiligt war, kann dieser Staat dem fertigen Vertragswerk beitreten oder eben auch nicht – er hat die souveräne Entscheidungsmacht. Anders im innerstaatlichen Recht: Da hat das frisch Geborene oder der Migrant nicht das Recht, sich dem Rechtssystem rechtskonform zu entziehen, nur weil es / er bei Ausarbeitung des Gesellschaftsvertrages nicht mitwirken konnte. Und dieser konsensuale Ansatz im Internationalen Recht widerlegt die Forderung des „Keine Gleichheit im Unrecht“. Denn wenn es so wäre, gäbe es den Begriff des Präzedenzfalles nicht, der auch das Internationale Recht im Sinne des Völkergewohnheitsrechts weiterentwickeln kann, wenn der Rechtsbruch häufig genug praktiziert („Übung über einen längeren Zeitraum“) und von anderen Staaten akzeptiert (Rechtsüberzeugung) wird. Würden immer nur die eine Großmacht oder das Staatenkartell das Recht brechen, und die übrigen Staaten würden weiterhin das Recht respektieren, so entstünde eine Machtasymmetrie respektive die bereits bestehende Machtasymmetrie würde vertieft und zementiert, und das abgesichert durch einseitig ausgelegte rechtliche Argumente. Dass die sich disziplinierenden Staaten an einer solchen nachteiligen Entwicklung kein dauerhaftes Interesse haben können, bedarf wohl keiner vertieften Ausführungen. Wenn der Konsens des konsensualen Rechts, mithin des Internationalen Rechts von einem Staat oder einer Staatengruppe mehrfach aufgebrochen wird, dann erodiert für die übrigen Vertragsstaaten die Verpflichtung zur Vertragstreue. Alles andere wäre eine direkte Negation der staatlichen Souveränität. Die Staaten, die sich jenseits des konsensual vereinbarten Rechts bewegen, zerstören es. Und die Krönung des rechtsnihilistischen Agierens findet dann statt, wenn der/die rechtsbrechende/n Staat/en die übrigen Staaten – auch mit militärischer Gewalt – zur Einhaltung des Rechts zu zwingen versuchte/en, während sie selbst sich aus diesem Recht faktisch verabschiedet haben, sich dann aber ganz selbstbewusst als Verteidiger des Internationalen Rechts zu präsentieren versuchen (Stichwort: „regelbasierte internationale Ordnung“). Das Recht würde aus machtpolitischer Motivation maximal instrumentalisiert und somit in seinem Wesen zerstört. Das sich herausbildende Konstrukt wäre eine dem innerstaatlichen Monarchismus vergleichbare monarchistische Staatenwelt. Der Starke steht über dem Gesetz, und das Gesetz dient faktisch der Sicherung seiner Macht. Ausblick Ob das UNO-Völkerrecht noch zu retten ist, daran kann man berechtigte Zweifel hegen: * Politische Entscheidungen – mit bisweilen universellem Geltungsanspruch – auf der internationalen Bühne finden zunehmend jenseits der UNO in regionalen und interregionalen Foren statt: G-20; G-7, BRICS, NATO, EU, SCO etc. * Die Verweigerung, UNO-Gremien (insbesondere den UNO-Sicherheitsrat) angesichts der veränderten Machtkonstellationen entsprechend zu reformieren. * Der instrumentelle und selektive Verweis auf UNO-Normen zwecks Rechtfertigung jeweils eigener politischer Interessensdurchsetzung (beispielsweise Souveränitätsprinzip versus externes Selbstbestimmungsrecht). * Die Anstrengungen, die UNO-Charta durch eine „regelbasierte internationale Ordnung“ sprachlich als auch in der Anwendung zu ersetzen, sind unübersehbar. Die menschlichen Anstrengungen, aus Fehlern zu lernen und eine stabilere und kriegsresistentere Ordnung aufzubauen, fanden zumeist nach großen, von Menschen gemachten Katastrophen statt: * Der westfälischen Frieden nach dem 30-jährigen Krieg 1648, der das moderne Völkerrecht etablierte und damit einhergehend das bis heute gültige, jedoch zunehmend missachtete Souveränitätsprinzip festigte. * Der Wiener Kongress 1815 in Folge der Napoleonischen Kriege, der das Mächtegleichgewicht (Europäisches Mächtekonzert, also eine multipolare Ordnung) in Europa vereinbarte und für über 50 Jahre, je nach Betrachtung auch für fast 100 Jahre eine relative Stabilität auf dem Kontinent hervorbrachte. Diese Ordnung basierte auf einer relativen Ausgewogenheit der Machtpotenziale ihrer fünf Staaten – Preußen, Österreich, Russland, Frankreich und Großbritannien –, siehe die antike Erklärung Thukydides‘ zum Peloponnesischen Krieg. * Der Briand-Kellogg-Pakt und der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg, die den Angriffskrieg ächteten. * Die UNO nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs. In der Charta wurden der Angriffskrieg verboten und die Friedenspflicht fixiert. Friedensbrechende Staaten, zumindest gemäß der Charta, sollen durch das gemeinsame Handeln der Staaten im Rahmen der UNO auch unter Verwendung militärischer Maßnahmen zur Rückkehr zum Frieden gezwungen werden können. Aber wenn die Erinnerungen an die Schrecken des Krieges verblassen, scheint auch die Disziplin, geltendes Recht fortwährend zu respektieren, zu verblassen. Und wenn dann auch noch die Moral als politischer Kompass einzieht, dann ist kein Platz mehr für Recht, Souveränität und friedliche Koexistenz. Dann bleibt vermeintlich nur noch das Schlachtfeld. Und nach der nächsten Schlacht kommt wieder das „Nie wieder“. Nur, im Nuklearzeitalter auf eine Katastrophe als Katalysator für eine bessere Welt zu setzen, ist eine ganz schlechte Idee. Titelbild: Shutterstock / Oselote Mehr zum Thema: Analyse: Internationale Verträge gegen Atomwaffen und ihre Wirkkraft [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135765] Eine völkerrechtliche Einordnung des bisherigen Krieges zwischen Israel, USA und dem Iran [https://www.nachdenkseiten.de/?p=134964] Analyse: Drohnen als neue Waffensysteme auf den Schlachtfeldern des 21. Jahrhunderts [https://www.nachdenkseiten.de/?p=134641] „Bundeswehr soll konventionell zur stärksten Armee Europas werden“ – Egal, was es kostet [https://www.nachdenkseiten.de/?p=133605] [http://vg08.met.vgwort.de/na/52c81b154d5c45db8c19be6dde69cc34]
In einem exklusiven Interview in Berlin gewährte die ehemalige CIA-Analytikerin und Nahost-Expertin Elizabeth Murray Einblicke in Russlands veränderte Rolle im Nahen Osten. Zusammen mit Ray McGovern war sie für Gespräche und Veranstaltungen nach Deutschland gekommen. Murray beleuchtet Russlands aktuelle Präsenz und seinen Einfluss auf die regionalen Machtverhältnisse, insbesondere vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und der Dynamiken in Syrien. Dabei werden entscheidende Fragen aufgeworfen: Wird Moskaus Darstellung als glaubwürdige Alternative oder als Propaganda wahrgenommen? Welche Sicherheitsrisiken ergeben sich aus dieser Transformation, und wie beurteilt Murray die wachsende Gefahr eines Atomkonflikts im Nahen Osten? Das Interview mit Elizabeth Murray führte Éva Péli. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Éva Péli: Frau Murray, angesichts Ihrer Expertise und langjährigen Arbeit im Nahen Osten: Wie beurteilen Sie die aktuelle Rolle Russlands in der Region? Mit Blick auf Syrien: Welche Auswirkungen hat diese veränderte Rolle auf die regionalen Machtverhältnisse, und wie wird Russlands Einfluss von den Akteuren vor Ort wahrgenommen? Elizabeth Murray: Nun, die jüngsten Ereignisse in Syrien haben die Dynamik stark verändert. Der Putsch, der Assad stürzte und eine Al-Qaida-nahe Figur – jetzt als Ahmed al-Scharaa bekannt, früher Mohamed al-Jolani – an die Macht brachte, hat vieles umgekrempelt. Jetzt sehen wir, wie die Einflüsse der Türkei, Israels und besonders der Vereinigten Staaten stark zunehmen. Die USA sind ja wegen des Öls immer noch im Norden präsent. Ich denke, Russlands Anteil an Latakia, wo die Russen ihre Basis haben, könnte unter Druck geraten, sodass sie vor der Wahl stehen, sich zurückzuziehen oder ihre Präsenz zu verringern. Aber Putin ist ein geschickter Verhandlungsführer. Er hat gute Beziehungen zu Erdogan, sogar sehr gute zu Israel, und er spricht auch mit Trump. Aus meiner Sicht müssen sie ihre Kalkulationen wahrscheinlich neu überdenken, aber ich gehe davon aus, dass eine gewisse russische Präsenz in Syrien und im Nahen Osten generell bestehen bleiben wird. Russland ist derzeit extrem mit der Ukraine beschäftigt. Dort müssen sie den Großteil ihrer Ressourcen einsetzen. Deshalb wird Russland meiner Meinung nach eine geringere Rolle in Friedensprozessen spielen. Sie haben zwar in der Vergangenheit schon die Hamas und andere palästinensische Akteure zu Friedensgesprächen eingeladen, aber ich habe dabei nie etwas Substanzielles herauskommen sehen. Meine Antwort ist also: Russlands Rolle im Nahen Osten ist vorübergehend geschwächt und könnte nach einer Lösung der Ukraine-Frage wieder an Bedeutung gewinnen. Wie beurteilen Sie generell das Ansehen und die Glaubwürdigkeit Russlands und der USA bei den Akteuren und der Bevölkerung im Nahen Osten? Die USA haben derzeit einen sehr schlechten Ruf im Nahen Osten. Angesichts der aktuellen Ereignisse, wo sie im Grunde eine führende Rolle bei der Ermöglichung des Völkermords in Gaza und der Unterstützung Israels spielen, ist das nicht verwunderlich. Es ist ja auch bekannt, dass Nachbarländer wie Ägypten, Jordanien und die Golfstaaten alle in gewisser Weise den Interessen der USA und sogar Israels unterworfen sind. Russland besitzt in der Region tatsächlich mehr Glaubwürdigkeit. Die arabischen Länder suchen wahrscheinlich bei Russland nach einem gewissen Maß an Stabilität. Viele hätten sich vielleicht gewünscht, dass Russland während des Staatsstreichs in Syrien eine stärkere Rolle gespielt hätte, um dort Stabilität zu schaffen. Viele fragen sich auch, welche Rolle Russland im Iran spielen wird, besonders wenn die Feindseligkeiten mit Israel und den Vereinigten Staaten eskalieren. Gleichzeitig hat Putin ja gesagt, dass Russland zwar freundschaftliche Beziehungen zum Iran unterhält. Aber die Russen sind sehr mit ihrer Situation in der Ukraine beschäftigt. Sie könnten möglicherweise etwas Unterstützung leisten, aber ich bezweifle, dass wir eine direkte militärische Beteiligung sehen werden. Angesichts dieser Einschätzung: Wie strategisch agiert Russland mit seiner Medienpräsenz in der Region? Welche spezifischen Taktiken oder Narrative setzen sie ein, und wie erfolgreich sind diese, um sich als Alternative zum Westen zu positionieren? Wird die russische Darstellung eher als glaubwürdige Alternative oder als Propaganda angesehen? Was die Medien angeht: Ich habe die russischen Medien nie wirklich im Detail analysiert, daher muss ich ehrlich sagen, dass ich mir da nicht ganz sicher bin. Aber das Image Russlands, der Ruf Russlands, ist insgesamt positiver. Das war auch schon in Syrien so. Die Präsenz Russlands wurde auch schon früher in Syrien geschätzt und sogar von der früheren syrischen Regierung gefordert. Russland hat nie angegriffen, ist nie einmarschiert oder hat sich eingemischt, und ich denke, dass sie generell ein besseres Verhältnis zu Russland haben als zu den Vereinigten Staaten. Sehen Sie Risiken für die Sicherheit im Nahen Osten, weil sich die Rolle Russlands verändert hat? Es ist immer besser, eine Art multipolare Weltordnung oder ein Gleichgewicht der Kräfte zu haben. Seitdem die Vereinigten Staaten darauf bestehen, eine herausragende Rolle zu spielen, beispielsweise in Friedensprozessen, haben wir in all den Jahren keinen Erfolg gesehen. Doch die Lösung der Palästina-Frage ist der Schlüssel zur Stabilität im gesamten Nahen Osten. Die Vereinigten Staaten müssten einen multipolaren Ansatz verfolgen oder lernen, nur eine Nation unter vielen zu sein, und anderen, wie Russland, eine Rolle bei den Friedensverhandlungen zuzugestehen. Es war für mich immer sehr seltsam, dass nur die Vereinigten Staaten die Führungsrolle übernehmen. Russische Politiker haben das in der Vergangenheit versucht, und sogar die Europäer haben es versucht. Ich hoffe tatsächlich, dass Russland eine aktivere Rolle bei der Stabilisierung der Region übernimmt. Geschieht das nicht, bleiben die Risiken enorm. Solange die USA im UN-Sicherheitsrat quasi immer auf Israels Seite stehen, wird sich die Sicherheitslage meiner Ansicht nach weiter verschlechtern, wenn wir dieses Paradigma nicht ändern. Wären Russland oder Russland und China in der Lage gewesen, die Angriffe Israels und der USA auf den Iran zu verhindern? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin überzeugt, sie hätten das verhindern können, wenn sie ihre Geheimdienste früher eingesetzt hätten, um dem Iran zu helfen, die Situation zu erkennen. Ich weiß nicht einmal, ob solche Geheimdienstbeziehungen zum Iran bestehen, auch wenn wirtschaftliche Beziehungen vorhanden sind. Es wäre durchaus möglich gewesen, wenn sie auch die US-Amerikaner hätten einbinden können. Russland hat ja auch sehr gute Beziehungen zu Israel, aber man weiß nie. Sie hätten eingreifen können, sogar militärisch, vielleicht den Vereinigten Staaten oder Israel drohen oder warnen können, dass sie sich einmischen würden. Das hätte eine Rolle spielen können. Allerdings haben sie sich entschieden, einen Schritt zurückzutreten, und ich glaube, sie spielen auf Zeit. Ich schließe nicht aus, dass es in Zukunft zu einer Intervention kommen könnte, besonders wegen der Nuklearanlagen im Iran. Obwohl diese nicht für Waffen gedacht sind, enthalten sie doch Uran. Das wäre gefährlich und könnte sich auf den Kaukasus ausbreiten. Ich persönlich glaube, dass Russland und China in Zukunft eine stärkere Rolle spielen werden. Wir brauchen ein Gleichgewicht zu den USA in der Region. Sie kämpfen auch für einen atomwaffenfreien Nahen Osten. Viele Beobachter und Experten sehen durch die Angriffe der USA und Israels gegen den Iran die Gefahr eines Atomkrieges wachsen. Wie sehen Sie das? Wie groß ist die Gefahr eines Atomkrieges aufgrund der Ereignisse im Nahen Osten? Bevor wir uns dieser Frage nähern, müssen wir anerkennen, dass Israel über Atomwaffen verfügt. Darin liegt der Schlüssel. Wenn Israel davon überzeugt werden könnte, den Nahen Osten zu einer atomwaffenfreien Zone zu machen – aber Israel lässt keine Inspektoren zu, ist nicht Teil des Nichtverbreitungsvertrags und auch nicht des neuen Vertrags über das Verbot von Atomwaffen. Ich denke, das ist die eigentliche Ursache für die Instabilität. Viele argumentieren jetzt, selbst Friedensbefürworter, dass eine nukleare Abschreckung des Iran tatsächlich den Frieden fördern könnte. Es ist eine traurige Realität, dass Länder mit Atomwaffen nicht angegriffen werden. Selbst als Friedensaktivistin muss ich anerkennen: Solange ein atomar bewaffnetes Israel existiert – und wir Netanjahu als sehr unberechenbar einschätzen –, halten es viele von uns für durchaus möglich, dass er eine Atomwaffe geringer Sprengkraft im Iran einsetzen könnte. Obwohl ich persönlich gegen Atomwaffen bin, kann ich unter den gegebenen Umständen kein Urteil über die iranische Regierung fällen. Ich muss jede Entscheidung respektieren, die sie trifft, denn sie hat das Recht, sich zu verteidigen. Wissen Sie, alle sagen immer, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Nun, auch der Iran hat das Recht, sich zu verteidigen. Bis zu diesem Konflikt hat der Iran 200 Jahre lang kein einziges Land angegriffen. Das ist wirklich traurig. Wir hatten das JCPOA-Abkommen [https://www.consilium.europa.eu/de/policies/jcpoa-iran-restrictive-measures/], einen Vertrag mit dem Iran. Jemand aus den höchsten Kreisen der Elite der USA und des Westens wollte, dass dieser Vertrag verschwindet, und das hat die Lage im Nahen Osten sehr instabil gemacht. Wenn der Iran Atomwaffen erwirbt, bringt das vielleicht kurzfristig etwas mehr Stabilität, aber ich glaube nicht, dass das langfristig wirklich sicher ist. Wenn es schließlich zu einem Konflikt kommt und Länder Atomwaffen besitzen, hängt alles von den Führern ab. Je mehr der Iran angegriffen wird, desto mehr anti-amerikanische, friedensfeindliche Führer werden meiner Meinung nach aufgrund des Drucks ihrer eigenen Bevölkerung an die Macht kommen. Sie müssen für ihre Sicherheit sorgen. Das ist ein Problem, das nicht leicht zu lösen ist. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Zeit! Titelbild: Éva Péli Mehr zum Thema: Ray McGovern: Konzernmedien fahren schwere Geschütze in Ukraine auf [https://www.nachdenkseiten.de/?p=82970] “Putin hat einen großen Bruder in Xi” [https://www.nachdenkseiten.de/?p=79382] Anstehender Verkauf von Nord Stream 2 und die Vogel-Strauß-Taktik der Bundesregierung [https://www.nachdenkseiten.de/?p=129767] Eine völkerrechtliche Einordnung des bisherigen Krieges zwischen Israel, USA und dem Iran [https://www.nachdenkseiten.de/?p=134964] [https://vg01.met.vgwort.de/na/90fea5a66c75424bb86a8d3804032ad9]
„Wir brauchen Waffensysteme, die weit (…) in die Tiefe des russischen Raumes reichen, die angreifen können (…). Die ukrainischen Streitkräfte werden (…) bereits Ende diesen Monat die ersten weitreichenden Waffensysteme geliefert bekommen” [https://x.com/ricwe123/status/1943934234483179562] – das sind die Worte von Generalmajor Christian Freuding, zu hören im „ZDF heute journal“ [https://www.youtube.com/watch?v=G5rXd2jEUKs]. Ist eigentlich allen klar, was diese Aussagen bedeuten? Von Marcus Klöckner. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Da steht ein Generalmajor der Bundeswehr in Kampfuniform in Kiew und gibt dem „heute journal“ ein Interview. Es geht um die aktuelle Lage in der Ukraine und um die Lieferung weitreichender Waffensysteme. Was dann folgt, scheint leider ein Großteil der Zuschauer nicht richtig zu verstehen. Denn würden die Worte des Leiters des designierten Inspekteurs des deutschen Heeres verstanden: Ein lauter Protest sollte zu hören sein. Die Worte offenbaren, wie tief Deutschland bereits in den Ukraine-Krieg verstrickt ist; und sie verdeutlichen: Die politische Führung schiebt Deutschland noch tiefer in einen Krieg, der sich zu einem großen Krieg in Europa entwickeln kann. Auftritt Christian Freuding: „Wir müssen auch Gegenmaßnahmen treffen, wir müssen die ukrainische Luftverteidigung weiter stärken. Deutschland ist da ja schon seit Jahren in einer führenden Rolle. Wir haben da Führungsverantwortung übernommen. Wir sind gerade in engster Abstimmung mit den Partnern, wie wir Feuereinheiten, wie wir neue Luftverteidigungseinheiten mit mittlerer und großer Reichweite ins Land kriegen. Der Verteidigungsminister und der Außenminister haben vor wenigen Wochen eine Initiative gestartet. Wir sind in Gesprächen mit der Industrie sowohl in Deutschland als auch in Partnerländern (…). Wir müssen uns diesem Zyklus, wer schneller mehr produzieren kann, da müssen wir an Geschwindigkeit gewinnen (…).“ Die Interviewerin Dunja Hayali fragt nach, wie der Stand in Sachen Taurus-Lieferungen denn sei. Freuding antwortet: „Ich glaube, zu Taurus ist alles gesagt. (…) „Wir brauchen Waffensysteme, die weit (…) in die Tiefe des russischen Raumes reichen, die angreifen können – Depots, Führungseinrichtungen, Flugplätze, Flugzeuge. (…) Auch Deutschland ist bereit, solche Waffensysteme zur Verfügung zu stellen.“ Hayali fragt nach: „Auch den Taurus? Würden Sie den Taurus liefern, Herr General?“ Freuding sagt: Wie gesagt, zu Taurus ist alles gesagt. Wir liefern solche Waffensysteme. (…) Wir haben heute hier vor Ort einer Unterzeichnung beiwohnen können zwischen der ukrainischen Industrie und dem ukrainischen Verteidigungsministerium – durch Deutschland finanziert. Wir haben diese Initiative angestoßen erst Ende Mai, und wir werden, die ukrainischen Streitkräfte werden aus dieser Initiative bereits Ende diesen Monats die ersten weitreichenden Waffensysteme geliefert bekommen, um dann folgend in einer hohen dreistelligen Stückzahl (…). Die Frage, die sich aufdrängt, lautet: Wird Deutschland nun Kriegspartei? Oder ist Deutschland längst Kriegspartei? Der Politikwissenschaftler Johannes Varwick, der immer wieder die aktuelle Ukrainepolitik des Westens kritisiert, äußerte sich mit folgenden Worten [https://x.com/Volker_Beck/status/1944136549060272618] auf der Plattform X: > „Deutscher General gibt in Bundeswehruniform aus Kiew ein Interview, in dem er Lieferung von weitreichenden dt. Waffen in hoher dreistelliger Zahl ankündigt, die tief im russischen Raum wirken können. #Kriegspartei sind wir aber natürlich nicht. Soso.“ Daraufhin reagiert der Grünen-Politiker Volker Beck: „„Kriegspartei”, also Beteiligter an einem internationalen bewaffneten Konflikt, ist nur ein Staat, der aktiv an Kampfhandlungen teilnimmt. Waffenlieferungen sind keine solche aktive Kampfhandlung. Das wissen Sie. Warum schreiben Sie dann: Soso?“ Varwick antwortet: „Eine rein völkerrechtliche Betrachtung trägt hier nicht. Politisch ist Deutschland faktisch Kriegspartei. Generalmajor Dr. Freuding symbolisiert das hier passend.“ Beck schreibt: „Man kann natürlich auch die Kremlrechtfertigungen für die Kriegsentgrenzung immer weiter verbreiten und jede Verteidigungsaktion zur Provokation umdichten. Sie ebnen Russland den Weg zum Rhein, oder habe ich etwas übersehen?“ Deutlich wird: Die deutsche Politik führt einen Tanz auf dem Vulkan auf. Die Situation ist längst viel gefährlicher, als es den meisten bewusst sein dürfte. Beck spricht argumentationsschwach von „Kremlrechtfertigungen“, so als ob Varwicks Äußerungen auf einer nüchternen, analytischen Ebene keinen Bestand hätten. Was Beck und andere Befürworter der deutschen Ukrainepolitik nicht verstehen: Politische Entscheidungen, die das Wohl Deutschlands und seiner Bürger gefährden, hat die Politik zu unterlassen. Wir reden hier – und das kann man sich nicht deutlich genug vor Augen führen – über die Frage, ob Deutschland Kriegspartei (!) ist. Dass in dieser Situation keine Spur von kritischem Journalismus im Interview zu sehen ist, rundet das Problem ab. Hayali leitet ihre Moderation mit den Worten ein: „Aber immerhin eine gute Nachricht gibt es: Kiew wird weitreichende Waffensysteme in hoher dreistelliger Zahl durch Deutschland bekommen.“ Titelbild: Screenshot ZDF[http://vg05.met.vgwort.de/na/65b19efbf98a4fa9bf3d04ab6ec4bf7b]
In Zeiten des offenen Bruchs von internationalem und humanitärem Recht, Missachtung der UN-Charta und im Livestream sozialer und internationaler Medien übertragenem Völkermord an den Palästinensern wird in Think Tanks und Medien scheinbar nachdenklich über den „katastrophalen Zusammenbruch von Normen durch Gewalt“ [https://www.foreignaffairs.com/united-states/might-unmakes-right-hathaway-shapiro] philosophiert: „Macht könnte das Recht außer Kraft setzen“. Von Karin Leukefeld. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Dieser Artikel liegt auch als gestaltetes PDF [https://www.nachdenkseiten.de/wp-content/uploads/2025/07/250714-Sanktionen-gegen-internationales-Recht-NDS.pdf] vor. Wenn Sie ihn ausdrucken oder weitergeben wollen, nutzen Sie bitte diese Möglichkeit. Weitere Artikel in dieser Form finden Sie hier [https://www.nachdenkseiten.de/?cat=54]. Doch die verantwortlichen Staaten, allen voran die USA und Israel, bewegen sich längst in einem anderen Universum, wo die Hegemonialmacht der westlichen, US-geführten Welt alle Register zieht, um „den Rest der Welt“ im Globalen Süden zurückzudrängen. Die europäischen imperialen Kolonialmächte setzen in Westasien fort, was sie vor und mit dem Ersten Weltkrieg begonnen haben. Sie wollen sich die Kontrolle zwischen dem östlichen Mittelmeer und der Persischen Golfregion aneignen und das Gebiet als „Neuer Mittlerer Osten“ der Kontrolle von Israel unterstellen. Denn Israel – so Ministerpräsident Benjamin Netanjahu – führt den Kampf gegen das Böse auch für Europa, auch für die USA. Wer sich den israelischen Bombenkampagnen nicht beugt, wird vernichtet und vertrieben. Für Waffen, Geld, medialen und politischen Schutz sorgen die Paten Israels in Washington, London, Paris, Berlin und Brüssel. Eine beliebte Waffe in diesem Unterwerfungskampf sind einseitige wirtschaftliche Strafmaßnahmen (Sanktionen), mit denen USA und EU andere Staaten, Unternehmen und Einzelpersonen in die Gefolgschaft der westlichen Interessen beugen wollen. Ein weiteres Mittel der Kriegsführung ist die „Ausschaltung politischer Gegner mit juristischen Mitteln, genannt auch „Lawfare“. Mit medialer Unterstützung werden aggressive Kampagnen gegen die „Zielpersonen“ eingeleitet, die geradezu eine Pogromstimmung erzeugen können. Diese Waffe wurde vielfach in Lateinamerika erprobt, wo juristische Anschuldigungen zweifelhafter Herkunft aber medial verstärkt hochrangige Politiker und Politikerinnen in Argentinien und Brasilien vor Gericht zerrten. Die USA drehen die von ihr in Lateinamerika unterstützte Kriegswaffe des „Lawfare“ nun herum und werfen einer Person vor, gegen sie, die USA, und Israel einen „politischen und ökonomischen Krieg“ zu führen, einen „Lawfare“. Die Rede ist von Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte der Palästinenser. In Deutschland erhielt sie bereits Anfang des Jahres Redeverbot von den Universitäten in München und Berlin, ihr improvisierter Auftritt in einem Veranstaltungsraum in Berlin-Mitte wurde von einem halben Dutzend Polizeibeamten im Publikum überwacht. Vor wenigen Tagen erteilte auch die Universität in Bern der engagierten Anwältin, die von Amnesty International eingeladen worden war, Redeverbot. Eine Ausweichveranstaltung fand in Zürich statt. Nun hat US-Außenminister Marco Rubio Sanktionen gegen Francesca Albanese verhängt, die Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete. Das teilte das US-Außenministerium am 9. Juli 2025 (Ortszeit) in einer Presseerklärung [https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/07/sanctioning-lawfare-that-targets-u-s-and-israeli-persons/] mit. Rubio berief sich auf eine Verordnung 14203, mit der US-Präsident Donald Trump zuvor bereits Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof [https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/12/2025-02612/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court] verhängt hatte. Die US-Administration wirft Albanese vor, sich an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gewandt zu haben, damit dieser Ermittlungen „gegen Staatsangehörige der USA und Israels einleitet, sie verhaftet, inhaftiert oder strafrechtlich verfolgt“. Weder die USA noch Israel sind Vertragsparteien des Römischen Statuts. Das besagt, dass diejenigen, die versuchen, die Verfolgung von Kriegsverbrechen zu verhindern, dafür angeklagt werden können. Rubio wirft Albanese vor, sich nicht an die beiden Staaten gewandt und damit die Souveränität beider Länder „grob verletzt“ zu haben. Albanese sei „voreingenommen“ und „böswillig“ und sei „für das Amt einer Sonderberichterstatterin ungeeignet“, heißt es weiter in der Erklärung. Sie verbreite „unverhohlenen Antisemitismus“, unterstütze Terrorismus und zeige „offene Verachtung für die Vereinigten Staaten, Israel und den Westen“. Das zeige sich u.a. darin, dass sie dem Internationalen Strafgerichtshof empfohlen habe, „Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant zu erlassen“. Sie habe zudem kürzlich „Drohbriefe an Dutzende Einrichtungen weltweit, darunter große amerikanische Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Technologie, Verteidigung, Energie und Gastgewerbe“, verschickt, in denen sie „extreme und unbegründete Anschuldigungen“ erhoben habe „und dem IStGH empfiehlt, Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen gegen diese Unternehmen und ihre Führungskräfte einzuleiten“. Albanese betreibe Kampagnen der „politischen und wirtschaftlichen Kriegsführung“, die die nationalen Interessen und Souveränität bedrohten und nicht toleriert würden, so der US-Außenminister. Man werde „alle Maßnahmen ergreifen“, die man für notwendig erachte, um auf den „Lawfare“ zu reagieren, man werde die eigene Souveränität und „die unserer Verbündeten“ schützen. Einen Nerv getroffen Francesca Albanese reagierte in einer ersten kurzen Stellungnahme gegenüber dem katarischen Nachrichtensender Al Jazeera mit einer Textnachricht: „Kein Kommentar zu Einschüchterungstechniken im Stil der Mafia. Ich bin damit beschäftigt, die (UN-) Mitgliedsstaaten an ihre Verpflichtung zu erinnern, Völkermord zu stoppen und zu bestrafen. Und diejenigen, die davon profitieren.“ Tags darauf sagte sie in einem Interview mit dem Internetportal Middle East Eye, sie habe offenbar „einen Nerv getroffen“ [https://www.middleeasteye.net/news/francesca-albanese-defiant-face-trump-sanctions]. Auf die Frage des Moderators, wie es ihr gehe, erklärte sie, sie sorge sich um die Menschen, „die in Gaza sterben, während wir hier sprechen. Und die Vereinten Nationen sind völlig unfähig, zu intervenieren.“ Sie habe dem Internationalen Strafgerichtshof in ihrer Eigenschaft als UN-Expertin die Einleitung von strafrechtlichen Maßnahmen empfohlen. Die US-Administration zerstöre ein internationales Rechtssystem, „das uns alle schützt“, so Albanese. Washington untergrabe „das Fundament der multilateralen Ordnung“. Sie sparte nicht mit Kritik an der Tatenlosigkeit der Vereinten Nationen und sagte, es gebe 193 Mitgliedsstaaten in den Vereinten Nationen und „wir heißen Vereinte Nationen und nicht Vereinigte Staaten“. Stephane Dujarric, Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, bezeichnete es als „gefährlichen Präzedenzfall“, Sanktionen gegen eine/n Sonderberichterstatter/in (des UN-Menschenrechtsrates) zu verhängen. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, forderte die US-Administration auf, die Sanktionen gegen Albanese „sofort“ aufzuheben. Sie richteten sich „gegen die Arbeit, die sie im Zuge ihres Mandats vornimmt, und zwar die Lage der Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten“, so Türk. Die USA hatten bereits Anfang Juli gefordert, dass Albanese von ihrem Posten entfernt werden solle. Der Auslandskorrespondent und langjährige Leiter des Büros der New York Times im Mittleren Osten, Chris Hedges, schrieb unmittelbar nach Bekanntwerden der US-Sanktionen gegen Albanese [https://chrishedges.substack.com/cp/167974955], „wenn die Geschichte des Völkermords in Gaza geschrieben wird, wird Francesca Albanese als eine der mutigsten und offensten Verfechterinnen der Gerechtigkeit und der Einhaltung des Völkerrechts in Erinnerung bleiben“. Sie erhalte Morddrohungen und werde mit Lügenkampagnen überzogen, bei denen Israel und seine Verbündeten den Taktstock schwängen. Sie prangere die „moralische und politische Charakterlosigkeit der Weltgemeinschaft“ an, die zulasse, dass der Völkermord an den Palästinensern und ihre Vertreibung anhalte. Sie werde ihrer Aufgabe als Sonderberichterstatterin gerecht, indem sie Berichte über Kriegsverbrechen in Gaza und im Westjordanland dokumentiere, darunter den Bericht „Völkermord als koloniale Auslöschung“ [https://www.un.org/unispal/document/genocide-as-colonial-erasure-report-francesca-albanese-01oct24/]. Klartext gegen Täuschung Die engagierte italienische Anwältin spricht Klartext. Seit Monaten weist sie darauf hin, dass Staaten, Regierungen und Unternehmen, die trotz des Krieges gegen die schutzlosen Palästinenser im Gazastreifen ihre Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Israel nicht einstellten, eines Tages mit einer Anklage wegen Unterstützung von Völkermord konfrontiert sein könnten. Europäische Staatschefs, einschließlich die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, wies sie auf die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen der politischen Unterstützung Israels angesichts des Vernichtungskrieges gegen Gaza hin. Am 30. Juni hatte Albanese ihren jüngsten Bericht veröffentlicht, in dem mehr als 60 internationale Unternehmen, darunter Technologiekonzerne wie Google, Amazon, Microsoft, aber auch Finanzunternehmen, genannt werden, die mit ihrer Kooperation mit Israel nicht nur von der „völkerrechtswidrigen Besatzung“ palästinensischer Gebiete profitiert hätten, sondern jetzt auch vom Völkermord in Gaza. „Die Transformation der israelischen Besatzungsökonomie in eine Ökonomie des Völkermords“ [https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5923-economy-occupation-economy-genocide-report-special-rapporteur], so ist der Bericht überschrieben. In dem Bericht fordert Albanese den Internationalen Strafgerichtshof und die Justiz in den UN-Mitgliedsstaaten auf, gegen die in dem Bericht genannten Unternehmen und deren Vorstände Untersuchungen wegen des Verdachts auf Unterstützung des Völkermords an den Palästinensern einzuleiten. Die Vereinten Nationen rief sie auf, Sanktionen gegen Israel zu verhängen und dessen Vermögen einzufrieren. Vorgesehen ist das u.a. in der UN-Charta, Kapitel 7. Bundesregierung, Bundestagsparteien und die großen sogenannten „Qualitäts“-Medien in Deutschland unternehmen trotz der ausführlichen Dokumentation von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die israelische Regierung und Armee nichts. Auf EU-Ebene setzten sich kürzlich deutsche Regierungsvertreter, selbst der Kanzler und eine EU-Antisemitismusbeauftragte sogar ausdrücklich für die weitere Unterstützung und den Schutz Israels [https://euobserver.com/eu-and-the-world/ar349d1cbc] ein. Angesichts zunehmender Kritik von anderen EU-Staaten versucht die Bundesregierung, den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie Handeln vortäuscht und sich „offen zeigt“ gegenüber einer angeblich „steigenden Chance für Waffenruhe“ und für einen Arbeitsauftrag an die Außenminister der EU-Staaten, die am kommenden Dienstag (15.7.2025) über einen Prüfbericht und mögliche Konsequenzen daraus (gegenüber Israel) beraten sollen. Der langjährige Haaretz-Korrespondent aus den besetzten palästinensischen Gebieten, Gideon Levy, spricht angesichts der Pläne der israelischen Regierung, eine sogenannte „humanitäre Stadt“ auf den Trümmern der südpalästinensischen Stadt Rafah zu errichten, von wo Palästinenser deportiert werden sollen, von einem „Konzentrationslager“ [https://youtu.be/5sDnSuj5_uA]. „Es gäbe keine andere Möglichkeit, (diese Pläne) zu beschreiben, als dass dort ein Konzentrationslager errichtet werden soll“, sagt Levy im Interview mit dem katarischen Nachrichtensender Al Jazeera (11.7.2025). Es sei „wirklich schwer vorzustellen, dass das 80 Jahre nach dem Holocaust geschieht“. Verteidigungsminister Katz, der diese „verrückte und teuflische Idee entwickelt hat“, sei selbst ein Nachfahre von Überlebenden des Holocaust, so Levy. Die meisten Israelis hätten alle Menschlichkeit gegenüber Gaza verloren. Konzentrationslager in Gaza?! In Deutschland scheinbar kein Problem. Hier feiert man das deutsch-israelische Jubiläumsjahr [https://www.diplo.news/articles/deutsch-israelisches-jubilaumsjahr]. 60 Jahre israelisch-deutsche diplomatische Beziehungen, gemeinsame Werte und die „strategische Partnerschaft“ mit Israel, die „nur von den USA übertroffen“ wird. Titelbild: lev radin/shutterstock.com
Donald Trump hat an diesem Wochenende mal wieder den Zollhammer ausgepackt. Ein universeller Zollsatz von 30 Prozent soll künftig für Importe aus der EU gelten. Nun will die EU beraten, wie sie auf die erneute Handelskriegsdrohung aus dem Weißen Haus reagieren soll. Sicher, die angekündigten 30 Prozent werden wohl nicht kommen. Sie sind vielmehr eine Verhandlungstaktik des „Dealmakers“ Trump, um die EU zu erpressen und andere Konzessionen zu erlangen. Damit wird er aller Voraussicht nach auch durchkommen, übertreffen sich Europas politische Führer doch gegenseitig in Unterwürfigkeit und vorauseilendem Gehorsam gegen den Großen Bruder. Vielleicht sollte sich die EU einmal das berühmte Olli-Kahn-Zitat „Eier, wir brauchen Eier!“ auf die Fahnen schreiben und mit Trump in der einzigen Sprache reden, die er versteht. Von Jens Berger. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Als Trump nach seiner Amtsübernahme einen generellen Zollsatz in Höhe von 10 Prozent für alle Importe verkündete [https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/], war man in Europa geschockt. Als er kurze Zeit später vor bunten Tafeln den „Liberation Day“ ausrief und fast die ganze Welt mit seinen „reziproken Zöllen“ überzog, war man in Europa endgültig außer sich – nun stieg der Strafzoll auf EU-Importe auf 20 Prozent. Doch in Brüssel und Berlin war man sich einig – so schlimm wird es nicht kommen, nun verhandeln wir ja erst einmal mit den USA. Wobei der Begriff „Verhandeln“ in diesem Kontext ja irgendwie putzig ist. Es ging in keinem Moment darum, Stärke zu zeigen und die offensichtlichen Erpressungen Trumps zu kontern. Ganz im Gegenteil. Das „Verhandlungsziel“ der EU war es, dem Mann aus dem Weißen Haus möglichst tief in den Hintern zu kriechen und ihn durch immer weitere Zugeständnisse zu „besänftigen“. So erklärten die europäischen NATO-Mitglieder sich Ende Juni dazu bereit [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/mark-rutte-umschmeichelt-donald-trump-vor-nato-gipfel,Up3y4K3], künftig die irrsinnige Summe von fünf Prozent der Wirtschaftsleistung für „Verteidigung“ auszugeben. „Es war nicht einfach, aber wir haben sie alle dazu gebracht, sich zu den fünf Prozent zu verpflichten […] Europa wird auf GROSSE Art und Weise Geld ausgeben, so wie es sein sollte, und das wird Dein Sieg sein“, so formulierte es der devote NATO-Generalsekretär Rutte gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump. Vollkommen klar – wer so unterwürfig ist, den kann man nicht ernst nehmen. Dabei ist Europa schon heute der mit Abstand größte Abnehmer von US-Waffen [https://www.zdfheute.de/politik/ausland/europa-us-waffenhandel-ruestungstransfer-sipri-studie-100.html] und wird künftig dank des Kotaus in Sachen Rüstungswahnsinn erst recht für volle Auftragsbücher bei der US-Rüstungsindustrie sorgen. Das war aber längst nicht das einzige „Entgegenkommen“. Bereits im Mai hatte die EU sich bereit erklärt, den USA künftig jährlich zusätzliches LNG und Agrarprodukte wie Sojabohnen im Wert von 50 Milliarden Euro [https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/eu-angebot-usa-zoelle-100.html#:~:text=EU%20legt%20USA%20Zollangebot%20vor,-Stand%3A%2002.05.2025&text=Die%20EU%20bietet%20im%20Zollstreit,USA%20laut%20EU%2DKommission%20ausgeglichen] abzunehmen. Während man – zu Recht – stets darauf verweist, dass Trumps Zölle im Endeffekt von der US-Wirtschaft und den US-Verbrauchern bezahlt werden und daher ein konjunkturelles Eigentor sind, scheint man in Brüssel offenbar zu ignorieren, dass das extrem teure LNG am Ende ja auch von der eigenen Wirtschaft und dem Verbraucher bezahlt wird und das ebenso ein Eigentor ist. Aber immerhin – durch diese 50 Milliarden sei ja die Handelsbilanz dann ausgeglichen und der große, mächtige US-Präsident besänftigt. Darum geht’s. Dass am Ende der europäische Verbraucher den Preis für die Besänftigung zahlt, interessiert nicht weiter. Doch noch nicht einmal das hat offenbar Donald Trump gereicht. So ging man in der EU zur nächsten Stufe der Unterwürfigkeit über – dem vorauseilenden Gehorsam. Während die EU in der Tat beim Handel mit physischen Gütern – auf die Zölle erhoben werden können – einen Außenhandelsüberschuss hat, sieht es bekanntlich im Dienstleistungsbereich genau umgekehrt aus. Hier sind es vor allem die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley und die US-Anbieter digitaler Inhalte, die in der EU Milliardengewinne erzielen, für die sie nicht einmal maßgebliche Steuern bezahlen. Um dieses Problem zu adressieren, hatte man sich in der EU eigentlich die Digitalsteuer ausgedacht, bei der Großkonzerne dieser Branchen über ihren Umsatz in der EU besteuert werden. Diese Pläne wurden – wie Politico am Wochenende berichtet [https://www.politico.eu/article/victory-eu-donald-trump-meta-tax-digital/] – nun von der EU begraben. Politico bezeichnet das als „Sieg Trumps“ in den Zollverhandlungen mit der EU. 3:0 für die USA. Wahrscheinlich dachte man nun in Brüssel, dass man Trump nun endgültig „besänftigt“ hat. Doch das zeigt nur, wie wenig die EU-Verantwortlichen von Verhandlungstaktiken verstehen. Wenn ein Verhandlungspartner ohne Not ein Zugeständnis nach dem anderen macht und sich unterwürfig zeigt, weckt das am Ende erst recht die Gier des Anderen. So ist es eigentlich auch nicht überraschend, dass die Unterwürfigkeit der EU nur dazu geführt hat, dass nun aus den angekündigten Strafzöllen in Höhe von 20 Prozent Strafzölle in Höhe von 30 Prozent wurden. Natürlich sollte man dies nicht wörtlich nehmen. Hätte Trump diese 30 Prozent wirklich gewollt, hätte er sie per Dekret beschlossen. Das hat er nicht. Stattdessen hat er sie für den 1. August angekündigt. Zwischen den Zeilen heißt dies: „Hallo, ihr dummen Europäer, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, mir noch tiefer in den Hintern zu kriechen und schmackhafte Angebote zu machen“. Und genau das wird auch passieren. Vielleicht kann man Trump ja besänftigen, wenn man schnell noch ein paar Eigentore schießt. 4:0, 5:0 … Wann werden die USA besänftigt sein und von uns ablassen? Zwar fletscht die EU auch öffentlichkeitswirksam die Zähne. Man habe ja selbst ein Zollpaket geschnürt, mit dem man zurückschlagen könne. Nun ja. Wie will man aber einen Handelspartner mit Zöllen beeindrucken, der gar keine wesentlichen Güter exportiert? Jeans, Motorräder und Erdnüsse wären betroffen, so liest man. Dramatisch. Wenn ein Zoll auf Erdnüsse der letzte Pfeil ist, den man im Köcher hat, kann man solche „Drohgebärden“ auch ganz lassen. Die EU wirkt wie ein Chihuahua, der einen Rottweiler ankläfft. Lächerlich. Wie sagte einst Olli Kahn? „Eier, wir brauchen Eier!“ [https://www.youtube.com/watch?v=L7jF-ziQaCU] Doch was könnte die EU machen, um sich aus der selbstgewählten Unterwürfigkeit zu befreien? Zunächst sollte sie im Handelsstreit nicht auf Trumps Spielfeld agieren, auf dem sie ja offensichtlich ohnehin keinen Hebel hat, sondern das Spielfeld selbst bestimmen. Wo sind denn US-Konzerne in der EU marktmächtig? Bei den digitalen Dienstleistungen, dem E-Commerce und dem Finanz- und Bankensystem. Und es sage keiner, dass man in diesen Branchen nicht wirkungsvolle Steuern und Abgaben implementieren könnte, mit denen man zielgenau die US-Konzerne trifft; so zielgenau, wie Trumps Strafzölle deutsche Automobilbauer, Maschinenbauer und Pharmakonzerne schädigen. Das ist keine Frage des Könnens, sondern eine Frage des Wollens. Aber dazu muss man schon Eier haben. Aber es gibt noch viele andere Spielfelder, auf denen man Stärke zeigen kann. LNG aus den USA? Warum? Es gibt doch viel preiswerteres Pipelinegas aus Russland. Waffen aus den USA? Warum? Wenn man unbedingt Geld für Rüstung verpulvern will, kann man die Waffensysteme auch selbst entwickeln und herstellen und es wäre ohnehin weise, sich gar nicht auf einen Rüstungswettlauf einzulassen, sondern die europäischen Interessen zu definieren und zu erkennen und dann gemeinsam mit Russland an einer neuen Sicherheitsarchitektur zu arbeiten. Dann braucht man auch keine teuren Waffen und kann das schöne Geld in sinnvollere Dinge investieren. Denn wenn wir schon bei anderen Spielfeldern sind, könnte man sich auch die Frage stellen, warum die USA eigentlich so ein großes Erpressungspotential haben. Gerade Deutschland hat sich durch seine Fokussierung auf die Exportüberschüsse und seine volkswirtschaftliche Spezialisierung auf bestimmte Exportbranchen selbst in diese Lage manövriert. Hätte unsere Volkswirtschaft stattdessen nachhaltig die Binnennachfrage gestärkt und sich breiter in Richtung Zukunftstechnologien aufgestellt, wären wir auch weit weniger erpressbar und würden generell weit weniger von Wohl und Wehe der Weltmärkte abhängen. Aber dafür ist es ja vielleicht noch nicht zu spät. Wenn wir die Eier dazu haben, könnten wir die nötigen Weichen dazu auch jetzt noch stellen. Wenn Trumps Erpressungen am Ende dazu führen, dass Europa erkennt, was für den Kontinent am besten ist … um so besser. Dann könnte man Trump glatt dankbar sein. Titelbild: Yuri Turkov/shutterstock.cok[http://vg04.met.vgwort.de/na/79cf4f89be70450eac1aae68bb14ce90]
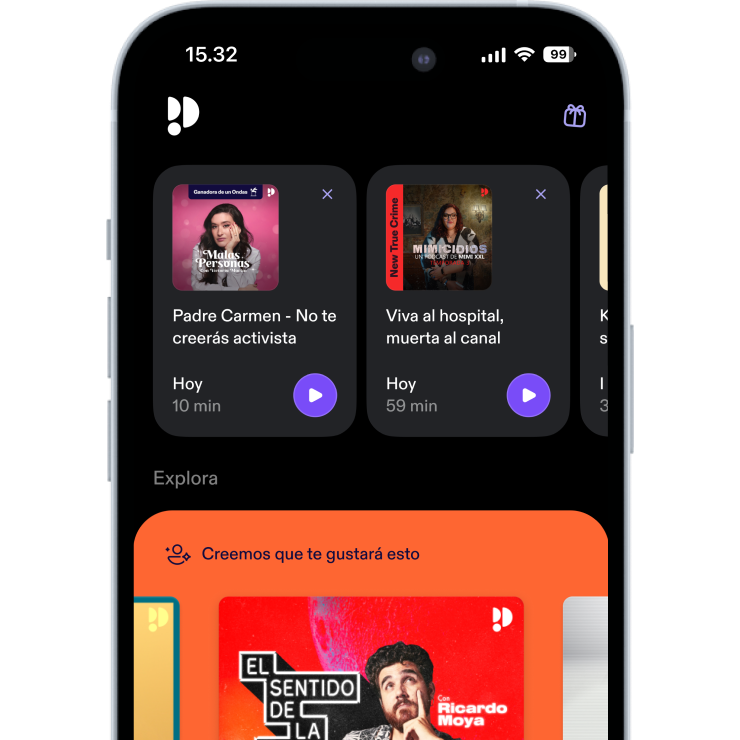
Valorado con 4,7 en la App Store
Disfruta 90 días gratis
4,99 € / mes después de la prueba.Cancela cuando quieras.
Podcasts exclusivos
Sin anuncios
Podcast gratuitos
Audiolibros
20 horas / mes