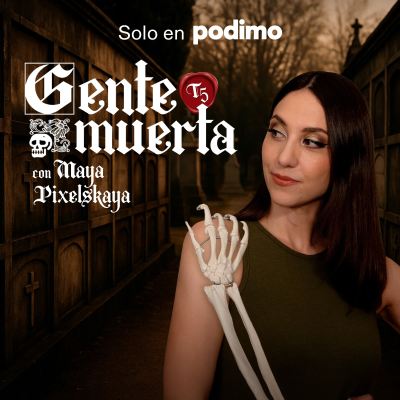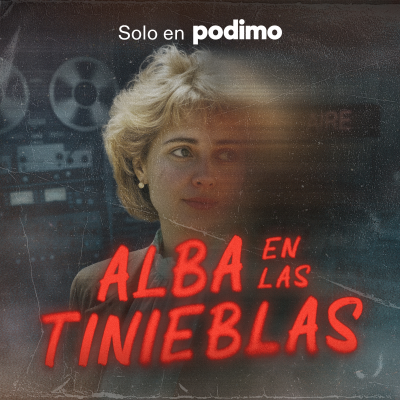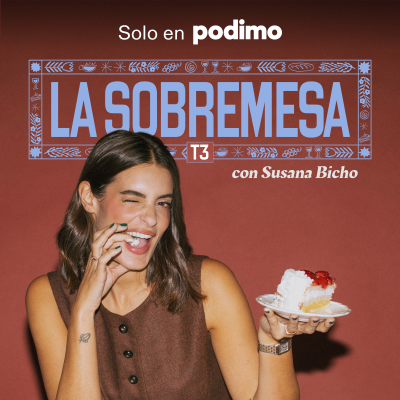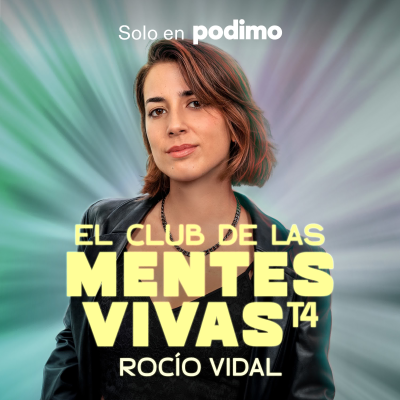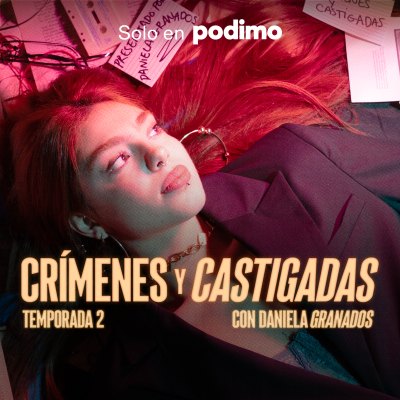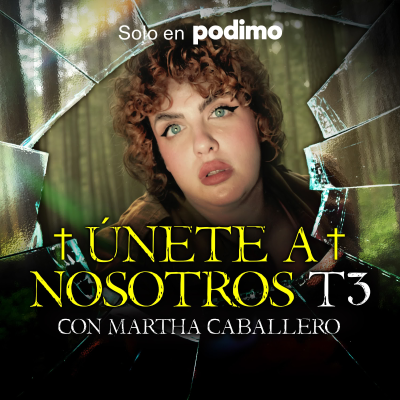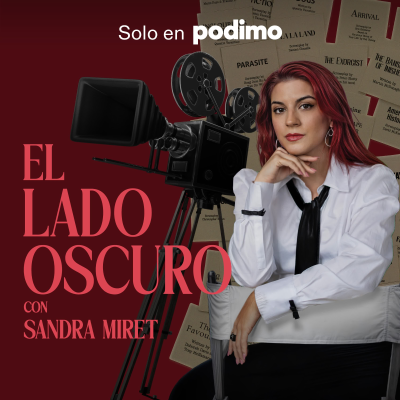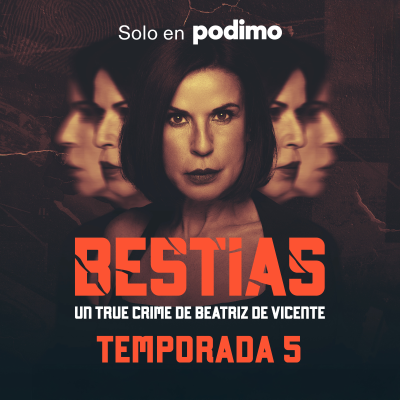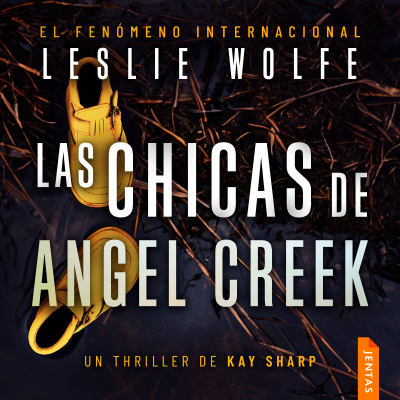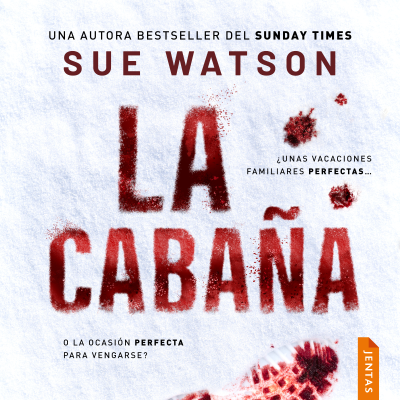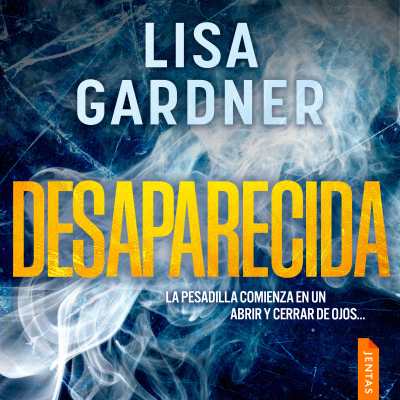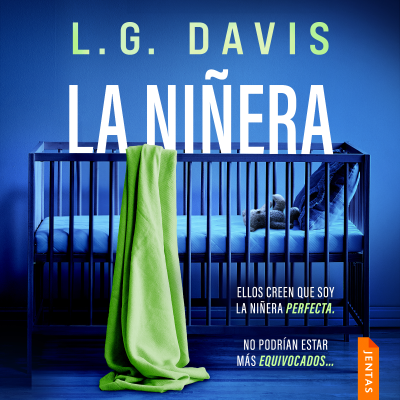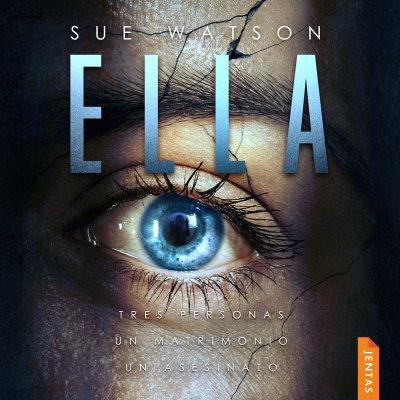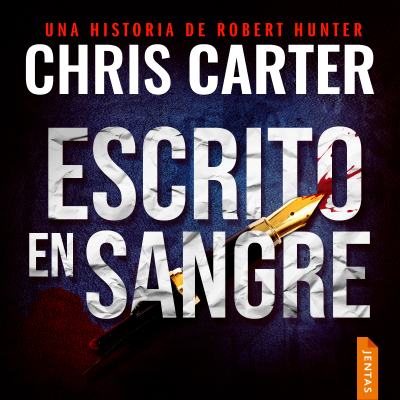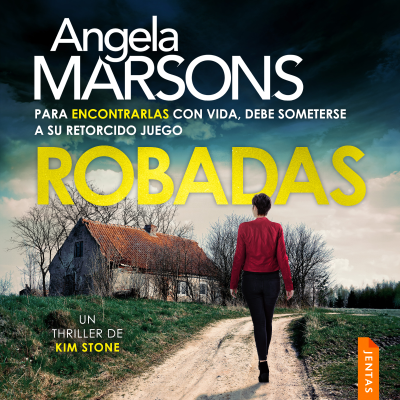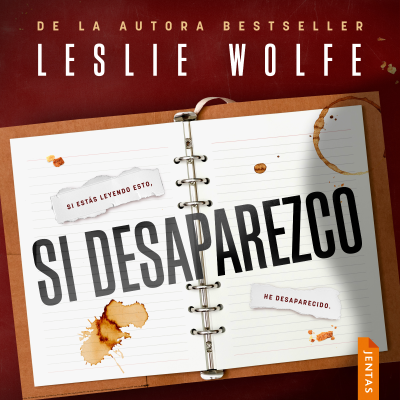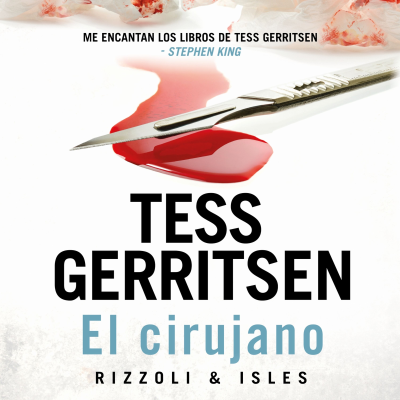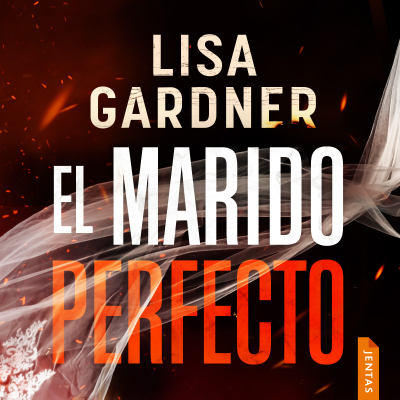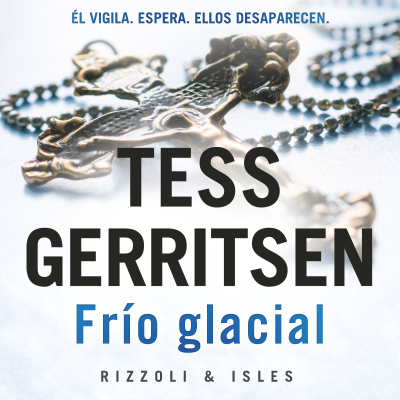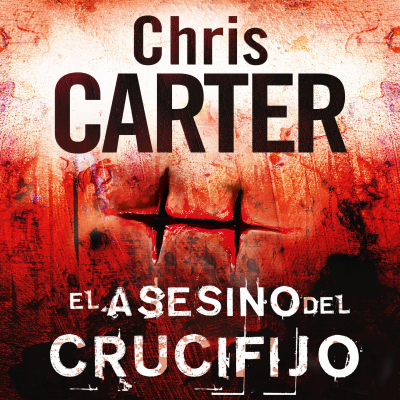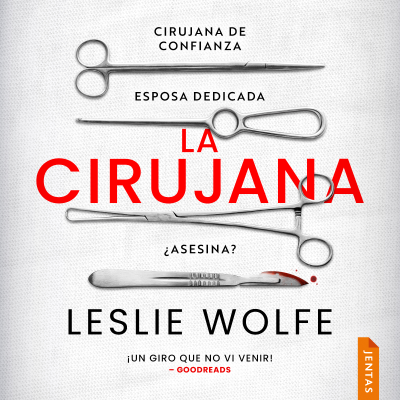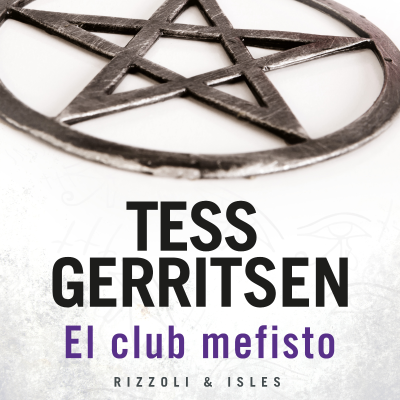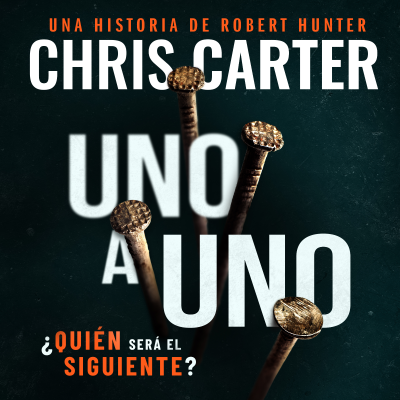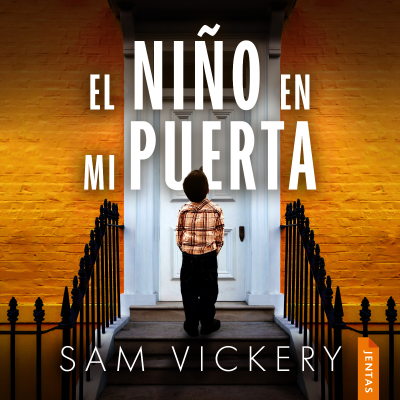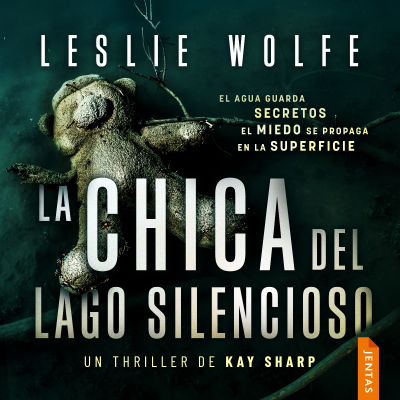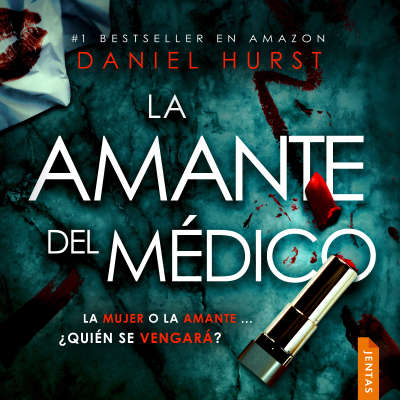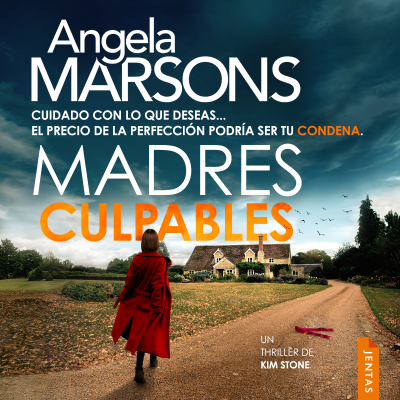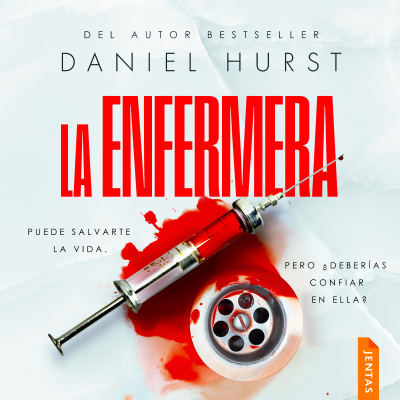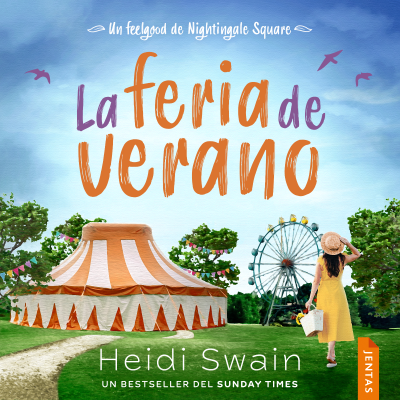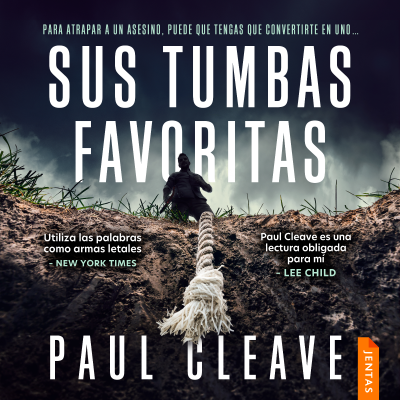NachDenkSeiten – Die kritische Website
alemán
Actualidad y política
Oferta limitada
2 meses por 1 €
Después 4,99 € / mesCancela cuando quieras.
- 20 horas de audiolibros / mes
- Podcasts solo en Podimo
- Podcast gratuitos
Acerca de NachDenkSeiten – Die kritische Website
NachDenkSeiten - Die kritische Website
Todos los episodios
4739 episodiosWiderstand gegen die Eskalationspolitik – Es bewegt sich was
In Deutschland bewegt sich was. Der Widerstand gegen die Eskalationspolitik, gegen die Aufrüstung der Bundeswehr, gegen die Militarisierung der Köpfe durch Politik, Mainstreammedien und „Experten“ wird zunehmend größer. Und das nicht mehr nur allein durch die typischen Verdächtigen, den diversen Gruppen der Friedensbewegung, sondern auch, und das ist bemerkenswert, aus den Reihen derer heraus, die die Militarisierung gutheißen oder gar unterstützen. Von Alexander Neu. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. In einem von mir verfassten Artikel von April 2025 mit dem Titel „Traut Euch und durchbrecht die Schweigespirale“ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=131289] wies ich auf eine Stellungnahme namhafter Experten aus dem Fachbereich der Außen- und Sicherheitspolitik hin. Damals schrieb ich: > „Am 30. März veröffentlichten 15 Experten aus der Wissenschaft mit Schwerpunkt in der Außen- und Sicherheitspolitik eine Stellungnahme mit dem Titel „Rationale Sicherheitspolitik statt Alarmismus“ [https://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/250402-hdt-Rationale_Sicherheitspolitik.pdf]. Initiator ist der Politikwissenschaftler J. Varwick der Uni Halle. Darunter Wissenschaftler, die im Bereich der außen- und sicherheitspolitischen Forschung Rang und Namen haben, beispielsweise neben J. Varwick der von mir geschätzte A. Pradetto der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg sowie Ch. Hacke, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, meiner Alma Mater.“ „Stark für den Frieden“ Am 12. Februar nahm ich an einer Buchvorstellung teil. Vorgestellt wurde die neueste vom Westend-Verlag herausgebrachte Monographie von Prof. Johannes Varwick mit dem Titel „Stark für den Frieden – Was jetzt für eine rationale Sicherheitspolitik zu tun ist“. Der ehemalige Regierende Bürgermeister und ehemalige Bundestagsabgeordnete Michael Müller fungierte nicht nur als Gastgeber, sondern auch als Moderator. Neben Prof. Varwick und M. Müller waren noch Prof. em. A. Pradetto von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg sowie Reiner Schwalb, Brigadegeneral a.D., als Diskussionspartner dabei. Bei der anschließenden Debatte mit dem Auditorium wurde deutlich, dass auch weitere Persönlichkeiten aus Medien und Wissenschaft, wie beispielsweise Prof. em. Ch. Hacke (ehemaliger Journalist der ARD) anwesend waren. Sowohl die Diskussion zwischen den Diskutanten zum Buch als auch die anschließende Diskussion mit dem Auditorium verdeutlichten eines: Sie alle, die das Wort ergriffen, kamen aus dem Milieu der bundesdeutschen Elite. Und sie alle – einschließlich Michael Müller, was mich tatsächlich positiv überraschte – einte das Unverständnis über den gegenwärtigen Kurs der deutschen und EU-europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Nicht minder das Entsetzen über die Berichterstattung der deutschen Mainstreammedien. Es war eine hochwertige und diskursintensive Veranstaltung, ganz ohne Polemik, Diffamierungen oder Ausgrenzungen. Ganz so, wie man sich Debatten wünscht. Prof. Varwick thematisiert in diesem Buch nicht nur die Defizite und Irrungen der Außen- und Sicherheitspolitik, die die wachsenden und immer weniger beherrschbaren Konfliktdynamiken befördern und den Frieden nicht mehr als zentralen Wert betrachten, sondern die „Kriegstüchtigkeit“ der neue Wert sein soll. Varwick, und das macht sein Buch jenseits der außen- und sicherheitspolitischen Debatte nochmals wertvoller, widmete seine persönlichen Erfahrungen als einstmals im Mainstream gefragter Politikwissenschaftler ein ganzes Kapitel. Eine Person, die in Ungnade gefallen ist, da ihre Analysen angeblich das Kremlnarrativ bedienten. Dieses Kapitel ist – neben der sicherheitspolitischen Analyse und Empfehlungen – von besonderem Interesse, da es den gegenwärtigen Zeitgeist reflektiert. Es ist interessant, da es erneut die ewigen Gesetze der Kriegspropaganda und ihre Wirksamkeit belegt: Wie wird heute mit Andersdenkenden in einer eigentlichen freien Gesellschaft umgegangen? Ist die Weisheit des Zeitalters der Aufklärung, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, nur in Schönwetterzeiten en vogue? Waren die 1980er- und 1990er-Jahre die freiesten Jahre in der deutschen Geschichte? Werden wir Zeitzeugen eines demokratischen Rollbacks? Was ist mit dem grundgesetzlich gesicherten Grundrecht auf Meinungs- und Pressefreiheit? Warum werden Menschen in Situationen gebracht, die auch in der sozialen und persönlichen Existenzvernichtung enden können? Warum greifen Menschen zu Diffamierungen und Ausgrenzungen, wenn ihre Argumente von schlechter Faktenqualität sind? Fakten werden zu Fake News verspottet und Fake News werden zu „Fakten“ umgedeutet. Sogenannte Faktenchecker bewegen sich bisweilen im faktenfreien Raum, doch arbeiten sie weiter, weil sie die reale Faktenlage einfach nicht akzeptieren wollen oder dafür bezahlt werden, das Haar in der Suppe zu finden, um den Anderen, den „Abtrünnigen“, zu diskreditieren. Ist das unser Deutschland der 2020er-Jahre? Und genau dieses Kapitel gibt dem Buch eine besondere Note. „Großmachtsucht – Deutschland rüstet für die Führung Europas“ Dieses Buch erschien ebenfalls kürzlich. Das Besondere an dem Buch ist nicht der Titel und der Inhalt – zumindest nicht für die diejenigen, die sich mit der Thematik der Außen- und Sicherheitspolitik vertraut sehen. Auch hier ist das Besondere der Autor des Buches: Jens van Scherpenberg. Der Autor ist eine Person aus der politischen Mitte, wie auch Varwick und andere genannte Namen. Van Scherpenberg war, so die Information zu seiner Person, ab „1977 Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) und leitete von 1997 bis 2006 die dortige Forschungsgruppe Amerika. Er lehrte Internationale Politische Ökonomie an der LMU München“. Der Autor hat also nicht nur an einer renommierten deutschen Universität gelehrt, sondern auch in dem steuerfinanzierten ThinkTank, der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), nahezu 30 Jahre gearbeitet. Die SWP ist nicht irgendein ThinkTank. Sie ist der größte deutsche ThinkTank für Analysen und Beratung zur internationalen Politik. Insbesondere berät die SWP den Bundestag sowie die Bundesregierung. Dass eine Person wie van Scherpenberg plötzlich aus dem Milieu ausbricht und ein wahrlich kritisches Werk über die deutsche Außenpolitik und ihre hegemonialen Ambitionen schreibt, ist bemerkenswert. So stellt er fest: > „Achtzig Jahre nach dem katastrophalen Scheitern des Nazi-Versuchs, mit rücksichtsloser militärischer Gewalt eine Neuordnung Europas unter deutscher Herrschaft durchzusetzen, wurde der russische Krieg gegen die Ukraine für Deutschland – zwar nicht bestellten, aber durchaus willkommenen – Anlass, über seine ohnehin gegebene Stellung als wirtschaftliche Vormacht in Europa hinaus nun auch die Führung als Militärmacht auf dem europäischen Kontinent anzustreben.“ Und noch deutlicher: > „Was die Führer des jeweiligen deutschen Staates in zwei Anläufen im 20. Jahrhundert versuchten – aus Deutschland die führende Großmacht auf dem europäischen Kontinent zu machen -, endete in verheerenden Katastrophen. Der dritte Versuch soll nun endlich gelingen.“ Nicht nur, dass van Scherpenberg die massive Aufrüstung, die Militarisierung in Politik und Staat kritisiert. Nein, er geht sogar noch einen wesentlichen Schritt weiter als Varwick: Van Scherpenberg lüftet die seiner Meinung nach eigentliche Motivation der Militarisierung: Der Wunsch nach einem Großmachtstatus für Deutschland auf dem europäischen Kontinent. Mehr noch, er stellt die gegenwärtigen Großmachtambitionen in eine geopolitische Kontinuität deutscher Elitenpolitik, die des Kaiserreichs – kulminierend im Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 – und die Hitler-Deutschlands – kulminierend im Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945. Bekannterweise scheiterten beide Großmachtprojekte und hinterließen dutzende Millionen Tote auf dem europäischen Kontinent. Der einzige Staat in Europa, der diesem Vorhaben wieder mal im Wege steht, ist Russland. Van Scherpenberg stellt Russland nicht als Opfer dar, sondern neben den europäischen NATO-Staaten – einschließlich Deutschland – als offensiven Akteur. Das Verhältnis zwischen den europäischen NATO-Staaten und Russland erfasst er mit dem Sicherheitsdilemma, einem in der Theorie des Neo-Realismus dargestellten Verhaltensmuster: Demnach rüstet jede Seite auf, oder in der eigenen Perspektive nur nach, weil die andere Seite aufrüstet. Die eigene Seite ist ja nur defensiv orientiert. Mit seinem Buch dürfte sich van Scherpenberg aus der Mainstreamdebatte rausgeschossen haben. Nicht nur, dass er die „notwendige Kriegstüchtigkeit“ ablehnt, nein, er beschmutzt wohl das eigene Nest, indem er – seiner Auffassung nach – die dahinterstehende Motivation der deutschen Elite manifestiert. „Zerfall der Weltordnung – Die Ignoranz des Westens und der Aufstand des Globalen Südens“ So lautet ein ebenfalls im Westend-Verlag erschienenes Buch. Der Autor, Patrick Kaczmarczyk, ist noch vergleichsweise jung. Der Hinweis auf das Alter ist deshalb von Bedeutung, weil mir immer wieder auffällt, dass nicht wenige Kritiker der herrschenden Politik ihre Kritik erst äußern, nachdem sie das Rentenalter erreicht haben. Während ihrer beruflichen Lebensspanne wagen sich offensichtlich viele nicht, frei zu reden respektive zu schreiben. Dies wirft ein Blick auf den Charakter der Personen, aber ein noch viel stärkeres Licht auf den Zustand der Gesellschaft, in der die freie Meinungsäußerung zum vorzeitigen Ende der Karriere führen kann, wie man an der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot erkennen kann. Kaczmarczyk ist ebenfalls ein Mensch der politischen Mitte, wagt aber den intellektuellen Ausbruch, indem er die Doppelstandards westlicher Politik gegenüber dem Globalen Süden skizziert: > „Einerseits setzen wir in unserer Rhetorik auf ,Partnerschaften auf Augenhöhe´ in den Nord-Süd-Beziehungen, wollen andererseits aber in der Praxis an neokolonialen Wirtschaftsabkommen und -strukturen nichts ändern. Primär geht es uns weiterhin um den Zugang zu Rohstoffen (…). Einerseits halten wir demokratische Werte hoch. Andererseits geht es uns gehörig gegen den Strich, dass andere Staaten in der internationalen Ordnung mehr Mitsprache fordern.“ Im letzten Kapitel mit dem Titel „Grundzüge einer neuen Weltordnung“ stellt er zwar interessante und richtige Forderungen, verlässt sich hierbei aber als Handlungspartner auf die „Zivilgesellschaft und den kritischen Teil der Journalisten und Medien“. Diese müssten öffentlichen Druck auf die Politik ausüben. So weit, so gut. Nur, zunehmend steht die Meinungs- und Pressefreiheit zur Debatte und nicht wenige Journalisten und Medien unterstützen oder forcieren sogar diesen Prozess, sodass kritische Medien und Journalisten zunehmend unter Druck geraten – bis hin zur Existenzkrise. Journalistische Solidarität war gestern, inter-mediales Mobbing gegen Medien und Journalisten, die dem Mainstream entgegenstehen, ist heute – wie dies auch die Berliner Zeitung oder die NachDenkSeiten zu spüren bekommen. Und auf die Zivilgesellschaft zu hoffen in einer Zeit enormer gesellschaftlicher Polarisierung, erscheint mir auch gegenwärtig wenig vielversprechend – allerdings habe ich auch keine besseren Antworten. Mit dem Begriff „Zivilgesellschaft“ assoziiere ich das Treiben steuerfinanzierter NGOs, die gegenüber wirklich ehrenamtlichen NGOs organisatorisch und finanziell im Vorteil sind, um ihre Botschaften zu verbreiten. Und diese steuerfinanzierten NGOs sind keineswegs auf der politischen Bahn unterwegs – denn dann würden sie keine staatlichen Gelder erhalten -, die der Autor Kaczmarczyk meinen dürfte, um politischen Druck auszuüben. Ob Kaczmarczyk sich mit diesem durchaus kritischen Buch aus der Mainstreamdebatte verabschiedet hat oder doch noch geduldet wird, bleibt zu beobachten. Fazit Die drei skizzierten Bücher bzw. Autoren stammen allesamt aus der politischen Mitte, hatten ihre Karriere oder stehen mitten im Karriereleben. Alle drei sprechen über die Irrungen und die daraus erwachsenen Gefahren für Deutschland und Europa, womit sie sich aus den warmen Sesseln des aktiven oder passiven Mittuns des politischen Mainstreams verabschieden. Nicht, weil sie es aus einer Laune heraus wollen, sondern weil ihr Wissen in Kombination mit ihrem Gewissen sie treibt. Sie beweisen Rückgrat, der eine früher, der andere später. Deutlich wird aber, dass der Widerspruch nicht mehr nur von den „politischen Rändern“ kommt, sondern auch zunehmend aus der politischen Mitte. Und es werden mehr werden. Titelbild: Andrii Yalanskyi/shutterstock.com[https://vg07.met.vgwort.de/na/679d8ae0353646f8bd3097cf90d1f838]
Das Versagen der christlichen Kirchen
Statt die „Industrie des Todes“ zu verdammen, reden die Prediger ihr das Wort. „Das 21. Jahrhundert wird religiös sein, oder es wird nicht sein.“ Dieser Satz des französischen Politikers und Schriftstellers André Malraux fällt einem ein, wenn man sieht, wie die Illusion einer wertebasierten Weltordnung zerfällt. In einer viel beachteten Rede hatte der kanadische Premierminister Mark Carney in Davos sie als „nützliche Fiktion“ bezeichnet, die nie der Realität entsprochen habe, weil stets Macht und Interessen die Weltpolitik bestimmt hätten. Von Oskar Lafontaine. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Präventivschläge werden unterstützt Um sicherzustellen, dass das Nobelpreiskomitee bei der nächsten Verleihung des Friedensnobelpreises an ihm nicht mehr vorbeikommt, ließ US-Präsident Donald Trump in den letzten Monaten Venezuela, Syrien, Nigeria, Somalia, den Jemen, den Irak und den Iran bombardieren und hat wie kein anderer Politiker deutlich gemacht, dass in der sich neu formierenden Weltordnung das Recht des Stärkeren gilt. „Ich brauche kein internationales Recht (…), nur meine eigene Moral kann mich stoppen“, sagte er kürzlich. Gleichzeitig warnen amerikanische Atomwissenschaftler, dass die Weltordnung mit immer mehr Staaten, die Atomwaffen besitzen, riskanter geworden und nicht zukunftsfähig sei. Bei der Suche nach einer Kraft, die Aufrüstungswahn und Kriegsbegeisterung stoppen könnte, richten sich im Westen die Blicke immer noch auf die christlichen Kirchen. Lange Zeit hatte der im letzten Jahr verstorbene Papst Franziskus im Sinne der christlichen Lehre Aufrüstung und Waffenlieferungen verurteilt. Er nannte die Waffenschmieden eine „Industrie des Todes“ und machte sie für viele Kriege verantwortlich. Und wie zur Bestätigung des Papstes hatte die amerikanische Waffenindustrie ein „Komitee zur NATO-Osterweiterung“ gegründet und finanziert und machte anschließend Milliardengeschäfte. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs bis Ende 2024, so US-Senator Bernie Sanders, haben die amerikanischen Rüstungskonzerne 255 Milliarden Dollar aus Steuermitteln für Waffenlieferungen an Kiew erhalten und ihren Anteilseignern 52 Milliarden Dollar ausgeschüttet. Die beiden Kirchen in Deutschland verhalten sich, wie schon im Dritten Reich, opportunistisch und unterstützen Aufrüstung und Waffenlieferungen. Am 10. März 2022 erklärte die Konferenz der katholischen Bischöfe: „Wir betrachten Rüstungslieferungen in die Ukraine (…) als grundsätzlich legitim.“ Als sie daraufhin kritisiert wurden, erklärten sie, dass sie „überzeugt seien, sowohl dem Evangelium als auch der Lehre der Kirche treu geblieben zu sein“. Da wollten die evangelischen Bischöfe nicht zurückstehen. Sie erklärten: „Rüstungslieferungen, die dazu dienen, dass die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen kann, halten wir für grundsätzlich legitim.“ Anfang November 2025 veröffentlichte die Evangelische Kirche in Deutschland eine Denkschrift: „Welt in Unordnung. Gerechter Frieden im Blick“. Darin unterstützte sie Aufrüstung, Waffenlieferungen, Wirtschaftssanktionen, Präventivschläge und sogar Atomwaffen. Zur atomaren Bewaffnung heißt es: „Die teils offenen, teils versteckten Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen durch die Russische Föderation sind jedoch ein Zeichen dafür, dass auch in einem konventionellen Konflikt nukleare Waffen eine entscheidende Rolle spielen können (…) Der Besitz von Nuklearwaffen kann sicherheitspolitisch notwendig sein, auch wenn ihr Einsatz durch nichts zu rechtfertigen ist.“ „Unprovozierter Angriffskrieg“ Das alles klingt so, als hätten Deutschlands Kriegstreiber wie Roderich Kiesewetter, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Boris Pistorius diesen Text verfasst. Und zu den derzeit laufenden Friedensverhandlungen meint die Evangelische Kirche in Deutschland, Friedensverhandlungen seien „nur dann ethisch vertretbar, wenn sie dem Schutz der territorialen Unversehrtheit und Selbstbestimmung dienen“. Also ohne Rückgabe der Krim kein Frieden? „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen“, lesen wir im Evangelium des Matthäus. Zu den Friedfertigen gehören Bischöfe, die mit Blick auf den Krieg in der Ukraine Aufrüstung und Waffenlieferungen befürworten, ganz bestimmt nicht. Am 6. März 2025 nannte US-Außenminister Marco Rubio den Ukraine-Krieg einen Stellvertreterkrieg zwischen den Atommächten USA und Russland. Mit dieser Wahrheit zertrümmerte der Chefdiplomat Donald Trumps die Lügengeschichte vom unprovozierten russischen Angriffskrieg, der auch die deutschen Bischöfe auf den Leim gegangen sind. „Wenn der Friede ein Werk der Gerechtigkeit ist, ist die Wahrheit das Fundament, auf dem dieser Frieden ruht“, sagte Papst Johannes Paul II. Dieser Beitrag ist zuerst in der Weltwoche Nr. 08.26 [https://weltwoche.de/story/das-versagen-der-christlichen-kirchen/] erschienen. Titelbild: Blur_Stock/shutterstock.com
Der Kanzler und der „naive Pazifismus“ – friedenspolitische Verwahrlosung einer Regierung, die nicht zur Vernunft kommen will
„Die Geschichte lehrt uns: Beschwichtigung schafft keinen Frieden. Sie ermutigt den Aggressor. Wer heute einem naiven Pazifismus folgt, befördert die Kriege von morgen“ – das sind aktuelle Worte von Friedrich Merz [https://x.com/_FriedrichMerz/status/2024824337472061520], veröffentlicht auf der Plattform X. Wie die Welt in Anbetracht solcher Aussagen in einigen Jahren aussehen wird, ist ungewiss. Gewiss ist allerdings: Solche Worte dokumentieren die friedenspolitische Verwahrlosung einer Regierung, die lieber mit dem Kopf durch die Wand rennen will, als zur Vernunft zu kommen. Ein Kommentar von Marcus Klöckner. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Im vergangenen Jahr sagte Merz im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auf einer Veranstaltung: „Frieden gibt es auf jedem Friedhof“ [https://www.youtube.com/watch?v=SSGsIy6IeB8]. Und jetzt diese Worte: „Die Geschichte lehrt uns: Beschwichtigung schafft keinen Frieden. Sie ermutigt den Aggressor. Wer heute einem naiven Pazifismus folgt, befördert die Kriege von morgen.“ Merz, der gerade erst indirekt davon sprach [https://www.tagesspiegel.de/politik/merz-halt-grundsatzrede-auf-der-munchner-sicherheitskonferenz-in-der-ara-der-grossmachte-ist-unsere-freiheit-gefahrdet-15248288.html], dass der 2. Weltkrieg vier Jahre gedauert habe, will hier der Republik eine Lehrstunde in Geschichte erteilen. Maßloser Hochmut ist zum Erkennungszeichen einer Politik geworden, die glaubt, im Besitz der Weltformel zu sein, während sie am kleinen Einmaleins scheitert. Wie oft soll sich die deutsche Öffentlichkeit diese Propaganda noch anhören? Solange, bis sie laut „Hurra!“ zum politischen Großprojekt „Kriegstüchtigkeit“ ruft? Will Merz an dieser Stelle ernsthaft etwa die Beschwichtigungspolitik gegenüber Klein Adolf mit jener Politik, die heute gegenüber Russland zu veranschlagen wäre, vergleichen? Da baut Merz wohl auf jene Grundannahme, nach der Putin bei einem „Sieg“ in der Ukraine einfach weitermarschieren werde – welchen Sinn ein Krieg mit der NATO für Russland haben soll, erklärt der Kanzler freilich nicht. Und da wir von Anmaßung reden: Da sagt Merz, ein naiver Pazifismus befeuere die Kriege von morgen – während der Krieg in der Ukraine seit vier Jahren am Laufen ist und die Opferzahlen längst im Millionenbereich liegen. Wären Merz und seine Mitstreiter mal besser dem „naiven“ Pazifismus gefolgt: Diese beschämenden Schadenszahlen für ein Europa, das für „Frieden“ stehen wollte, gäbe es nicht. Pazifismus tötet keine Menschen – verheerende politische Entscheidungen hingegen sehr wohl. Es wird höchste Zeit, dass die Politik den Pazifismus richtig zu verstehen beginnt – am besten bis vorgestern. Denn während sich manche Politiker mit eher bescheidenem Talent aufschwingen, auf sozialen Medien über die Lehren der Geschichte zu sinnieren, verrecken jeden Tag an der Front Soldaten. Während politische Entscheider keinen Frieden mit einem von ihnen als „naiv“ wahrgenommenen Pazifismus schließen wollen, durchleben die Soldaten auf den Schlachtfeldern die Hölle auf Erden. Eine Politik, deren Rezept zur „Lösung“ des Krieges noch immer jenes Konzept ist, das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat – sagenhafte vier lange Jahre – zu keinem Frieden geführt hat, bittet förmlich danach, dass man sie als wahnsinnig bezeichnet. „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten“ – dieses geflügelte Wort wird bisweilen Einstein zugeschrieben, aber mal unabhängig davon, von wem es stammt: Wer würde bei diesem Spruch nicht unweigerlich die deutsche „Strategie“ im Ukraine-Krieg vor Augen haben? Merz’ jüngste Äußerungen dokumentieren die friedenspolitische Verwahrlosung einer Regierung, die lieber mit dem Kopf durch die Wand rennen will, als zur Vernunft zu kommen. Titelbild: shutterstock.com / penofoto
Die Bahn aktuell: Mangelnde Sicherheit, eingefrorene Baustellen, schrumpfender Güterverkehr und kollabierende Rolltreppen
Eines muss man Evelyn Palla lassen: Als sie am 22. September 2025 offiziell als neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG vorgestellt wurde, bemühte sie sich – anders als ihre Vorgänger – sofort, allzu hohe Erwartungen auf eine schnelle Trendwende bei dem maroden bundeseigenen Konzern zu dämpfen. Zwar werde sie sich sofort daranmachen, den Konzern umfassend umzubauen und neu auszurichten, aber „nichts wird schnell gehen“, denn es handele sich „nicht um einen Sprint, sondern um einen Marathonlauf“. Von Rainer Balcerowiak. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Weder bei den Pünktlichkeitsquoten noch bei den stets mit massiven Einschränkungen verbundenen, chaotisch verlaufenden Sanierungsarbeiten seien schnelle Verbesserungen zu erwarten. Ein von ihr im Januar vorgestelltes Sofortprogramm beinhaltete lediglich unmittelbare Investitionen in Höhe von 50 Millionen für verbesserte Sauberkeit, erhöhte Sicherheit, besseren Komfort im Fernverkehr und optimierte Fahrgastinformation – zunächst allerdings nur auf den 25 wichtigsten Bahnhöfen. Die erfahrene Managerin wird bei ihrem Amtsantritt gewusst haben, was für eine Herkulesaufgabe vor ihr steht. Und in den ersten Wochen des Jahres kam es dann knüppeldick. Am 2. Februar sorgte ein Gewaltexzess in einem Regionalexpress für allgemeines Entsetzen. Der Zugbegleiter Serkan C. wurde im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle von einem Fahrgast zu Tode geprügelt. In der Folge wurde deutlich, dass Attacken auf Bahnmitarbeiter besonders in Regionalzügen längst alltäglich sind [https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/zugbegleiter-sicherheit-betroffene-100.html]. Auf einer von Palla schnell einberufenen Sicherheitskonferenz wurden Verbesserungen vereinbart, wie etwa die Ausstattung der Zugbegleiter mit Körperkameras (Bodycams) und die Aufstockung des Zug- und Sicherheitspersonals. Doch bis zur flächendeckenden Umsetzung wird noch einige Zeit ins Land gehen. Mit Winter kann ja niemand rechnen Eine Hiobsbotschaft von einer anderen Baustelle folgte am 16. Februar. Die im September 2025 begonnene Generalsanierung der Strecke Berlin-Hamburg wird möglicherweise deutlich länger dauern als geplant. Ursprünglich sollten die Arbeiten am 30. April beendet sein. Als Begründung für die Verzögerung wurde der „ungewöhnlich harte und lange andauernde Wintereinbruch” genannt. Für die betroffenen Länder – neben Berlin und Hamburg auch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein – ist das ein harter Schlag. Denn betroffen ist nicht nur die ICE-Direktverbindung zwischen Berlin und Hamburg, die seit Beginn der Arbeiten mit ausgedünnten Takten und mindestens 45 Minuten längerer Fahrzeit über eine Umleitungsstrecke mit Halt in Stendal und Uelzen führt. Aber auch einige von Berufspendlern stark frequentierte Strecken, etwa nach Wittenberge oder Ludwigslust, sind komplett vom Schienenverkehr abgekoppelt, was durch Schienenersatzverkehr nur unzureichend kompensiert werden kann. In einer Art Brandbrief forderten die betroffenen Länder von der Bahn die „Bündelung aller Ressourcen” zur Fertigstellung der Baumaßnahmen sowie einen neuen, abgestimmten Terminplan, der „unverzüglich vorzulegen” sei und fortlaufend kommuniziert werden müsse. Darüber hinaus müsse der weitere Ersatzverkehr bis zum Ende der Bauarbeiten sichergestellt werden. Die Mehrkosten dürften weder den Ländern noch Kommunen oder Fahrgästen auferlegt werden. Zahlen solle ausschließlich die Bahn. Kritisiert wurde ferner, dass die Terminverschiebung aus heiterem Himmel erfolgt sei, denn noch eine Woche zuvor habe die Bahn-Chefin in Gesprächen betont, dass alles in Ordnung sei, kritisierte die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Doch ein paar Tage später ist wieder alles anders. Und genau das ist Problem der Deutschen Bahn: dass die Bürger und Bürgerinnen sich einfach nicht darauf verlassen können“, so Schwesig in einem Video [https://www.nordkurier.de/regional/mecklenburg-vorpommern/buerger-koennen-sich-nicht-verlassen-schwesig-attackiert-bahnchefin-4365901]. Doch die Bahn will erst am 13. März einen neuen Zeitplan für den Abschluss der Arbeiten vorlegen. Außerdem gibt es Befürchtungen, dass die Verzögerung mehrere Wochen oder gar Monate dauern könnte. Und längst wird die Frage aufgeworfen, wie es sein kann, dass ein jahrelang geplantes, umfangreiches Sanierungsprojekt durch einen für die Monate Januar und Februar nicht sonderlich ungewöhnlichen Wintereinbruch komplett aus dem Gleis geschleudert wird. Kahlschlag beim Güterverkehr Aber schon wenige Tage später platzte die nächste Bahn-Bombe. Der chronisch defizitären Gütersparte DB Cargo wird eine heftige Schrumpfkur verordnet. Von den derzeit rund 14.000 Vollzeitstellen hierzulande sollen 6.200 wegfallen, erklärte der neue DB-Cargo-Chef Bernhard Osburg. Betroffen seien alle Bereiche, also Fahrbetrieb, Disposition sowie Vertrieb und IT. Vor allem beim Einzelwagenverkehr sind Einschnitte geplant, 2.000 Stellen sollen allein hier wegfallen. Bei dieser Verkehrsart werden einzelne Wagen bei Industriekunden abgeholt und auf großen Rangierbahnhöfen zu langen Zügen zusammengestellt. Am Zielort werden sie wieder auseinandergenommen und die Waggons einzeln zum Endkunden weitertransportiert. Künftig soll die sogenannte Zugbildung auf vier Hauptstandorte konzentriert werden: Köln-Gremberg, Seelze, Mannheim und Nürnberg. Fünf weitere Rangieranlagen sollen als nachgelagerte Standorte mit einer flexibleren Auslastung betrieben werden. Von derzeit 27 Instandhaltungswerken sollen zwölf geschlossen oder verkauft werden. Anders als das Sanierungsdesaster bei der Strecke Berlin-Hamburg kommt die Cargo-Schrumpfkur aber gewissermaßen mit Ansage. Die Gütersparte schreibt seit Jahren tiefrote Zahlen, die durch den Gesamtkonzern ausgeglichen wurden. Es ist aber nicht vereinbar mit dem EU-Beihilferecht, dass ein staatlicher Konzern ein defizitäres Tochterunternehmen, das auf einem liberalisierten Markt tätig ist, quasi künstlich am Leben hält. Der Streit tobt seit Jahren, und mittlerweile ist klar, dass DB Cargo noch in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben muss, ansonsten drohen sehr hohe Bußgelder und letztendlich die Zerschlagung. Auch dieser laute Knall hat eine lange Vorgeschichte, denn trotz aller Lippenbekenntnisse zur Gütersparte als Leuchtturm der ökologischen Verkehrswende durch Verlagerung von Transporten von der Straße auf die Schiene [https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/masterplan-schienengueterverkehr.pdf?__blob=publicationFile] hat der Konzern in den vergangenen beiden Jahrzehnten so ziemlich alles getan, um DB Cargo zu Schrott zu fahren. Viele Strecken, Umladestationen und vor allem Gleisanschlüsse an Firmen wurden abgebaut, und es gibt viel zu wenig separate Gütertrassen. Wirtschaftlich wieder auf die Erfolgsspur soll DB Cargo jetzt vor allem durch stärkere Fokussierung auf den gesamteuropäischen Schienenverkehrsmarkt kommen – und natürlich durch massiven Stellenabbau im Inland. Wozu Rolltreppen: Man kann auch laufen Wenn bei der Bahn die Hütte brennt, darf natürlich auch die deutsche Hauptstadt nicht abseitsstehen. Denn der Berliner Hauptbahnhof und auch der Fern- und Regionalbahnhof Südkreuz sind vor einigen Tagen zu Fitnessstudios umfunktioniert worden. Nach dem abrupten Ausfall zweier Rolltreppen – eine fuhr sogar plötzlich rückwärts – wurden am vergangenen Sonntag im Hauptbahnhof 42 von 54 Rolltreppen außer Betrieb genommen [https://www.ardmediathek.de/video/rbb24/rolltreppen-am-hauptbahnhof-abgestellt/rbb/Y3JpZDovL3JiYl8xNzlkOTgwMi03NTA1LTRkNWMtYWIwNy1iOTMyYzlkZjIxOTVfcHVibGljYXRpb24]. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, da bei einem bestimmten Rolltreppen-Typ zuletzt Defekte am Getriebe aufgetreten seien, und das müsse jetzt genauer untersucht werden, sagte ein Bahn-Sprecher. Wann die Rolltreppen wieder in Betrieb gehen, ist weiterhin offen. Auf die Frage, ob es sich um Tage oder Wochen handeln könnte, erklärte die Bahn, dass man dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen könne. Bleibt die Frage, warum man jetzt die große Reißleine ziehen muss, weil eine Rolltreppe plötzlich rückwärts fährt, obwohl bereits vorher bekannt war, dass mit diesem Rolltreppen-Typ irgendetwas nicht stimmt. Was das in einem großen Kreuzungsbahnhof mit vier Ebenen und rund 300.000 Nutzern pro Tag bedeutet, kann man sich vorstellen. Jedenfalls ist es definitiv nicht das, was die neue Bahnchefin Evelyn Palla im Januar als „Sofortprogramm für besseren Komfort im Fernverkehr” ankündigt hat. Aber egal ob prekäre Sicherheitslage in Regionalzügen, eingefrorene Baustellen, Schrumpfung der Gütersparte oder eben auch kollabierende Rolltreppen: Bei allem handele es sich schließlich „nicht um einen Sprint, sondern um einen Marathonlauf“. Om … Titelbild: Pusteflower9024/shutterstock.com[https://vg04.met.vgwort.de/na/b38833ba75244bf7a42e458787009b1a]
Russlands Gurkenkrise als Krise des deutschen Journalismus
In Russland sind die Preise für Gurken drastisch gestiegen. Die großen deutschen Medien sehen darin den Vorboten für einen bevorstehenden Aufstand der russischen Verbraucher und den baldigen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft. Der Krieg senkt den Lebensstandard der Russen, ist die These. An der ist bei genauerer Hinsicht allerdings nichts dran. Es handelt sich vielmehr um Selbstbetrug, der seine Ursache darin hat, jede Information aus Russland ins vorgegebene Narrativ pressen zu müssen. Von Gert-Ewen Ungar. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Der Spiegel ist einer ganz heißen Sache auf der Spur: Verbraucher beschweren sich über steigende Preise. Die Russen sind da keine Ausnahme. Alles andere in dem Beitrag [https://www.spiegel.de/ausland/russland-auf-tiktok-instagram-und-co-klagen-nutzer-ueber-hohe-lebensmittelpreise-a-0e21a9ef-b2c5-4269-b45c-1b875d32437f] (Bezahlschranke) „Wenn der Krieg in den Supermarkt kommt“ ist allerdings ziemlich weit hergeholt und spekulativ. Aber der Reihe nach: Die Gurkenpreise sind in Russland stark gestiegen. Neulich im Supermarkt habe ich nach Ansicht eines Preisschildes für Gurken kurzfristig die Pläne fürs Abendessen umgeworfen, mich umentschieden und statt einer Salatgurke eine Ananas gekauft, denn der Kilopreis war günstiger. Dass die Ananas letztlich dann doch mehr gekostet hat als eine Salatgurke, versteht sich von selbst. Eine Ananas wiegt einfach mehr als eine Gurke. Ein bisschen Selbstbetrug aus Genussgründen ist aber erlaubt. Ja, die Gurkenpreise sind derzeit hoch in Russland. Was allerdings der deutsche Blätterwald aus dieser Information macht, ist Unsinn. Wie der Spiegel stellt auch die BILD-Zeitung unter der Überschrift „Gurken-Wut in Russland” eine Verbindung zwischen hohen Gurkenpreisen und Ukraine-Krieg her. Ebenso haben sich der Stern, der Tagesspiegel und viele andere des russischen Gurkenproblems angenommen. Die Berichte lauten alle ähnlich. Die Quintessenz: Der Krieg macht in Russland alles teurer, der Lebensstandard der Russen sinkt kriegsbedingt. Es lohnt sich, diese Berichte etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, denn an ihnen lässt sich zeigen, wie Desinformation und Propaganda funktionieren. Was in diesen Berichten neben den hohen Gurkenpreisen noch stimmt, ist, dass in Russland zum ersten Januar die Mehrwertsteuer erhöht wurde. Sie beträgt nun 22 Prozent, allerdings nicht auf Lebensmittel. Diese Information wird den Lesern von Spiegel und Co. aber verschwiegen. Auf Lebensmittel gilt in Russland weiterhin der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von zehn Prozent. Schon aus diesem Grund ist die Konstruktion „mit den hohen Gurkenpreisen finanziert Putin seinen Krieg in der Ukraine” bestenfalls fragwürdig. Die hohen Gurkenpreise sind weniger dem Krieg, sondern eher einer Marktverzerrung geschuldet. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich ein Monopol ausgebildet hat, das den Markt kontrolliert. Lokale Produzenten beschweren sich über mangelnden Marktzugang und schlechte Absatzmöglichkeiten. Der Agrar-Konzern Rost [https://rostgroup.ru/about/] eröffnet dagegen in Serie riesige Treibhäuser, erhält dafür vermutlich sogar staatliche Förderung. Gleichzeitig beglückt er mit einer aufwändig produzierten Werbung für Gurken seiner Marke Botanika [https://youtu.be/ZdiLHpymvFE?si=6qs5i1rsoSaVufAl] die Fernsehzuschauer pro Werbeblock oft gleich mehrfach. Die Verbindung zwischen dieser penetranten Dauerwerbung und den hohen Preisen ist deutlich gradliniger als die von den deutschen Gazetten gezogene Verbindung zwischen Gurkenpreis und Kosten für den Krieg. Ähnlich verhält es sich auch mit den Preisen für Geflügel. Dahinter steckt zwar ein anderer Konzern, aber das Schema ist ähnlich. Die Information über eine mögliche Marktverzerrung wird in russischen Medien auch kommuniziert, von den deutschen Blättern allerdings nicht aufgenommen. Sie würde den erzeugten erzählerischen Spannungsbogen von Gurkenpreis zu Kriegsgeschehen doch empfindlich stören. Für die russischen Verbraucher ist unterdessen Abhilfe in Sicht. Das russische Kartellamt hat sich der Sache angenommen und untersucht, wie es zu den überdurchschnittlichen Preissteigerungen gekommen ist. Es ist zu erwarten, dass die Gurkenpreise demnächst sinken. Das war bisher immer so. Der vorhergesagte Zusammenbruch der russischen Wirtschaft und der Sturz Putins durch einen landesweiten Aufstand erzürnter Verbraucher wird auch dieses Mal ausbleiben. Dass ihre Prophezeiungen nicht in Erfüllung gehen, fördert bei den Westmedien allerdings nicht die Einsicht. Der endgültige Zusammenbruch der russischen Wirtschaft wurde bereits im Jahr 2023 vorhergesagt, als die Eierpreise stark anstiegen. Die Gründe für den Preisanstieg waren vielfältig. Letztlich griff der Staat regulierend ein, die Preise fielen ebenso drastisch, wie sie zuvor angestiegen waren. Plötzlich kosteten zehn Eier nur noch rund 50 Cent, und die entsprechenden Regale in den Supermärkten waren übervoll. Das war natürlich ebenfalls nicht nachhaltig, machte aber eindrucksvoll deutlich, dass die russische Regierung die Verbraucher vor Marktverzerrungen schützt. Inzwischen hat sich die Eier-Lage in Russland wieder normalisiert. Ähnlich verhielt es sich mit dem prognostizierten Untergang Russlands wegen gestiegener Butterpreise. Mit anderen Worten: Die Westpresse macht sich, vor allem aber ihren Lesern mit den entworfenen russischen Untergangsszenarien etwas vor. Sie zeigt dabei auch, dass sie von den inneren Zusammenhängen in Russland entweder keine Ahnung hat oder sie ihren Lesern vorenthalten möchte. Dabei wäre eine klare und unvoreingenommene Analyse dringend notwendig, denn den Westeuropäern unterlaufen gerade im Hinblick auf die russische Wirtschaft schwere Denkfehler. So wird in den Berichten über die hohen Gurkenpreise zwar auf die Abhängigkeit der russischen Wirtschaft vom Öl-Export hingewiesen. Allerdings sind die russischen Einnahmen aus dem Ölgeschäft nicht wegen der Sanktionen, sondern wegen des allgemein gesunkenen Ölpreises aufgrund sinkender globaler Nachfrage eingebrochen. Aktuell unternimmt Donald Trump mit seiner Zündelei im Persischen Golf jedoch viel, damit der Ölpreis und damit auch Russlands Einnahmen aus dem Ölgeschäft wieder steigen. Dass die sinkenden Einnahmen aus dem Ölgeschäft Einfluss auf die russische Fähigkeit haben, den Krieg zu finanzieren, ist ebenfalls fragwürdig. Russland kauft keine Waffen im Ausland. Alles, was den Ukraine-Krieg anbetrifft, wird in Rubel abgewickelt. Den kann die russische Zentralbank allerdings unendlich nachdrucken. Der Außenhandel ist für Russlands militärische Fähigkeiten weitgehend irrelevant. Der Ölpreisdeckel der EU erweist sich dagegen als ziemlich wirkungslos. Der von der EU verhängte Deckel liegt seit Februar bei 44,10 Dollar pro Fass. Am 19. Februar belief sich der Preis [https://tradingeconomics.com/commodity/urals-oil] für ein Fass der russischen Rohölsorte Urals jedoch auf 58,50 Dollar. Der russische Ölpreis folgt den allgemeinen Schwankungen auf dem Weltmarkt. Der Ölpreisdeckel hat praktisch keine Auswirkungen auf das russische Ölgeschäft. Doch statt diesen Zusammenhang den Medienkonsumenten und politischen Entscheidern in Deutschland zugänglich zu machen, ergehen sich die großen deutschen Medienhäuser in Gurken-Astrologie, mit der sie vorhersagen, dass all das, was mit dem Sanktionsregime erreicht werden sollte, zweifellos demnächst eintreten wird: Die russische Wirtschaft bricht zusammen, die Russen stehen auf, das „System Putin” ist am Ende. Diese Form des Selbstbetrugs bezahlen die Westeuropäer mit wirtschaftlichem Niedergang. Die aktuelle Diskussion über die Gurkenpreise wurde übrigens vom BBC-Journalisten Steve Rosenberg ausgelöst. Der verbreitete am 9. Februar auf X die Nachricht von den steigenden Gurkenpreisen und davon, dass die Lücke zwischen Löhnen, Renten und Lebenshaltungskosten in Russland angeblich immer größer werden würde. > From today’s Russian papers: cucumber prices in Russia jump 42.85% in a month, number of loss-making companies rising, wage arrears growing, “…gap between pensions & wages increasing.” #ReadingRussia [https://twitter.com/hashtag/ReadingRussia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw] pic.twitter.com/TmawpW1Qyl [https://t.co/TmawpW1Qyl] > > — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 9, 2026 [https://twitter.com/BBCSteveR/status/2020766094957400228?ref_src=twsrc%5Etfw] Diese Information ist schlicht falsch. Die Löhne in Russland wachsen, ebenso die Renten. Der Lebensstandard in Russland steigt. Dass Verbraucher auch bei wachsendem Wohlstand über steigende Lebensmittelpreise meckern, ist ein Phänomen, mit dem wohl alle Regierungen der Welt leben müssen. Dass Rosenberg die Lebenswirklichkeit in Russland entgeht und er vom wachsenden Wohlstand in Russland keine Ahnung hat, muss allerdings bezweifelt werden. Er lebt seit Jahren in Moskau und spricht Russisch. Er führt seine Follower absichtlich in die Irre. Zahlreiche deutsche Medien haben seine Geschichte rund um die steigenden Gurkenpreise aufgenommen, plappern sie nach und unterfüttern sie. Alles, was ihr widerspricht, wird weggelassen. Rosenberg ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, dass es um die Presse- und Meinungsfreiheit in Russland deutlich besser bestellt ist als in Westeuropa. Rosenberg hat seinen festen Platz in den Pressekonferenzen Putins. Er bekommt regelmäßig das Wort erteilt, darf seine Fragen auf der Grundlage der westlichen Narrative über Russland stellen und erhält ausführlich Antwort. Diese Antworten ordnet er wiederum ins vorgegebene Narrativ ein und bestärkt die Zuschauer der BBC in ihren Vorurteilen über Russland, unterlegt mit aus dem Kontext gerissenen O-Ton. Rosenberg ist mehr Propagandist als Journalist. Dennoch werden Rosenberg in Russland nicht die Konten gekündigt, er verliert nicht seine Akkreditierung, weder ihm noch seinen Familienmitgliedern wird der Pass entzogen und er wird auch nicht mit Sanktionen belegt. Ihn ereilt nichts von dem, was seinen russischen Journalisten-Kollegen in Deutschland zuteil wurde. Er muss sich nur ab und zu einen Kommentar zu seiner extrem verzerrten Berichterstattung anhören – unter anderem von Putin persönlich. Kein Gulag, kein Fenstersturz, nichts von dem, was man in Deutschland und Westeuropa für in Russland an der Tagesordnung hält. Seine Prognosen über den kurz bevorstehenden Zerfall Russlands darf er ungestraft verbreiten, wovon er reichlichen Gebrauch macht. Im Grunde dient er damit sogar Russland. Denn solange er und seine Kollegen die Westeuropäer über die tatsächlichen Lebensverhältnisse in Russland im Unklaren lassen und lediglich die vorgegebenen Narrative bedienen, sind tatsächlich wirkungsvolle Maßnahmen gegen Russland nicht zu erwarten. Das ist die positive Seite des Selbstbetrugs der westlichen Propaganda. Die angekündigte Gurken-Revolution fällt aus. Titelbild: ChatGPT, erstellt mit künstlicher Intelligenz
Elige tu suscripción
Oferta limitada
Premium
20 horas de audiolibros
Podcasts solo en Podimo
Podcast gratuitos
Cancela cuando quieras
2 meses por 1 €
Después 4,99 € / mes
Premium Plus
100 horas de audiolibros
Podcasts solo en Podimo
Podcast gratuitos
Cancela cuando quieras
Disfruta 30 días gratis
Después 9,99 € / mes
2 meses por 1 €. Después 4,99 € / mes. Cancela cuando quieras.