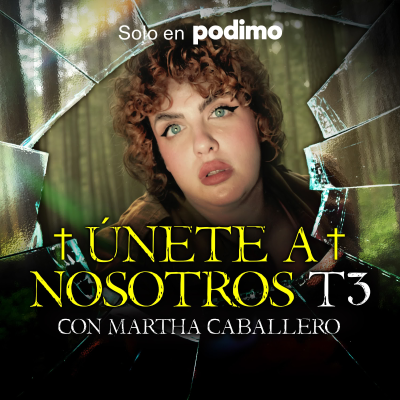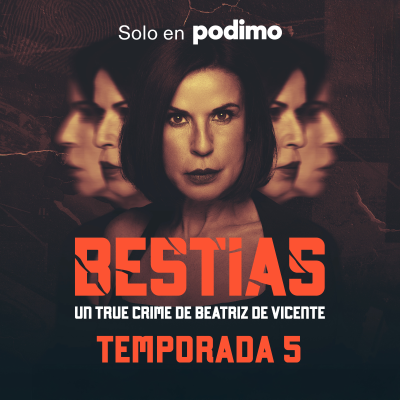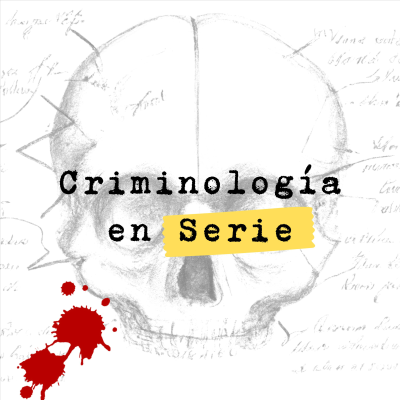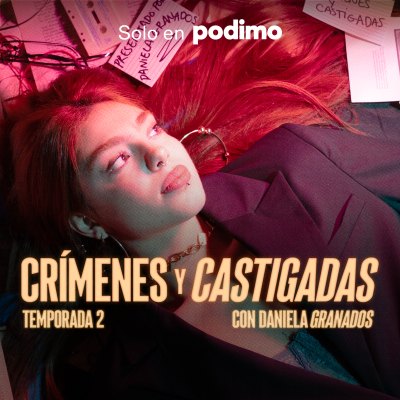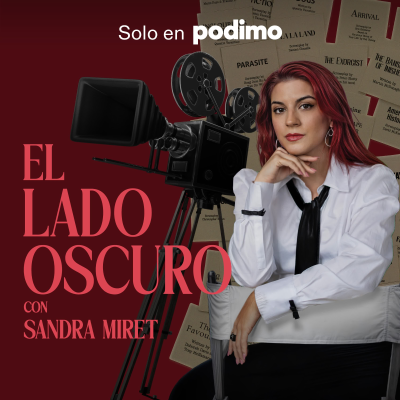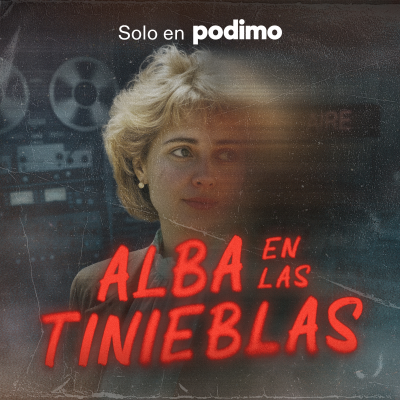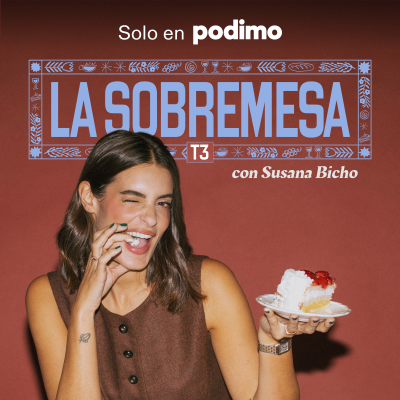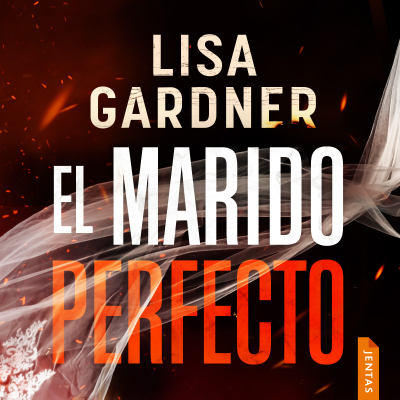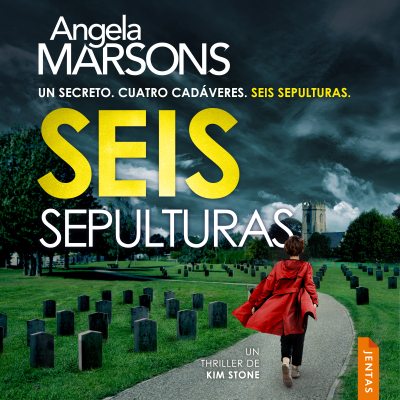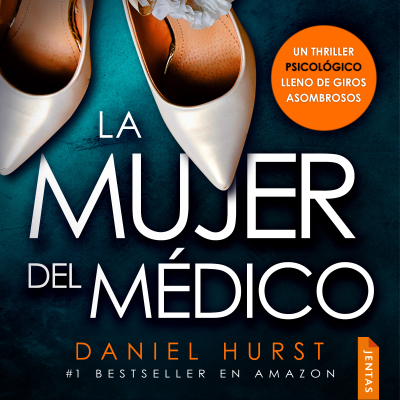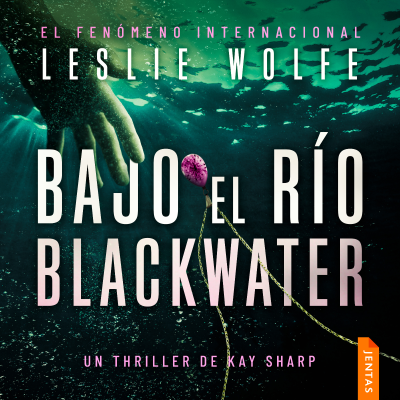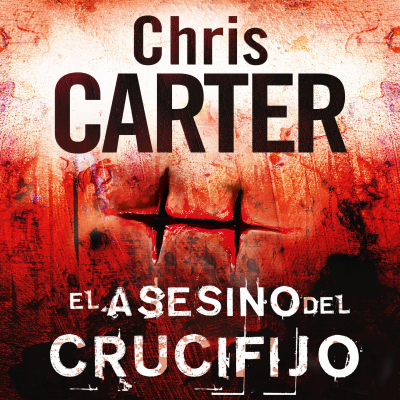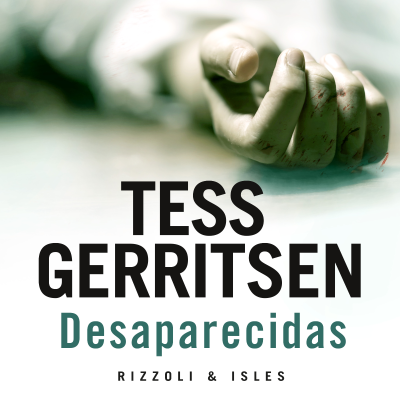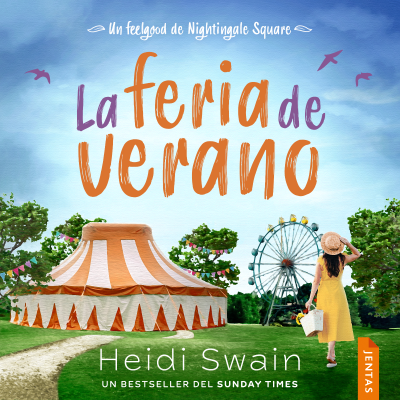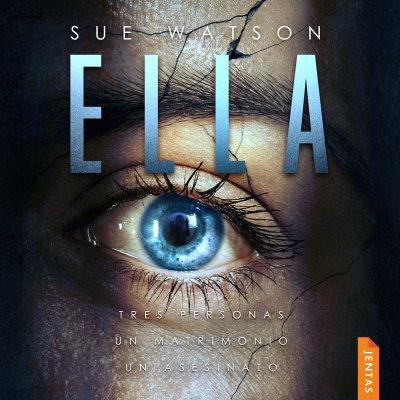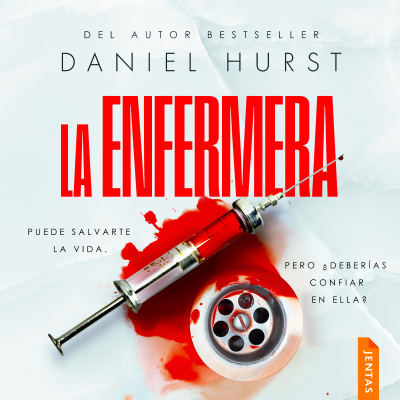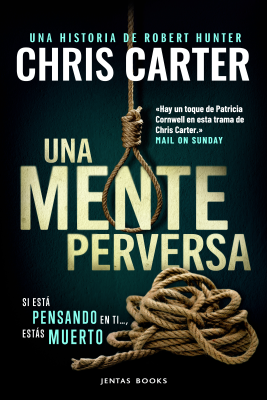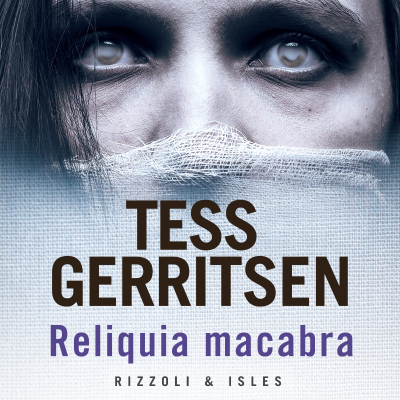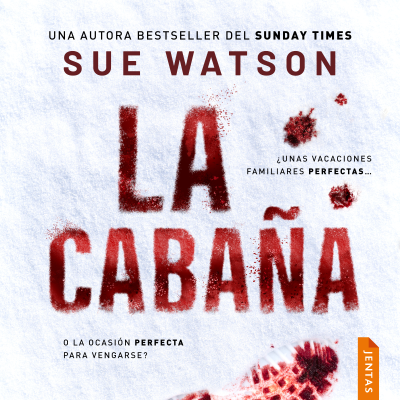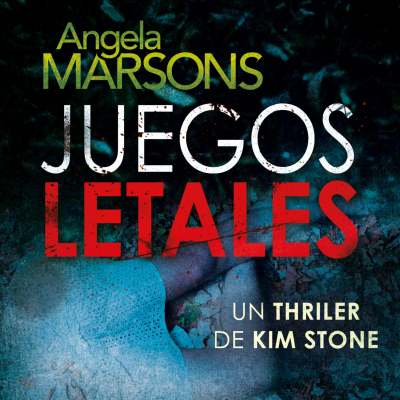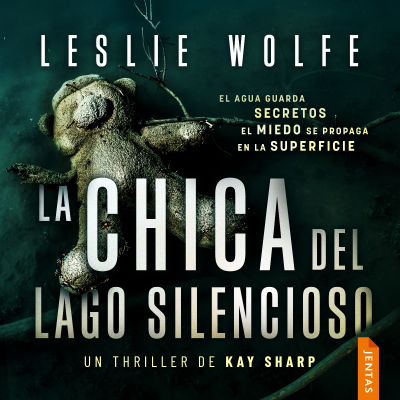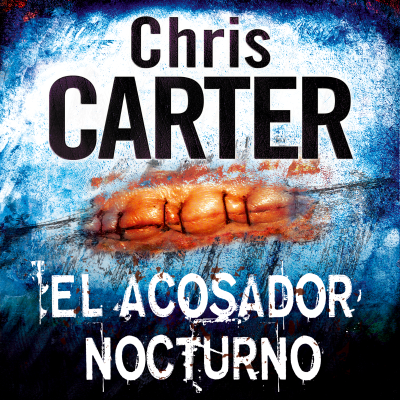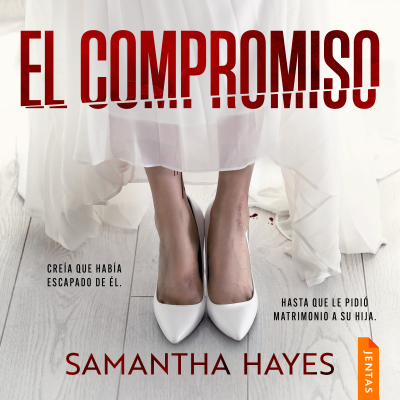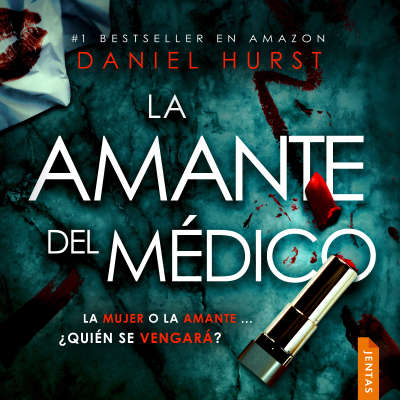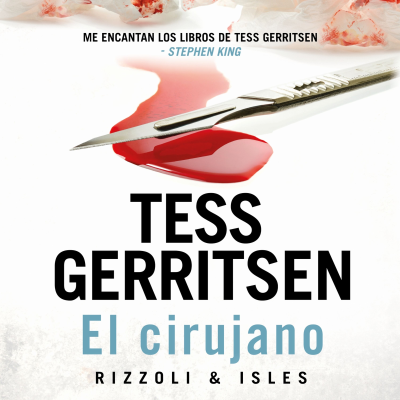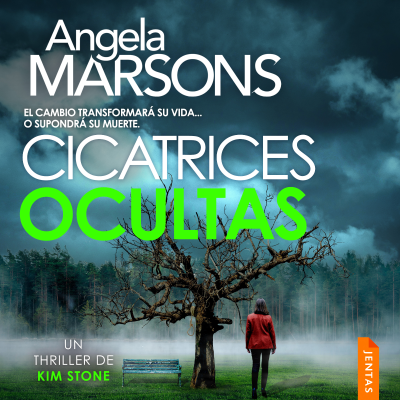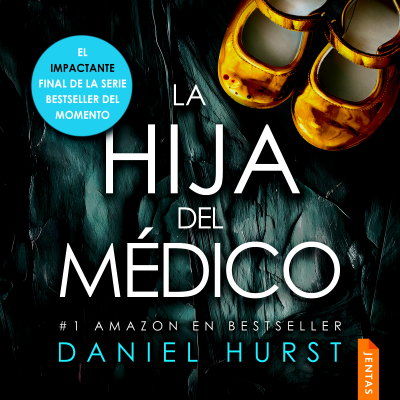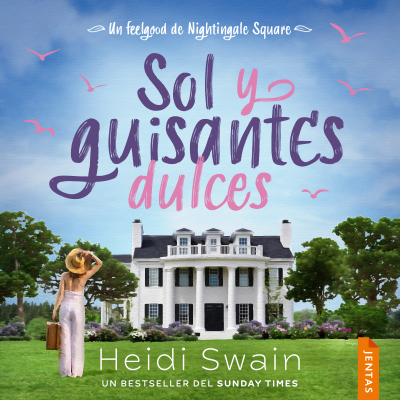NachDenkSeiten – Die kritische Website
alemán
Actualidad y política
Oferta limitada
2 meses por 1 €
Después 4,99 € / mesCancela cuando quieras.
- 20 horas de audiolibros / mes
- Podcasts solo en Podimo
- Podcast gratuitos
Acerca de NachDenkSeiten – Die kritische Website
NachDenkSeiten - Die kritische Website
Todos los episodios
4753 episodiosAfD-Verbot: Gericht lässt aus dem Geheimdienst-Gutachten (vorerst) die Luft raus
Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD vorerst nicht als „gesichert rechtsextremistisch“ einstufen und behandeln. Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass der Ausgang des Hauptsacheverfahrens abgewartet werden muss. Das Urteil ist zu begrüßen, auch wenn man der AfD inhaltlich kritisch gegenübersteht. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Die AfD darf durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) vorerst nicht als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft und behandelt werden, wie die „Tagesschau“ berichtet [https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-einstufung-entscheidung-100.html]. Das hat das Verwaltungsgericht Köln in einem Eilbeschluss entschieden. Auch die öffentliche Bekanntgabe einer solchen Einstufung müsse das Bundesamt für Verfassungsschutz vorerst unterlassen. Die Bundesbehörde muss demnach den Ausgang des Hauptsacheverfahrens abwarten. Dem Eilantrag der AfD sei im Wesentlichen stattgegeben worden, so das Gericht. Die Entscheidung kann in der nächsthöheren Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen in Münster angefochten werden. Eine Pressemitteilung des Gerichts zum Urteil (Aktenzeichen: 13 L 1109/25) findet sich unter diesem Link [https://www.vg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/05_26022026/index.php]. Nach Auffassung des Gerichts liegt zwar eine hinreichende Gewissheit dafür vor, dass innerhalb der AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen entfaltet würden. Jedoch werde sie dadurch „nicht in einer Weise geprägt, die dazu führt, dass ihrem Gesamtbild nach eine verfassungsfeindliche Grundtendenz festgestellt werden kann“. Etwa den strittigen Punkt, ob die AfD auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund benachteiligen wolle, sieht das Gericht durch das Geheimdienstgutachten keineswegs gedeckt: > „Insbesondere besteht keine hinreichende Gewissheit dahingehend, dass es den politischen Zielsetzungen der Antragstellerin (der AfD, Red.) entspricht, deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund nur einen rechtlich abgewerteten Status zuzuerkennen. Hinreichend konkrete Belege in Bezug auf entsprechende politische Zielsetzungen sind nicht ersichtlich. Im Parteiprogramm und in sonstigen Veröffentlichungen oder Äußerungen der Antragstellerin oder ihr zurechenbarer Anhänger finden sich bislang keine eindeutigen Forderungen im Sinne einer allgemeinen rechtlichen Diskriminierung deutscher Staatsangehöriger mit Migrationshintergrund, welche die Gesamtpartei prägen.“ Ein AfD-Verbot wäre radikal und kontraproduktiv Die FAZ schreibt [https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/entscheidung-zu-afd-schlag-fuer-den-verfassungsschutz-accg-200580483.html] zur „Qualität“ des Geheimdienstgutachtens: „Der Verfassungsschutz hatte in seinem Gutachten zwar viele Aussagen und Verlautbarungen, die öffentlich zugänglich waren, aufgelistet. Aber das Gericht sieht das nicht als ausreichend an, um die Partei als Ganzes als gesichert rechtsextrem einzustufen. Das ist ein herber Schlag für den Verfassungsschutz.“ Das Gericht gibt damit dem von einer selbstdefinierten „Mitte“ lange proklamierten Motto einen Dämpfer, laut dem der Zweck fast jedes Mittel heilige, solange der Zweck ein AfD-Verbot ist. Es ist gut, wenn auch mal festgestellt wird, dass auch für den „Kampf gegen Rechts“ seriöse, nachprüfbare, belastbare Kriterien zugrunde gelegt werden müssen. Durch die Art und Weise, wie das AfD-Verbotsverfahren von vielen Politikern und Journalisten bisher beworben und vorangetrieben wird, werden demokratische Prinzipien verletzt. Dazu kommt der Eindruck, dass ein weisungsgebundener Geheimdienst gegen politische Konkurrenten instrumentalisiert werden könnte. Das ganze „offizielle“ Vorgehen bezüglich eines AfD-Verbots muss dringend auf seine Seriosität überprüft werden, da kann das aktuelle Urteil für eine Denkpause sorgen. Dass der „Kampf gegen Rechts“ in seiner praktizierten unseriösen Form zusätzlich höchst kontraproduktiv ist und diese Art des Vorgehens die AfD indirekt immer stärker macht, ist ein weiterer Aspekt, aber hier nicht der entscheidende: Es geht vor allem um demokratische Grundsätze wie die Gleichbehandlung im politischen Meinungskampf, unabhängig von konkreten politischen Inhalten. Mit diesem Standpunkt macht man sich nicht die Inhalte der AfD zu eigen: Zu vielen dieser Inhalte habe ich eine große Distanz, die Partei ist meiner Meinung nach eine tendenziell militaristische und neoliberale Mogelpackung. Doch das entbindet ihre Gegner in den konkurrierenden Parteien und in den „etablierten“ Medienredaktionen selbstverständlich keineswegs davon, den radikalen und kontraproduktiven Schritt eines Parteiverbots penibel und seriös zu begründen – oder eben von dieser meiner Meinung nach abzulehnenden Forderung abzurücken. Plötzlich ist der Geheimdienst eine seriöse Quelle Zur Einstufung der gesamten AfD als „gesichert rechtsextrem“ durch das Bundesamt für Verfassungsschutz [https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/afd-einstufung-rechtsextremistisch-bfv-verfassungsschutz] im Mai letzten Jahres hatten sich damals auf den NachDenkSeiten etwa Oskar Lafontaine im Artikel „Rechtsextreme kämpfen gegen Rechtsextreme [https://www.nachdenkseiten.de/?p=132476]“ und Jens Berger im Artikel „AfD-Verbotsdebatte: Man muss die Ursachen und nicht die Symptome bekämpfen [https://www.nachdenkseiten.de/?p=132489]“ geäußert, außerdem bin ich im Artikel „‘Gutachten’ zur AfD: Plötzlich ist der Geheimdienst eine seriöse Quelle [https://www.nachdenkseiten.de/?p=132512]“ darauf eingegangen, darin heißt es etwa: > „Es ist ein befremdliches Zusammenspiel aus Geheimdienst, Medien und Politikern: Ein weisungsgebundener und in der Vergangenheit skandalgeschüttelter Geheimdienst hält ein brisantes ‚Gutachten’ unter Verschluss, entfaltet aber mit der Verkündung seiner Existenz bereits starke politische Wirkung. Gleichzeitig wurden Infos des ‚geheimen’ Papiers anscheinend an einzelne Medien weitergegeben, die sich unkritisch an einer unseriösen Kampagne beteiligen. Und Politiker, die den Geheimdienst gestern noch abschaffen wollten, erheben ihn nun zu einer seriösen Quelle.“ Brandmauer bizarr Viele politische Reaktionen auf das Urteil sind erwartungsgemäß: Die SPD-Politikerin Carmen Wegge will laut Tagesschau trotz der Gerichtsentscheidung ihre Bemühungen für ein AfD-Verbotsverfahren vorantreiben. Sie sei weiter fest davon überzeugt, dass die AfD verfassungsfeindlich und verfassungswidrig sei und vor dem Bundesverfassungsgericht geprüft werden müsse. Die Eilentscheidung sei „ein weiterer Ansporn, noch besser zu werden“, sagte sie. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) plädiert nun dafür, einzelne Landesverbände der Partei zu verbieten. „Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, dass die AfD verfassungsfeindlich und verfassungswidrig ist und deshalb die Instrumente der wehrhaften Demokratie zur Anwendung kommen sollten“, sagte er laut Medien [https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/entscheidung-zu-afd-schlag-fuer-den-verfassungsschutz-accg-200580483.html]. Der Grünen-Innenpolitiker von Notz warb laut Deutschlandfunk [https://www.deutschlandfunk.de/linke-haelt-an-verbotsverfahren-fest-gruene-fordern-bund-laender-arbeitsgruppe-100.html] für die Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, um Informationen der Behörden über die AfD zu sammeln. Auch müssten Erkenntnisse der Nachrichtendienste einfließen. Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) erklärte, man müsse sich nun auf das Hauptsacheverfahren konzentrieren. Bis dahin werde die AfD weiter als Verdachtsfall beobachtet. Außerdem sagte er zutreffend, die Partei müsse „man wegregieren und nicht wegverbieten“. Die LINKEN-Politikerin Bünger sagte der Deutschen Presse-Agentur, von der AfD gehe eine politische und gesellschaftliche Gefahr aus. Was die Errichtung der „Brandmauer“ gegen die AfD für bizarre Blüten treiben kann, das beweist gerade die LINKE in Thüringen: Die Partei hat überraschend einen eigenen Antrag erfolgreich durch den Landtag gebracht, aber es hatte auch die AfD dafür gestimmt. Thematisiert wird nun nicht der politische Erfolg des LINKEN-Antrags, sondern die Schmach, dadurch die „Brandmauer“ beschädigt zu haben. Die Verrenkungen von LINKEN-Politikern und Journalisten zu der Episode können unter diesem Link [https://x.com/tomdabassman/status/2024086806245896283] sowie unter diesem Link [https://x.com/tomdabassman/status/2026791693128004068] betrachtet werden. Überraschung in den Tagesthemen Man höre und staune: In den Tagesthemen der ARD lief am Donnerstag ein überraschend kritischer Kommentar von Iris Sayram [https://www.tagesschau.de/tagesthemen/video-1559582.html] zum Thema AfD-Verbot: > „Die Begründung der Kölner, die hat es in sich. Das Gericht hat nämlich mehr oder weniger klar gemacht, dass das tausend Seiten lange Gutachten nichts weiter ist als bedrucktes Papier mit überschaubarer Aussagekraft – und das, obwohl die AfD seit Jahren auch in einem gewissen Umfang nachrichtendienstlich behandelt werden kann.“ Titelbild: Stranger Man/shutterstock.com Mehr zum Thema: „Gutachten“ zur AfD: Plötzlich ist der Geheimdienst eine seriöse Quelle [https://www.nachdenkseiten.de/?p=132512] AfD-Verbotsdebatte: Man muss die Ursachen und nicht die Symptome bekämpfen [https://www.nachdenkseiten.de/?p=132489] AfD-Verbotsdebatte – kontraproduktiv und gefährlich [https://www.nachdenkseiten.de/?p=109603] AfD-Erfolg: Wer hätte das denn ahnen können…?! [https://www.nachdenkseiten.de/?p=100044] Rechtsextreme kämpfen gegen Rechtsextreme [https://www.nachdenkseiten.de/?p=132476] Demos gegen Rechts: Wenn eine „Haltung“ absurd wird [https://www.nachdenkseiten.de/?p=128495] [https://vg08.met.vgwort.de/na/09102ddec22a43f2861325cf88b23bb3]
Susanne Marie Schäfer als „unbelehrbare Staatsfeindin“ zum Tode verurteilt – Gedanken zur Meinungsfreiheit
Susanne Marie Schäfer [https://www.gedenkstaette-ploetzensee.de/totenbuch/recherche/person/Schaefer-susanne-Marie] hat die „Kriegsmoral untergraben“ und wird als „unbelehrbare Staatsfeindin“ zum Tode verurteilt – im „Namen des deutschen Volkes“. Das war im Januar 1945. Das Vergehen von der in Schwetzingen Geborenen: Sie hatte sich regimekritisch geäußert. Die Nazis sahen in ihr eine Hetzerin [https://x.com/NieMehrKrieg/status/2025812873881256388]. Zuerst erfolgte eine Verurteilung wegen „Heimtücke“. Schäfer hielt sich aber nicht zurück. Nach ihrer Haftentlassung stellte sie in ihrem Mietshaus gegenüber ihren Mietern Kriegserfolge der Wehrmacht infrage. Das war ihr Todesurteil. Stichwort: „Wehrkraftzersetzung“. Ihre Hinrichtung erfolgte am 23. Februar 1945. Die Geschichte lehrt uns: Auf die Meinungsfreiheit kommt es vor allem dann an, wenn sie sich gegen die vorherrschende Politik richtet. Ein Kommentar von Marcus Klöckner. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Susanne Marie Schäfer hat nichts verbrochen. Trotzdem wurde sie zum Tode verurteilt. Ihr „Verbrechen“ war, den Mund aufzumachen. Wir alle wissen: In Nazi-Deutschland war es lebensgefährlich, das „Falsche“ zu sagen. „Wehrkraftzersetzung“ – das war das rote Tuch für die Nazis. Wer es wagte, die „Erfolge“ der Wehrmacht zu hinterfragen, oder dem Krieg nicht mit „Hurra!“ begegnete, wandelte auf dünnem Eis. Es war eine furchtbare, grausame Zeit. Die Bundesrepublik, aufgebaut auf den Trümmern eines faschistischen, fanatischen Terrorregimes, hat sich aufgrund dieser Erfahrungen etwas auf die Fahnen geschrieben: „Nie mehr!“ Auch deshalb heißt es im Grundgesetz: > Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern, zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu informieren; eine Zensur findet nicht statt. Eine repräsentative Umfrage der Neuen Zürcher Zeitung [https://www.nzz.ch/visuals/mehrheit-der-deutschen-aeussert-politische-meinungen-nur-noch-mit-vorsicht-ld.1916157] brachte zum Vorschein, was seit geraumer Zeit im Land gefühlt werden kann. 57 Prozent der Befragten halten, wie die NZZ es formuliert, „Vorsicht für geboten“, wenn es darum geht, die eigene Meinung offen zu sagen. Die EU hat ein „Desinformationssanktionsregime“ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=146494] installiert. Unter anderen sind Staatsbürger aus Deutschland sanktioniert. Zusammengefasst geht es um Vorwürfe der systematischen Verbreitung von falschen Informationen und russischer Propaganda. Die Sanktionen sind drakonisch. Eingefrorene Konten und Arbeitsverbote bedeuten: Existenzbedrohung. Fragen drängen sich auf: Ist Propaganda nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt? Wenn nein, dann dürfte keine Partei mehr Wahlkampf betreiben. Und: Wer bestimmt, was „Propaganda“ ist? Wer legt fest, was „falsche Informationen“ sind? Wer will sich die Macht anmaßen, Bürger aufgrund der Verbreitung von angeblich falschen Informationen so schwer zu bestrafen, dass sie samt ihrer Familien zu Mittellosen werden? Wer sich diese Macht anmaßt, ist offen zu sehen. Begreifen alle, was hier passiert? Aufwachen! Wenn 57 Prozent der Bundesbürger die Meinungsfreiheit in Gefahr sehen, dann sollte jedem Demokraten klar werden: Am Baum der Meinungsfreiheit ist die Axt angesetzt. Nein, heute ist gewiss nicht damals. 2026 ist nicht 1945. Doch etwas Beklemmendes ist zu spüren. Da fragt der Tagesspiegel: Muss unser Gesundheitssystem kriegstüchtig sein? [https://www.tagesspiegel.de/gesundheit/wie-kriegstuchtig-ist-das-gesundheitssystem-wenn-es-knallt-ist-es-zu-spat-plane-zu-schmieden-14837966.html], da veröffentlicht die FAZ einen Kommentar unter der Überschrift: „Es gibt kein Recht auf Fahnenflucht“ [https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-krieg-es-gibt-kein-recht-auf-fahnenflucht-19400836.html] und Bürger, die sich offen für Frieden aussprechen, werden als „Lumpenpazifisten [https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/ukraine-krieg-der-deutsche-lumpen-pazifismus-kolumne-a-77ea2788-e80f-4a51-838f-591843da8356]“ bezeichnet. Im Mai des vergangenen Jahres war in der taz zu lesen [https://taz.de/Aufruestung/!6085519/]: „Der Vorwurf des ‚Lumpenpazifismus‘ (…), klingt dabei wie ein Echo der alten Anschuldigung von der ‚Wehrkraftzersetzung‘.“ Etwas Grundlegendes gerät aus den Fugen. Etwas Elementares stimmt nicht mehr. Das Schicksal von Susanne Maria Schäfer berührt. Ihr Schicksal war das Ergebnis einer verheerenden Entwicklung. Ihr Schicksal beruhte auch auf einer Gesellschaft, die mitgemacht oder weggesehen hat. Vergessen wir das nicht! Titelbild: Dokumentausschnitt gedenkstaette-ploetzensee.de
Verlieren die USA den Toiletten-Krieg?
Vielleicht wird Donald Trump ja im nächsten Jahr den Friedensnobelpreis bekommen, weil er – für Amerikaner vollkommen unüblich – den selbst angezettelten Streit mit dem Iran am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld geführt hat. Doch aufmerksame Zeitgenossen wissen es besser. Nicht Trumps Bedenken, sondern die verstopften Toiletten [https://www.wsj.com/us-news/missed-funerals-and-blocked-toilets-iran-deployment-takes-a-toll-on-u-s-sailors-7e230962] auf dem amerikanischen Super-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford sind womöglich dafür verantwortlich, dass der Nahe und Mittlere Osten noch nicht in Flammen stehen. Eine Glosse von Jens Berger. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Sie ist der Stolz der US Navy, das mit Abstand teuerste und modernste Kriegsschiff, das jemals gebaut wurde. 2013 lief die USS Gerald R. Ford vom Stapel. Ein Flugzeugträger der modernsten Generation. 4.600 Seeleute tun ihren Dienst auf dem Schiff, das den amerikanischen Steuerzahler stolze 18 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Zum Vergleich – das ist mehr als ein Drittel der deutschen Vor-Zeitenwende-Verteidigungsausgaben und mehr als doppelt so viel, wie der „Schurkenstaat“ Iran pro Jahr für sein gesamtes Militär ausgibt. Die Kosten für die mehr als 75 Kampfflugzeuge, die auf der Ford stationiert sind und weltweit amerikanische Interessen vorwärtsverteidigen, sind da noch nicht einmal inbegriffen. Superlative wo man hinschaut. Doch die Ford hat bei allem teuren High-Tech-Klimbim offenbar eine Achillesferse. 4.600 Seeleute müssen schließlich auch rund 10.000-mal am Tag auf die Toilette und an diesem neuralgischen Punkt haben die Planer im Pentagon offenbar ins Klo gegriffen. 10.000 Klospülungen pro Tag – das ist eine Menge Wasser und das muss an Bord eines Schiffes nun mal kostspielig entsalzt werden, bevor man es durch die Abwasserrohre jagt. Dies stachelte den amerikanischen Erfindergeist an. Der Mythos sagt, dass die NASA, als sie herausfand, dass normale Kugelschreiber in der Schwerelosigkeit nicht funktionieren, Millionen in die Forschung steckte und am Ende der „Space Pen“ herauskam. Die Russen nutzten einen Bleistift. Heute haben die Russen vielleicht ja Plumpsklos auf ihren Kriegsschiffen, während auf der USS Ford ein hochkomplexes Vakuumspülsystem seinen Dienst tut, das das Herz jedes Klempners mit seinen extrem dünnen Rohrdurchmessern höherschlagen lässt. Dumm nur, dass dieses Abwassersystem nie wirklich funktioniert hat. Der öffentlich-rechtliche Sender NPR ist der Klo-Gate-Frage investigativ nachgegangen [https://www.npr.org/2026/01/15/nx-s1-5676229/the-uss-ford-crew-is-struggling-with-sewage-problems-on-board-the-navys-new-carrier] und fand in alten E-Mails, die man anhand des Freedom of Information Acts herausgeklagt hat, nun heraus, dass das Toilettensystem der Ford schon in der Planungsphase ein einziges Desaster war. Kaum lief das Schiff vom Stapel, kam es zu Ausfällen. Vereinfacht gesagt ist das ganze System so komplex, dass bei der Verstopfung einer einzigen Toilette systembedingt gleich die ganze Etage der in Reihe geschalteten Toiletten außer Betrieb geht und dies eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang setzt. Seeleute, die mal aufs Klo müssen, weichen auf andere Toiletten aus, die sind aber nicht auf diese „Überbelastung“ ausgelegt und fallen ebenfalls aus und setzen dann systembedingt alle Toiletten einer weiteren Etage außer Betrieb. Ein wenig unfein müsste man sagen: „Was für eine Scheißkonstruktion.“ Das Toilettenproblem der Ford ist ernst. Tag und Nacht sind internen Berichten zufolge große Teile des technischen Personals damit beschäftigt, defekte Toiletten wieder in Gang zu setzen. Vor den wenigen noch funktionierenden Toiletten kommt es dann zu Warteschlangen. Rund 45 Minuten müssen die Seeleute diesen Berichten zu Folge anstehen, um ihre Notdurft zu verrichten. Und das ist natürlich sicherheitsrelevant. Man stelle sich nur vor, die Iraner feuern eine Rakete auf die Ford ab und die gesamte Raketenabwehrmannschaft steht gerade Schlange vor dem Klo. Erst vor kurzem kam es laut der ausgewerteten Mails teils binnen vier Tagen zu stolzen 205 Zusammenbrüchen des gesamten Toilettensystems der Ford. Seit die Ford im Juni 2025 zu ihrer derzeitigen Mission in See stach, musste bereits zwölf Mal externe Hilfe wegen der Toilettenfrage gesucht werden. Und wenn das System mal so richtig verstopft ist, ist Abhilfe alles andere als profan. Dann muss das Schiff einen Hafen anlaufen und dort wird dann das gesamte Abwassersystem mit Säure gespült. Kostenpunkt: 400.000 US-Dollar. Hinzu kommt, dass die Ford für diese Zeit die USA nicht vorwärtsverteidigen kann. Was für ein Scheiß. Doch kommen wir nun, nachdem wir das nötige Hintergrundwissen über die prekäre Klospülung der Ford haben, zur aktuellen Lage. Die Ford ist nicht nur der ganze Stolz der US Navy, sondern im Rotationssystem der US-Flugzeugträgergruppen derzeit auch der zentrale Akteur in der Machtprojektion der US-Außenpolitik. Wann immer die USA weltweit das Völkerrecht mit Füßen treten, ist die Ford der zentrale Knotenpunkt für das kriegerische Handwerk. Eigentlich sollte die Ford ja bereits im Dezember ihren Dienst im östlichen Mittelmeer antreten, doch dann kam Trumps Idee dazwischen, Venezuela militärisch zu unterwerfen. Also fuhr man – pausenlos die Toiletten reparierend [https://www.npr.org/2026/01/17/nx-s1-5680167/major-plumbing-headache-haunts-13-billion-u-s-carrier-off-the-coast-of-venezuela] – erst einmal in die Karibik. Zum großen Clash kam es bekanntlich nicht. Also zurück ins Mittelmeer – mit kaputten Toiletten. Die Moral an Bord ist den NPR-Recherchen zufolge wortwörtlich „beschissen“. Während die Ford – pausenlos die Toiletten reparierend – sich in den letzten Wochen ihrem Zielgebiet, dem östlichen Mittelmeer, näherte, baute ihr oberster Befehlshaber seine maximale Drohkulisse gegen den Iran auf. Die Welt wartete eigentlich nur darauf, dass die USA mal wieder einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg starten und den Nahen und Mittleren Osten in Flammen aufgehen lassen. Das geschah – zum Glück – bislang noch nicht. Ob dafür die Verhandlungen in der Schweiz oder ganz profan die Toiletten der Ford verantwortlich sind, ist unbekannt. Bekannt ist jedoch, dass die Ford derzeit nicht kriegstüchtig ist, sondern in der NATO-Flottenbasis Souda Bay auf Kreta im Hafen liegt [https://www.globaltimes.cn/page/202602/1355709.shtml], um dort mal wieder ihr defektes Abwassersystem mit Säure freizuspülen. Da lachen nicht nur die Mullahs. Ungeprüfte Meldungen auf Social Media legen pikanterweise sogar den Verdacht nahe, dass die von der Klosituation genervten Seeleute nicht ganz unschuldig an der Zwangspause auf Kreta sind. Offenbar fand man in den hochempfindlichen Rohren, die bereits durch herkömmliches Toilettenpapier verstopfen, auch T-Shirts und andere persönliche Hinterlassenschaften der Matrosen. Ein Schelm, der Arges dabei denkt. Nun können die Schurken weltweit erst einmal aufatmen. Denn eine echte Lösung des Toilettenproblems der Ford ist so schnell nicht in Sicht. Das System als solches ist den Recherchen von NPR zufolge schlichtweg „Scheiße“ und müsste in einem langen Werftaufenthalt grundsätzlich erneuert werden. Das wird wieder einige Milliarden kosten und den Stolz der US Navy über Monate, wenn nicht gar Jahre außer Betrieb setzen. Hätten die Amis doch Plumpsklos verwendet. Titelbild: Aerial-motion/shutterstock.com[http://vg04.met.vgwort.de/na/f01261554a1844b2909e68d63d0642ef]
EU-Europa – interne Spannungen und Konflikte
In EU-Europa rumort es gewaltig. Die Spannungen zwischen dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán auf der einen und der von Ursula von der Leyen geführten EU-Kommission andererseits sind nicht neu. Schon seit Jahren pfeifen es die Spatzen vom Dach. Unterstützt wird Orbán bisweilen von dem slowakischen Ministerpräsidenten Fico und neuerdings auch von dem tschechischen Ministerpräsidenten Babiš. Von Alexander Neu. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Der Konflikt zwischen Brüssel und Budapest, aber auch Bratislava geht weit über die Ukrainefrage hinaus – wird aber an der Frage, wie mit der Ukraine und Russland zu verfahren sei, besonders sichtbar. Konflikt der Leitbilder – welche EU soll es sein? Tiefliegender Hintergrund ist die Frage über das Leitbild der EU-Integration. Diese Frage beschäftigt die EU sowie ihre Mitgliedsstaaten schon seit Dekaden. Mit dem Lissabonner Vertrag wurden die Eckpfeiler für mehr supranationale Elemente eingeschlagen. Eine rein supranationale EU existiert dennoch nicht. Insbesondere in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) dominiert der intergouvernementale Ansatz – also die Kooperation souveräner Staaten, die das Zepter der Außen- und Sicherheitspolitik nicht gänzlich an EU-Brüssel und somit an von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, und Kallas, die EU-Außen-Beauftragte delegieren wollen. Selbst das Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen im Bereich der GASP/GSVP wollen manche Staaten nicht zur Disposition stellen und damit die Handlungsfähigkeit der EU in der Weltpolitik nicht erhöhen. Warum? Während die EU-Kommission, das EU-Parlament überwiegend und auch westeuropäische Staaten den Integrationsprozess bis hin zu einer EU mit eigenstaatlichen Merkmalen vertiefen wollen, sind die osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten eher souveränitätsorientiert – präferieren ein „Europa der Vaterländer“ in Anlehnung an den damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulles. Das Konzept des „Europas der Vaterländer“ soll heißen: EU ja, aber ohne eigenständigen Staatscharakter, der die nationale Staatlichkeit in einem gewissen Ausmaß auflöst. Insbesondere in Ungarn und der Slowakei, aber auch in Polen, Tschechien und Bulgarien gibt es Vorbehalte, die Eigenstaatlichkeit zu Gunsten Brüssels zu opfern. Selbst in Rumänien rumort es. Der Konflikt manifestiert sich nicht nur an der Frage zur Ukraine und Russland. Schon bereits in den 2010er-Jahren wurde eine kulturelle Spaltung innerhalb der EU mehr als deutlich: Während die westeuropäischen Mitgliedsstaaten, Deutschland allen voran, die Flüchtlings- und Migrationsfrage sehr liberal handhabten – mit den entsprechenden Folgen in der Gegenwart –, lehnten und lehnen die osteuropäischen Mitgliedsstaaten die Aufnahme von Flüchtlingen ab. Die Bilder der Flüchtlinge auf dem Budapester Bahnhof 2015 einerseits und die Willkommenskultur („Refugees Welcome“) in Deutschland stehen bildlich für den Antagonismus zwischen Berlin und Brüssel einerseits und Budapest sowie weiteren Hauptstädten des Ostens andererseits. Während in Westeuropa Multikulti, Souveränitätsrelativismus und sexuelle Vielfalt zum neuen Glaubenssatz erhoben wurden, bestanden und bestehen die osteuropäischen Mitgliedsstaaten auf kultureller Identität und der Wahrung der staatlichen Souveränität nach innen und außen, was auch die innere Sicherheit einschließt. Selbst das ansonsten sehr stark westlich orientierte Polen befindet sich in diesen Fragen eher auf der Seite seiner osteuropäischen Nachbarstaaten. Insgesamt jedoch erreichte der Antagonismus zwischen West- und Ost-EU-Europa nie den Level, dass die EU selbst in eine Krise geriet. Ukraine und Russland – der Sprengstoff für die EU-Kohäsion Mit der Invasion Russlands in die Ukraine vor genau vier Jahren veränderte sich die Konfliktqualität zwischen EU-Brüssel, Berlin und Paris einerseits sowie einigen osteuropäischen Mitgliedsstaaten – insbesondere Ungarn und der Slowakei – andererseits. Die von der EU verhängten Sanktionen – sogenannte Sanktionspakete –, die auch mit wesentlichen Nachteilen für die EU und deren Mitgliedsstaaten verbunden sind, stoßen zunehmend auf Ablehnung, insbesondere bei Ungarn und der Slowakei. Beide Staaten leisteten und leisten nur die von EU-Brüssel geforderte absolut notwendige Solidarität mit der Ukraine. Die Regierungschefs beider Staaten, Orbán und Fico, pflegen bilaterale Kontakte mit Moskau, was in den westlichen EU-Hauptstädten sowie in Brüssel nicht nur ungern gesehen, sondern zutiefst verurteilt wird. Selbst als Orbán als EU-Ratspräsident 2024 nach Kiew, Moskau, Peking und Washington reiste, um eine Friedensinitiative anzustoßen, erfuhr er aus EU-Brüssel massive Kritik. Bei Verhandlungen zu neuen Sanktionspaketen ist es zuvörderst Orbán, der Konzessionen und Abschwächungen einfordert, womit er den Zorn der EU-Bürokratie, des EU-Parlaments und der EU-Kommission auf sich zieht, die ihrerseits eine umfassende und bedingungslose Sanktionspolitik gegen die Russische Föderation fordern. Tatsächlich verstecken sich jedoch auch nicht wenige EU-Mitgliedsstaaten hinter Ungarn und der Slowakei, die die Sanktionsmaßnahmen hinter vorgehaltener Hand so auch nicht unterstützen, jedoch einen offenen Konflikt vermeiden wollen. Bei der Diskussion, die eingefrorenen russischen Zentralbankgelder als Reparationsdarlehen an die Ukraine zu verschieben, kam es Mitte Dezember schließlich zum Eklat. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und die deutsche EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen versuchten, die EU-Partner und auch Belgien von dem Plan zu überzeugen. Der Widerstand dagegen kam nicht nur aus Budapest und Bratislava, sondern auch aus der belgischen Hauptstadt Brüssel, aus Rom und Paris, da die Umsetzung des Plans mit vielen Unwägbarkeiten rechtlicher und finanzieller Art verbunden war. Nur Merz und von der Leyen wollten diese Gefahren nicht sehen, erlitten dann aber mit ihrem Konzept schließlich Schiffbruch. Letztlich wurde eine Kompromisslösung gefunden: Die EU nimmt einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro auf und leitet das Geld an die Ukraine. Die Ukraine wiederum soll diesen Kredit nur zurückzahlen müssen, wenn Russland Reparationen an die Ukraine zahle. Im Falle eines Rückzahlungsausfalls seitens der Ukraine würden man dann auf das eingefrorene russische Zentralbankgeld zurückgreifen, um den Kredit zu bedienen. Damit sind die rechtlichen und finanziellen Unwägbarkeiten zwar nicht vom Tisch, aber zeitlich nach hinten verschoben. Ob es dann am Tag X einen erneuten Widerstand einiger EU-Staaten geben sollte, bleibt abzuwarten. Ungarn, die Slowakei sowie Tschechien lehnen eine Beteiligung an der Kreditierung mit unvorhersehbaren Konsequenzen ab. Nun aber blockiert Ungarn die Freigabe der Gelder, was den Zorn von der Leyens nochmals erhöht. Ihre Rede in Kiew [https://youtu.be/lCGCL7MOTYc?si=_pCo3vpRHrpUSOom] am Jahrestag der russischen Invasion spricht Bände über die reale Situation in der EU: > „Der Kredit wurde von 27 Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat vereinbart. Sie haben ihr Wort gegeben. Dieses Wort kann nicht gebrochen werden. Also werden wir den Kredit auf die eine oder andere Weise bereitstellen. Lassen Sie mich ganz klar sagen: Wir haben verschiedene Optionen, und wir werden sie nutzen.“ Welche Optionen die Kommissionspräsidentin in der Tasche hat, hat sie nicht erläutert. Ungarn und die Slowakei begründen ihre Blockade mit der Einstellung der russischen Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline seitens der Ukraine, womit diese beiden Staaten kein Öl mehr aus Russland erhielten. Die Druschba-Pipeline sei, so die ukrainische Begründung, durch einen russischen Angriff zerstört worden. Andere behaupten, die Ukraine selbst habe die Pipeline zerstört. Die ungarische Seite erklärt hingegen, die Druschba-Pipeline sei technisch intakt. Es sei der politische Unwille der Ukrainer, die Durchleitung nach Ungarn und in die Slowakei zu ermöglichen [https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2026225926778843304]. Zudem erklärt der ungarische Außenminister Szijjártó, die EU mache gemeinsame Sache mit der Ukraine gegen die beiden abtrünnigen EU-Mitgliedsstaaten, hier beispielsweise mit der Unterbrechung des Erdölpipeline [https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2026715235315528020]. Aus diesen Gründen blockierten Ungarn und die Slowakei nicht nur die Kreditfreigabe an die Ukraine, sondern nun auch das 20. EU-Sanktionspaket gegen Russland. Der Kredit sowie das Sanktionspaket sollten, so das ursprüngliche Ziel, möglichst am vierten Jahrestag der Invasion in Kraft treten, um auch symbolisch die Entschlossenheit der EU, an der Seite der Ukraine zu stehen, zu unterstreichen. Aus der Symbolik wurde nun nichts. EU und Ukraine gegen EU-Mitgliedsstaaten? Sollten die Vorwürfe aus Ungarn und der Slowakei zutreffen, so ergäbe sich hieraus eine interessante Konstellation mit weitreichenden Folgen für das Selbstverständnis der EU: Wenn die EU-Kommission, der Europäische Rat und der Ministerrat mehrheitlich gemeinsam mit der Ukraine, also einem Nicht-Mitglied der EU, gegen EU-Mitgliedsstaaten agieren, ja geradezu Druck auf diese Mitgliedsstaaten ausüben, dann nimmt das Projekt EU-Europa massiv schaden: Ein Nicht-Mitglied der EU hätte auf die Entscheidungen in der EU mehr Einfluss als ein Mitgliedsstaat. Importverbote und das Aushebeln des Einstimmigkeitsprinzips Das endgültige Verbot von Erdgasimporten aus Russland in die EU ab September 2027, welches im Dezember 2025 beschlossen wurde, soll nun durch einen weiteren Beschluss auch den pipeline-basierten Erdölimport verbieten. Dieser Beschluss soll allerdings erst nach den Wahlen in Ungarn (12. April) ab dem 15. April gefasst werden [https://www.reuters.com/business/energy/eu-propose-permanent-ban-russian-oil-after-hungary-election-document-shows-2026-02-24/], um zu verhindern, dass Orbán dieses Vorhaben zum Wahlkampfthema machen könne, so die interne Meinung. Das Importverbot für Erdöl soll mit dem qualifizierten Mehrheitsprinzip beschlossen werden, sodass Ungarn und die Slowakei kein Veto einlegen können. Es wäre ein raffinierter Präzedenzfall gegen das bisherige Einstimmigkeitsprinzip der Konsensfindung, wie es im Lissabonner Vertrag fixiert ist. Die EU soll mit einer Stimme sprechen. Das heißt, dass so lange verhandelt werden muss, bis ein Konsens erreicht ist und nicht die Position einiger Mitgliedsstaaten oder der EU-Kommission mit Mehrheiten durchgedrückt werden. Daher auch das Einstimmigkeitsprinzip bei relevanten Entscheidungsgegenständen im Bereich der GASP/GSVP. Der oben genannte Präzedenzfall dient hingegen den Interessen einiger EU-Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission, das Einstimmigkeitsprinzip zu Gunsten eines Mehrheitsprinzips zu kippen. Derzeit klagen Ungarn und die Slowakei gegen das praktizierte Abstimmungsverfahren der qualifizierten Mehrheit bei dem Erdgasimportverbot vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Ihrer Auffassung nach hätte die Entscheidung nach dem Modus des Einstimmigkeitsprinzips und nicht der qualifizierten Mehrheit stattfinden müssen – denn die Energieversorgungsfrage, so die Argumentation, sei eine grundlegende Souveränitäts- und Subsidiaritätsfrage. Sie dürfe nicht durch die EU gegen den Willen einzelner Mitgliedsstaaten und gegen deren unmittelbare Versorgungsinteressen entschieden werden. Wenn der EuGH nicht im Sinne des Souveränitäts- und Subsidiaritätsprinzips entscheiden sollte, so wäre damit ein weiterer Schritt in Richtung qualifizierter Mehrheitsentscheidung in der EU zu Gunsten der EU-Kommission und der großen EU-Staaten Westeuropas gemacht. Es wäre eine Entscheidung durch die Hintertür, ohne dass das Lissabonner Vertrag hierzu geändert werden müsste. Es wäre aber auch ein Pyrrhussieg, da dies die Desintegration der EU mitinitiieren könnte. Denn ob die EU – einmal von diesem Fall abgesehen – angesichts des Weltneuordnungsprozess im Ganzen und mit Blick auf die doch eher wahrscheinliche Niederlage der Ukraine im Besonderen ohne substanziellen Schaden hervorgehen wird, bleibt abzuwarten. Wenn sich dann auch noch zusätzlich im EU-Binnenverhältnis enorme Spannungen über die strukturelle Ausbildung der EU – Stichwort Leitbild – breitmachen, dann stehen die Vorzeichen auf Sturm. > Open Letter to President Volodymyr Zelenskyy > > Mr. President, > > For four years, you have been unable to accept the position of the sovereign Hungarian government and the Hungarian people regarding the Russia–Ukraine war. > > For four years, you have been working to force Hungary into… > > — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 26, 2026 [https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/2026900151940399521?ref_src=twsrc%5Etfw] Wahlen in Budapest Die am 12. April anstehenden Parlamentswahlen in Ungarn werden zwischenzeitlich sogar als Schicksalswahlen für Ungarn und die EU betrachtet. Orbán betrachtet die Wahl als entscheidend für Krieg und Frieden [https://www.reuters.com/business/media-telecom/orban-scales-up-war-or-peace-campaign-hungary-heads-pivotal-vote-2026-02-13/] für Ungarn und die EU. Dementsprechend ist sein Wahlkampf ausgelegt. Die EU sowie einzelne Regierungschefs einiger EU-Mitgliedssaaten ihrerseits betrachten die Wahlen als Möglichkeit, Orbán loszuwerden, Ungarn und letztlich auch die Slowakei und Tschechien wieder auf Kurs bringen zu können. So deutete Friedrich Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 in einem Nebensatz an, er sehe eine Chance für einen Machtwechsel in Ungarn angesichts der Parlamentswahlen im April dieses Jahres, womit – unausgesprochen – der unbequeme Orbán weg und dann die EU wieder handlungsfähig sei. Somit wären zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Erstens wäre das Binnenverhältnis in der EU wieder zu Gunsten derer beruhigt, die den Zentralisierungsprozess der EU (weiterer Stärkung der EU-Kommission) sowie den Machtausbau der großen EU-Staaten (enge Kooperation zwischen EU-Kommission und Berlin sowie Paris) befürworten. Und zweitens wäre die EU mit Blick auf die Ukraine, aber auch weltpolitisch im Ringen um einen Platz am Tisch der Großmächte stärker positioniert, so der Glaube. Titelbild: Andrzej Rostek/shutterstock.com
Vier Jahre Ukraine-Krieg und die Isolation von Jacques Baud
Eskalation nach außen – Repression nach innen. Zum vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges wurde überdeutlich: Sowohl die Ukraine als auch die europäischen NATO-Verbündeten wollen keinen Frieden in der Ukraine. Von Sevim Dagdelen. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Lautstark werden in Brüssel, Berlin, London und Paris Forderungen nach noch mehr Waffen und Finanzhilfe für die Ukraine erhoben. Russland warnt vor einer atomaren Bewaffnung Kiews durch Frankreich und Großbritannien sowie vor geplanten Angriffen auf die Pipeline Turkish Stream. Nimmt man die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft über die Verwicklung staatlicher Stellen der Ukraine in die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipeline ernst, erscheinen solche Warnungen nicht abwegig. Klar ist, dass die europäischen Eliten – mit Ausnahme Ungarns und der Slowakei – planen, den Krieg in der Ukraine weiter eskalieren zu lassen. Zu dieser Eskalationsstrategie gehört offenbar auch das Vorgehen gegen Kritiker im Inneren. Prominent ins Visier der EU geraten ist der Schweizer Publizist Jacques Baud. Mit Sanktionen zielen die EU-Mitgliedstaaten darauf ab, Baud mundtot zu machen, denn insbesondere seine Analyse der Vorgeschichte des Ukraine-Krieges wirft ein ganz anderes Licht auf die Kriegsgründe, als es der offiziellen Version der europäischen NATO-Staaten entspricht. Jede weitere Maßnahme gegen den Publizisten darf daher als Teil einer Mobilmachung gewertet werden. Wie weit der Arm der EU-Bürokraten reicht, wurde deutlich, als vor wenigen Tagen auch die schweizerische Bank UBS dem ehemaligen Geheimdienstoffizier das Konto und Karten sperrte. Baud, der in Brüssel lebt, hat damit eine weitere Möglichkeit verloren, sich finanziell überhaupt über Wasser zu halten. Historische Parallelen: Isolation als Herrschaftsinstrument Um zu begreifen, was hier von Seiten der EU geschieht, muss man weit in die Geschichte zurückgehen; die alleinige Charakterisierung der EU-Maßnahmen als autoritär scheint nicht ausreichend. Denn zu sehr erinnern die Maßnahmen, die auf die Isolation Bauds zielen – der sich im Übrigen keines Verbrechens schuldig gemacht hat –, an das System der Verbannung und die Politik der Isolation gegenüber Oppositionellen von 1922–1943 im italienischen Faschismus. Trotz aller Unterschiede. Auch das Confino des italienischen Faschismus war eine bürokratische Maßnahme, die nicht auf die Bestrafung konkreter Vergehen, sondern auf Prävention und Generalprävention abzielte. Sicherlich wurde Baud nicht wie die italienischen Verbannten auf eine abgelegene Insel gebracht. Doch der Entzug finanzieller Mittel sowie die auferlegte Armut als unausgesprochene Strafe lassen durchaus Vergleiche zu. Das Confino auf abgelegenen Inseln – auf denen es keine Bankfilialen gab – diente dazu, die Verbannten wirtschaftlich zu ruinieren und sozial zu isolieren. Fünf Thesen gegen den offiziellen Kriegsmythos Anlässlich des vierten Jahrestages des Ukraine-Krieges gilt es auch inhaltlich zu fragen, warum Baud in den Fokus der Generalprävention der EU und ihrer Mitgliedstaaten gerät. Offenbar wurde er für die Sanktionsbürokratie zu einer gefährlichen Person. Was aber macht seine Gefährlichkeit aus, dass nun alles darangesetzt wird, ihn zwar nicht auf eine einsame Insel, wohl aber mitten in Brüssel zu isolieren und ihm durch den Entzug wesentlicher Lebensgrundlagen die Existenz zu erschweren? Im Grunde zielen die EU-Maßnahmen auf einen Widerruf – und, falls dieser nicht erfolgt, auf die Zerstörung der Person. Entgegen den Einlassungen des Auswärtigen Amts wird Baud im Sanktionsbeschluss nicht vorgeworfen, in russischen Medien aufzutreten – was er (seit dem Beginn des Ukrainekriegs 2022) nachweislich auch nicht tut. Es muss also um etwas anderes gehen. Alles deutet darauf hin, dass es die Inhalte sind, die Baud zu einer gefährlichen Person machen. In fünf zentralen Punkten widerspricht Baud dem Kriegsmythos von NATO und EU: 1. Baud weist darauf hin, dass der Krieg durch die NATO-Osterweiterung und gebrochene Versprechen des Westens provoziert worden sei und dass russische Sicherheitsinteressen – etwa hinsichtlich einer möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine – ignoriert wurden. Der Konflikt sei eine Reaktion auf eine jahrelange Bedrohung Russlands und kein unprovozierter Aggressionsakt Putins. 2. Baud analysiert, dass die Ukraine den Konflikt im Donbass aktiv eskaliert und eine Offensive geplant habe. Er verweist sowohl auf Angriffe auf Zivilisten im Donbass als auch auf die Vorbereitung einer Offensive mit westlicher Unterstützung. Zudem bezieht er sich auf Aussagen des ehemaligen ukrainischen Präsidentenberaters Oleksiy Arestowytsch, der 2019 einen Krieg als möglichen Preis für einen NATO-Beitritt der Ukraine benannte. 3. Besonders unangenehm für den Westen ist Bauds Feststellung, dass das westliche Ziel nicht der Schutz der Ukraine, sondern ein langfristiger Kampf gegen Russland sei. Europa opfere die Ukraine geopolitischen Interessen, während die USA den Konflikt nutzten, um Europa enger an sich zu binden und ihre Rüstungsindustrie über von Europäern finanzierte ukrainische Bestellungen zu stärken. 4. Militärisch sei Russland überlegen. Der Westen missverstehe bewusst den russischen Ansatz, der auf die Zerstörung ukrainischer Kräfte und nicht primär auf territoriale Eroberungen abziele. Aufgrund dieser Fehleinschätzung seien ukrainische Gegenoffensiven zum Scheitern verurteilt. Der Krieg sei für die Ukraine verlustreich und nicht gewinnbar. 5. Baud plädiert seit Langem für Verhandlungen, wie sie derzeit in Genf zwischen der Ukraine, Russland und den USA stattfinden. Seine Überzeugung ist, dass der Krieg nur durch Diplomatie und Neutralitätsgarantien beendet werden könne, nicht durch einen militärischen Sieg. Er kritisiert die Eskalationsstrategie des Westens und betont, dass eine Lösung Kompromisse erfordere, da sonst ein langer, verlustreicher Stellungskrieg drohe. Diese Analysen sind es, die Baud für die europäischen Eliten zu einer gefährlichen Person machen. Die EU will ihn ohne Gerichtsverfahren bestrafen – nicht nur, um ihn selbst mundtot zu machen, sondern um andere abzuschrecken. Wer ähnliche Analysen veröffentlicht, soll wissen, dass auch sein bürgerliches Leben zerstört werden kann. Diesen Rückgriff auf generalpräventive Maßnahmen, die Anleihen im italienischen Faschismus nehmen, kann man nur als Vorbereitung auf einen großen Krieg verstehen. Solidarität mit Jacques Baud ist daher nicht nur ein Einsatz für die Freiheit, sondern auch ein notwendiger Widerstand gegen die Kriegsmobilisierung der europäischen NATO-Eliten, die Europa allem Anschein nach in einen Krieg mit Russland treiben wollen.
Elige tu suscripción
Oferta limitada
Premium
20 horas de audiolibros
Podcasts solo en Podimo
Podcast gratuitos
Cancela cuando quieras
2 meses por 1 €
Después 4,99 € / mes
Premium Plus
100 horas de audiolibros
Podcasts solo en Podimo
Podcast gratuitos
Cancela cuando quieras
Disfruta 30 días gratis
Después 9,99 € / mes
2 meses por 1 €. Después 4,99 € / mes. Cancela cuando quieras.