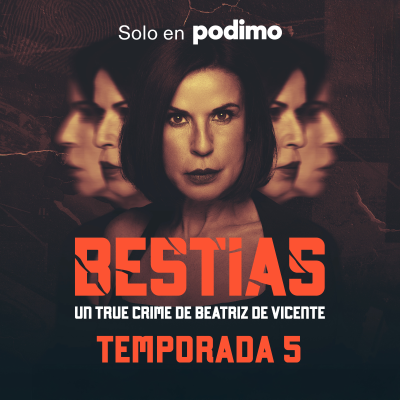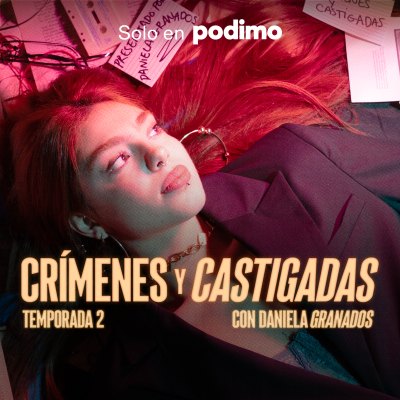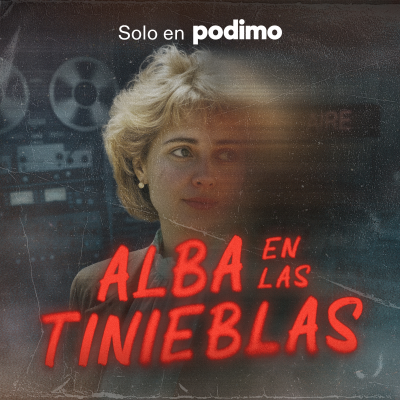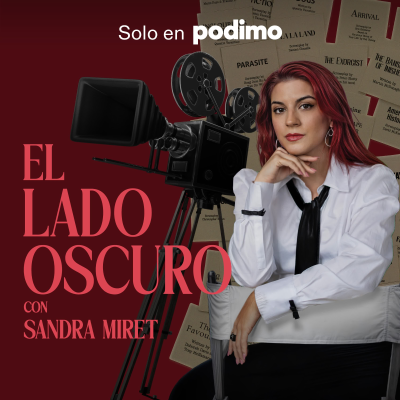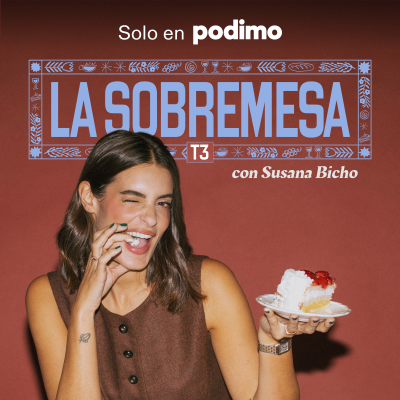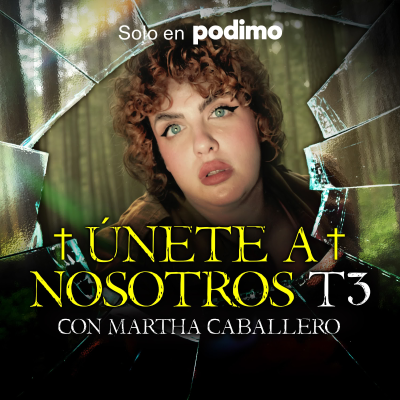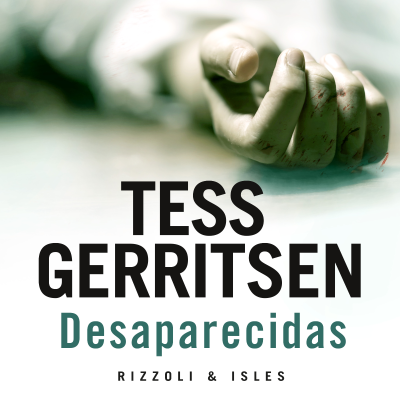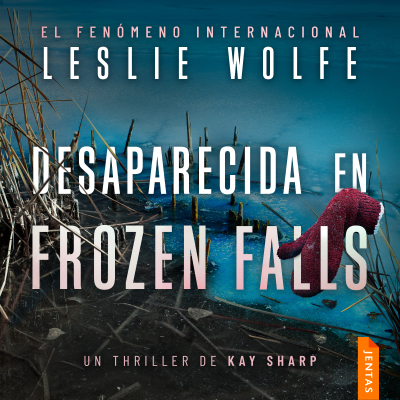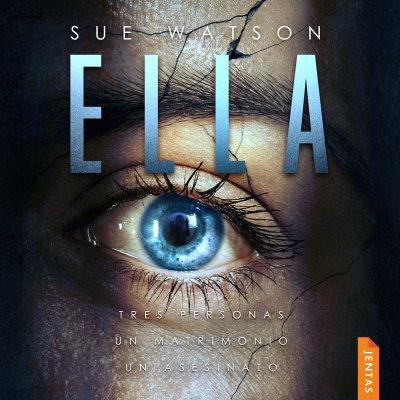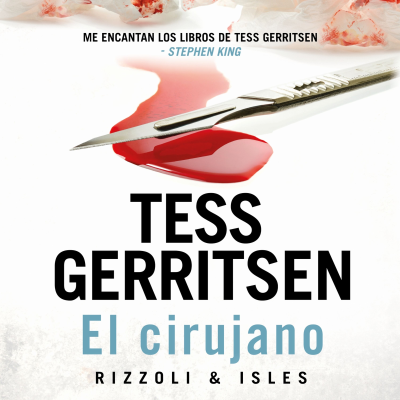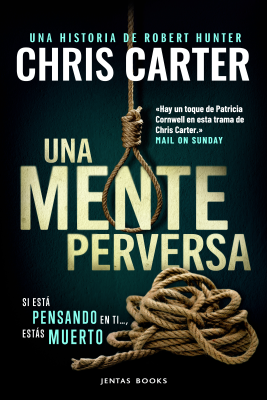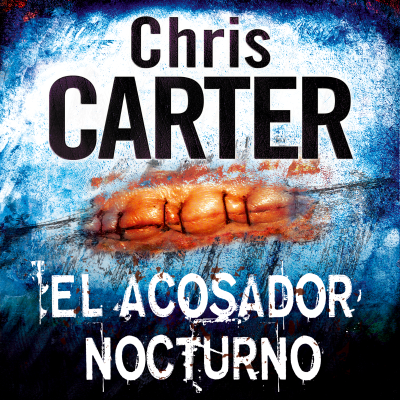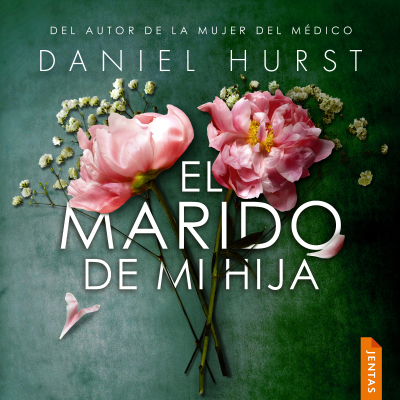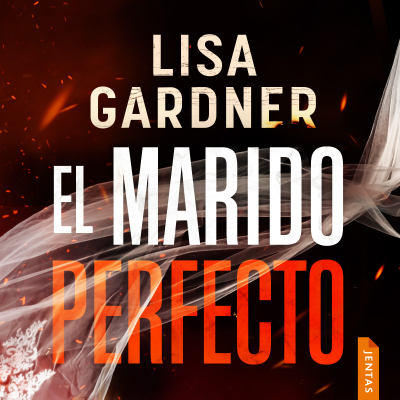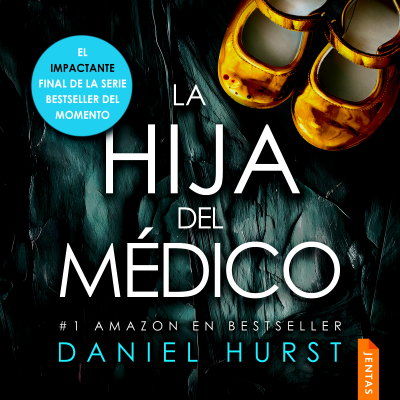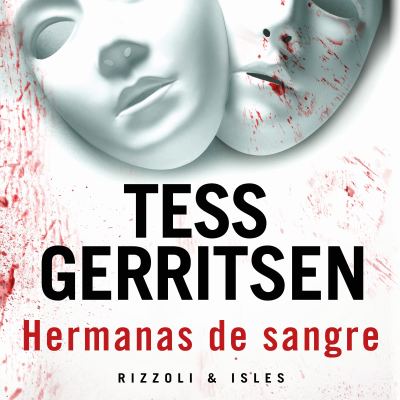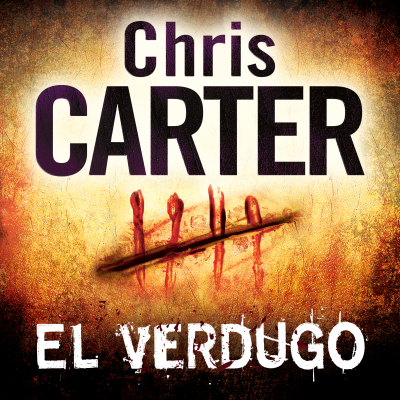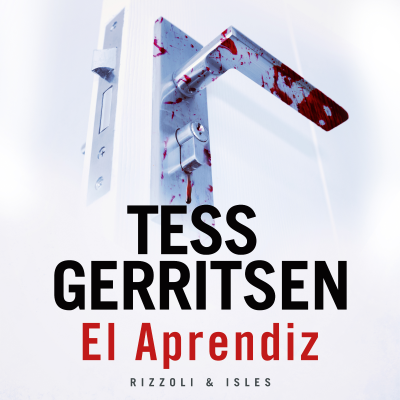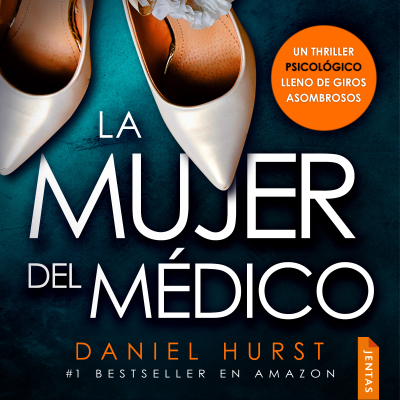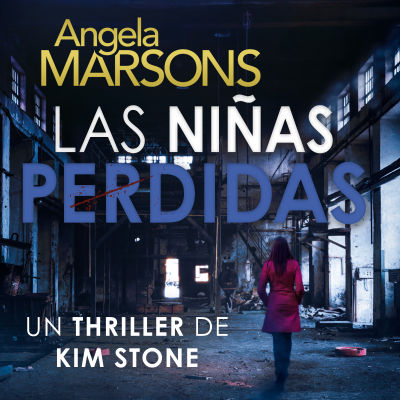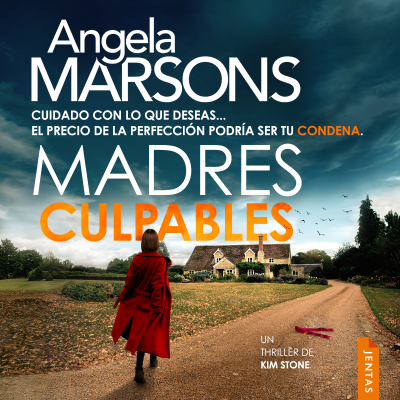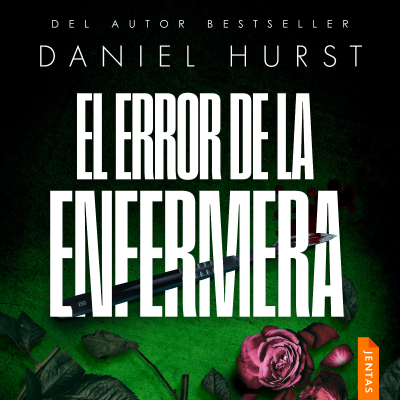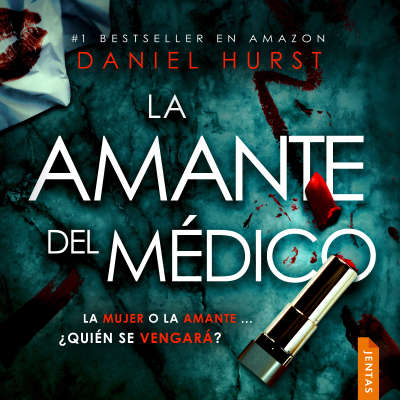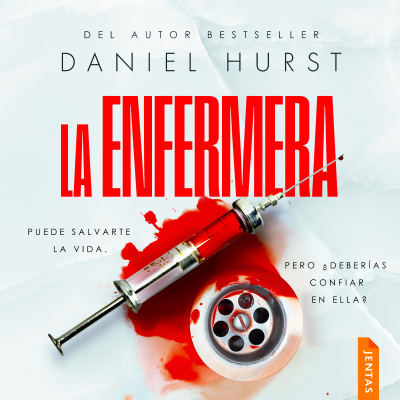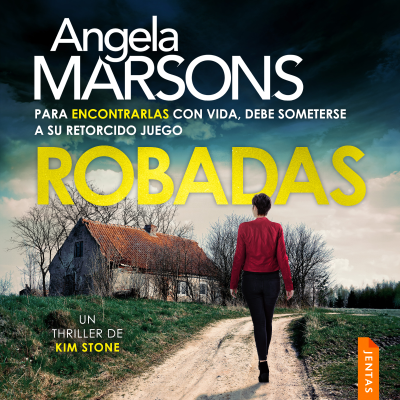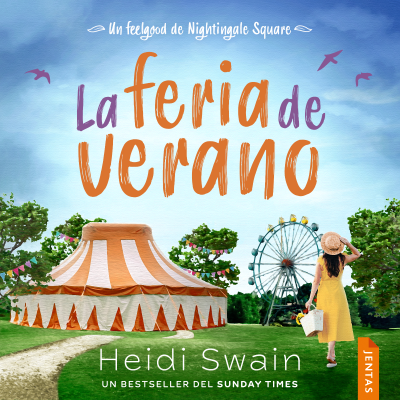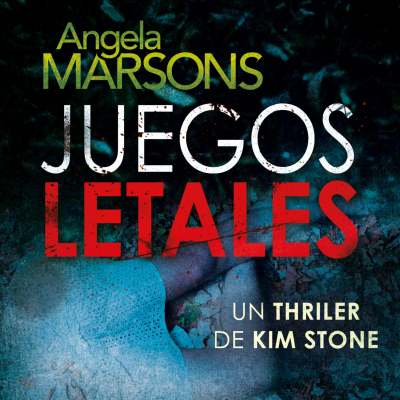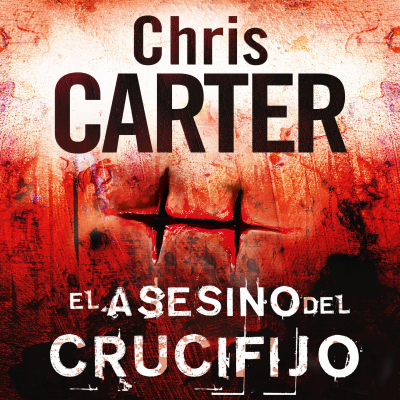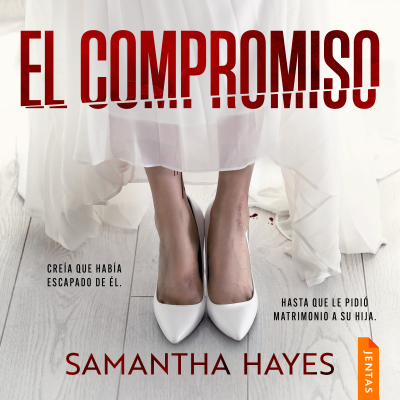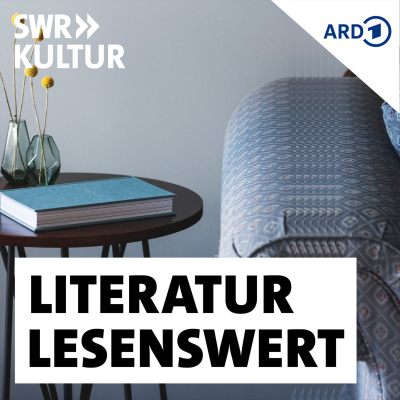
SWR Kultur lesenswert - Literatur
alemán
Cultura y ocio
Oferta limitada
2 meses por 1 €
Después 4,99 € / mesCancela cuando quieras.
- 20 horas de audiolibros / mes
- Podcasts solo en Podimo
- Podcast gratuitos
Acerca de SWR Kultur lesenswert - Literatur
Die Sendungen SWR Kultur lesenswert können Sie als Podcast abonnieren.
Todos los episodios
5474 episodiosFleur Jaeggy – Mutmaßliche Leben
Es hat sie tatsächlich gegeben: Den jugendlichen Ausreißer, der früh zum Opiumsüchtigen wurde. Einen zweiten, der als Kind gleichermaßen gern dichtete und sich prügelte. Und einen, der als Kind unter Gehirnfieber litt, in seiner Phantasie mit großen Dichtern sprach und später in die Südsee stach. Sie alle wurden Dichter, sind in die Literaturgeschichte eingegangen. EXTREME LITERARISCHE BEGABUNGEN Hier stehen je einer im Zentrum der drei Erzählungen unter dem Titel „Mutmaßliche Leben“. Die Rede ist von Thomas de Quincey, von John Keats und von Marcel Schwob, dem französischen Schriftsteller und Übersetzer. Sie alle waren schräge Vögel mit extremer literarischer Begabung, die sich schon in der Kindheit zeigte: > Das Kind begann zu schreiben: Es diktierte der windstillen Ruhe, der Asche, dem Flüstern des Schicksals, dem düsteren Ausrufezeichen, den Visionen, der Apathie seine Erinnerungen. > > > Quelle: Fleur Jaeggy – Mutmaßliche Leben Das bemerkt Fleur Jaeggy über die literarischen Anfänge des 1785 geborenen Thomas de Quincey. Der Essay „Der Mord als schöne Kunst betrachtet“ des hochproduktiven Drogenabhängigen und achtfachen Kindervaters kann bis heute als eine zentrale Schrift über die Frage gelten, warum Kunst und Moral nichts miteinander zu tun haben. ZWISCHEN RAUFEREIEN UND TRÄUMEN So exzentrisch wie de Quincey war auch John Keats, der neben Lord Byron und Percy Bysshe Shelley [https://www.swr.de/kultur/literatur/mary-shelley-frankenstein-175-todestag-100.html] zu den großen englischen romantischen Dichtern zählt, seine „Ode on a Grecian Urn“ oder „Ode to a Nightingale“ gehören in England zum literarischen Kanon, wie bei uns Balladen von Friedrich Schiller [https://www.swr.de/kultur/literatur/schiller-die-neue-dauerausstellung-im-renovierten-schiller-nationalmuseum-100.html] oder „Hälfte des Lebens“ von Friedrich Hölderlin. Jaeggy schreibt: „John Keats war sieben und besuchte die Schule von Enfield. Ehe er Verse zu schreiben begann, wurde er vom Zeitgeist ergriffen, von einer bizarren Laune und ungestümem Zorn. Jeder Vorwand war ihm recht, um sich mit seinen Kameraden in die Haare zu geraten, Schlägereien anzufangen.“ Auch das Leben des einer jüdischen Familie entstammenden Marcel Schwob, dessen Buch „Gabe an die Unterwelt“ auch in Deutschland über Jahrzehnte populär war, ist von Beginn an bizarr. Über Schwob, der als Kind an Gehirnfieber litt, berichtet Jaeggy: „Als er im abgedunkelten Zimmer das Bett hüten musste, unternahm Marcel lange Reisen. Er war leicht rachitisch und träumte davon, wie er schwimmend den Ärmelkanal überquerte und bei seiner Ankunft von Jules Verne umarmt wurde. Ein anderer Freund, mit dem er sich gern unterhielt, sobald er seinen deutschen Hauslehrer hinausgeworfen hatte, war Edgar Allan Poe.“ SACHLICHER TON, PRÄZISE WORTWAHL Fleur Jaeggys Erzählungen basieren zwar auf lebensgeschichtlichen Fakten dieser drei Männer, doch vieles an ihnen klingt so aberwitzig, als hätte die Autorin es sich ausgedacht. Anders gesagt: Fleur Jaeggys Ton ist verknappt und stets sachlich, präzise in der Wortwahl. Das schafft Distanz zu den ungeheuerlichen, zwischen Wahn, Sucht und Talent zerrissenen Personen dieser Trias. Diese Distanz sorgt dafür, dass man über das Exaltierte staunen kann, ohne davon überwältigt zu werden. > Sieben Stunden vergingen, seitdem Keats gesagt hatte, er werde sterben. Das Atmen schwieg. Der Tod belebte sich endlich. Nach der Autopsie sagte Clark, er begreife nicht, wie Keats so lange habe leben können. > > > Quelle: Fleur Jaeggy – Mutmaßliche Leben WORTE WIE POLIERTES METALL Wer Fleur Jaeggys Sprache zuvor schon kannte, wird auch in „Mutmaßliche Leben“ in Berührung kommen mit Sätzen, deren Worte glänzen wie einst hoch erhitztes, nun gegossenes, erkaltetes und poliertes Metall: unwirklich schön, auch ein wenig irritierend und äußerst kunstvoll. Und obwohl der Preis von 22 Euro für ein derart dünnes Bändchen gesalzen ist, könnte man mit diesen drei Erzählungen gut damit beginnen Jaeggy zu lesen, nicht zuletzt, weil einem diese drei Leben nach der Lektüre so plastisch vor Augen stehen.
Ein Täter als Leerstelle: Judith Hermanns neues Buch „Ich möchte zurückgehen in der Zeit“
REISE NACH RADOM Zwei Dinge sind es, die Judith Hermann in einem nicht lange zurückliegenden Winter dazu bewegt haben, in die polnische Stadt Radom zu fahren und sich dort für einige Wochen einzumieten: Ihre Mutter erleidet einen temporären Gedächtnisverlust. Und sie findet in einer Kiste ein Foto ihres Großvaters aus dem Jahr 1941, auf dem er in Radom auf einem Motorrad der SS posiert. Die deutschen Besatzer hatten in Radom ein Ghetto errichtet. Mindestens 20.000 jüdische Bürger wurden von dort aus ins Konzentrationslager Treblinka deportiert. Judith Hermann hat ihren Großvater nie kennengelernt; er starb sechs Jahre vor ihrer Geburt. UNVERWECHSELBARER JUDITH HERMANN-SOUND Der Aufenthalt in Radom bildet das erste Kapitel von „Ich möchte zurückgehen in der Zeit“; einem Buch, das keine Gattungsbezeichnung trägt. Der Tonfall ist der klassische, unverwechselbare Judith Hermann-Sound, zurückhaltend, schwebend, Leerstellen betonend. Und genau das ist auch der Großvater: eine Leerstelle. In Radom kommt die Schriftstellerin zunächst nicht weiter. Die Menschen, mit denen sie zu sprechen versucht, reagieren abwehrend. Dann geschieht etwas Erstaunliches: Plötzlich öffnen sich ihr Türen, melden sich potentielle Gesprächspartner. Hermann findet endlich den Ort, an dem das Foto auf dem Motorrad geschossen wurde. Und genau in diesem Augenblick packt sie ihre Koffer. Die Autorin selbst sagt zu dieser verblüffenden Wendung: „Es ist ihm dort gut gegangen. Das ist das, was sie erfährt. Und das ist natürlich eine ziemlich schlichte und ziemlich entsetzliche Erkenntnis. Und mit dieser Erkenntnis fährt sie wieder ab.“ „DU LITERARISIERST“: LEERSTELLEN UND ERKENNTNISINTERESSE „Du literarisierst“ – das ist der Vorwurf, den die Mutter der Schriftsteller-Tochter mehrfach macht. Was heißen soll: Du dramatisierst. Das Erkenntnisinteresse der Schriftstellerin ist kein historisches. Der Großvater ist ein Täter. Was genau er getan hat, bleibt im Dunkeln. Er taugt nicht als literarische Figur, sondern steht als ewiges Gespenst inmitten eines dichten Familiengeflechts. Es sind Details, die Judith Hermann herausarbeitet. Da ist beispielsweise eine Suppenkelle, die die Familie von jeher am Mittagstisch benutzt hat. Nur für die Erzählerin ist der Umstand von Bedeutung, dass sie ein Geschenk des Großvaters an seine Tochter war, wenige Monate vor seinem Tod. Für alle anderen ist es eben nur eine Kelle. Judith Hermann befragt ihre Mutter, insistierend, manchmal auch erbarmungslos. Über das Verhältnis der beiden im Buch sagt sie: „Auf der einen Seite sind es die psychoanalytischen Versuche der Tochter, auf Kindheitstraumata, generationsübergreifendes Verhalten hinzuweisen. Auf der anderen Seite ist es die sehr statische, gegenwärtige Haltung der Mutter, die eigentlich nichts wissen will und nichts weiß und doch manchmal die eine oder andere Tür plötzlich aufmacht und den dahinter liegenden Raum kurz zeigt – und die Tür dann wieder verschließt.“ AUF DEN SPUREN DES GROSSVATERS Judith Hermann beharrt darauf, dass lediglich das erste, das Radom-Kapitel, unverstellt autobiografisch sei. Von dort aus reist die Erzählerin weiter nach Neapel, zu ihrer jüngeren Schwester, die als Archäologin arbeitet. Die Schwester hält die Geschichte des Großvaters von sich und ihrer Familie fern, betrachtet ihn, analog zu ihren Ausgrabungen, als geschlossenen Fall. Gegen die Erzählerin erhebt sie den unausgesprochenen Vorwurf, eine Art Totenkult im Negativen um den Großvater zu inszenieren. Judith Hermann sagt dazu: „Ich habe etwas über ihn schreiben wollen, um ihn mir selbst zu zeigen und dann einen Abstand zwischen mich und ihn zu legen, aber gleichzeitig ist er mir hierdurch auf eine schwer zu benennende Weise näher gekommen, und das ist eine sehr seltsame, beunruhigende und gleichzeitig auch deutliche Erfahrung.“ EIN GEWAGTES BUCH, DAS FÜR DEBATTEN SORGEN WIRD > Ein Buch über meine Familie und das Schweigen" „Ich möchte zurückgehen in der Zeit“ ist ein gewagtes Buch, das mit Sicherheit in seinem persönlichen Ansatz und seinen kalkulierten Lücken für Debatten sorgen wird. Diese Aussparungen lassen sich als Aufforderung an die Leser verstehen, sie mit der eigenen Familiengeschichte aufzufüllen. Ein Buch auch mit einem geradezu unheimlichen Schlusskapitel, das den Fokus noch einmal überraschend verschiebt. Ist also dieser Text weniger ein Buch über einen Täter-Großvater als über das unsichtbare Band, das sich aufgrund dieser Verwandtschaft um eine ganze Familie legt? „Ich würde das auf jeden Fall so sagen. Ich würde sagen, es ist nicht ein Buch über meinen Großvater. Es ist ein Buch über meine Mutter und ein Buch über meine Familie und das Schweigen in Familien und über die Möglichkeit der schweigenden Verständigung in Familien und die Aussicht auf ein interfamiliäres Gespräch.“
Ein Land wird erwachsen: Die Gründerjahre der Bundesrepublik
Welch stürmische Entwicklung hat Deutschland doch genommen zwischen 1955 und 1967! Die ersten Gastarbeiter wurden ins Land geholt, es gab die Auschwitz-Prozesse, in Berlin wurde die Mauer gebaut, die RAF verübte Attentate, die Studentenbewegung begann. In seiner sprachlich und inhaltlich großartigen Erzählung dieser wichtigen Zeit macht Harald Jähner uns bewusst, wie sehr sie uns noch immer bestimmt. IN UNSEREN ANSPRÜCHEN LEBEN DIE FÜNFZIGER JAHRE WEITER „Die Aufschwungsjahre prägen das Selbstverständnis der Bundesrepublik bis heute. Sie bleiben, so außerordentlich sie auch waren, Wegmarken des Möglichen. Sie leben, wenn nicht in unseren Erfolgen, so doch in unseren Ansprüchen weiter“, schreibt Jähner. „Die berauschenden Einnahmen sind weg, die Erwartungen an den Wohlfahrtsstaat aber geblieben. Allein die Sorge über die damit einhergehende chronische Staatsverschuldung macht die Erinnerung an das vermeintliche Wirtschaftswunder zu einer erhellenden Erfahrung.“ 1955 stieg die Wirtschaftskraft um 12 %, in jedem weiteren Jahr bis 1967 um durchschnittlich weitere 6,4 %. Die Zechen im Ruhrgebiet waren bald nicht mehr wirtschaftlich und wurden geschlossen. Die neue Energiequelle hieß Öl. Städte wie Hannover wurden „autogerecht“ umgebaut, Energie wurde sorglos verschwendet. Harald Jähner nennt es den „Beginn eines großen Achselzuckens“. DER BEGINN EINES GROSSEN ACHSELZUCKENS „Um die weitreichenden und langfristigen Folgen der Emissionen auf Klima und Umwelt zu erfassen, fehlte beides, die Wissenschaft und die Phantasie. Dass man heute vom «1950er-Syndrom» spricht und die Dekade als Beginn einer globalen Umweltversehrung begreift, hätte sich damals kaum jemand träumen lassen.“ Auch im Privaten wurde hemmungslos konsumiert; der dicke Neckermann-Katalog lag auf jedem Küchentisch. Abends versammelte sich die Familie jetzt um das Radio, was von Intellektuellen als Niedergang der Kultur angesehen wurde. Die Jugend fand die Angebote langweilig, und der Siegeszug des amerikanischen Soldatensenders AFN begann – bis das Fernsehen kam. Gerade erst hatten die Frauen Häuser und Familien wieder aufgebaut, aber nun waren die Männer zurück, psychisch zerstört vom Krieg. Die Frau hatte wieder Hausfrau zu sein und dem Mann ein bequemes Heim zu bieten. Die Nachkriegsfamilie erzog ihren Nachwuchs zu korrektem Benehmen und zeigte kaum Gefühle. Besonders litten die Homosexuellen; bis 1969 wurden über 150.000 von ihnen verhaftet. VON DER LEISTUNGS-IDEOLOGIE ZUR SELBSTVERWIRKLICHUNG Es war die Jugend, die aufbegehrte. Mitte der 1950er Jahre erschienen die „Halbstarken“, dann verweigerten sich die sogenannten Gammler dem bürgerlichen Leben und die Beatles gaben einer ganzen Generation den passenden Soundtrack. Jähner meint zu dieser Jugend: „Sie verkörperten einen Geist des Innehaltens, der in der Mitte des Jahrzehnts immer deutlicher nach Berücksichtigung verlangte. Für viele Menschen erschien die Perspektive unablässigen Wachstums längst nicht mehr so erstrebenswert wie zu Beginn des Aufschwungs.“ > Sie pochten, inzwischen gewöhnt an stabile Verhältnisse, auf mehr Freizeit und Selbstverwirklichung, hinterfragten eine Lebensgestaltung, in der die Arbeit dominierte und Stress das Familienglück auffraß. > > > Quelle: Harald Jähner – Wunderland Mit dieser Geisteshaltung sind wir endgültig in der Gegenwart angekommen. Das Buch von Harald Jähner zeigt uns, wie ein Ereignis zwingend zum nächsten führte und in das Leben der einzelnen Menschen hineinwirkte. Es zeichnet sich durch kluge Analysen aus, ist mitreißend geschrieben, und auch, wer nicht der Nachkriegs-Generation angehört, sollte es lesen: Es ist die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Menschen.
Der alte Schriftsteller und das junge Mädchen
Sie ist 14, er ist 46, als sie einander das erste Mal in Kopenhagen im Januar 1980 begegnen. Das Mädchen Tanja und der Schriftsteller Eg. Er beginnt ihr lange Briefe zu schreiben: „Das einzig Aufregende, was in meinem Leben passierte, war er, waren seine Briefe. Also schrieb ich, woran ich dachte, schrieb Dinge, die ich erfand, als wäre ich eine andere. Die Wörter flossen mir aus der Hand, ich schrieb und schrieb, gefesselt davon, was die Schrift erschuf, eine magische Welt, nur mit Eg und mir.“ DER SCHRIFTSTELLER UND DAS KIND Ausführlich erzählt Ulrikka S. Gernes in „Ein Mädchen verließ das Zimmer“ von diesem Briefwechsel, dem Werben des Schriftstellers um das Kind; von einer gegenseitigen, aber nicht gleichberechtigten Annäherung. Eg versteht es, mit Worten umzugehen, erzählt ihr, wie schön, wie einzigartig sie sei, wie besonders die Liebe, die sie miteinander verbinde. Diese Briefe reißen Tanja aus ihrer Einsamkeit, sie fühlt sich ernst genommen. Deshalb glaubt sie, sie würde Eg auch lieben. Nach einigen Monaten des Briefeschreibens treffen sie sich in Kopenhagen wieder – und als sie 15 Jahre alt und damit gesetzlich sexualmündig ist, haben sie Sex. BASIEREND AUF WAHREN EREIGNISSEN „Ein Mädchen verließ das Zimmer“ ist ein Roman, aber er beruht auf wahren Erlebnissen – das spürt man in vielen Details: Bei den wiederholten Erwähnungen der Bartstoppeln, die Tanja beim Küssen das Gesicht wundscheuern, bis sich Eg aus Rücksichtnahme rasiert, bevor sie Sex haben. In den Beschreibungen des Schmerzes, der Lust, der Leere, die sie im Bett empfindet. Zwar sind manche Passagen blumig und einige wiederkehrende Formulierungen manieriert – so hat Tanja beispielsweise keine Einsichten, sondern sie „sinken“ in sie hinein – aber: Gernes gelingt es, dass man sich in dieses junge Mädchen hineinversetzt und versteht, warum sie glaubt, all das selbst zu wollen. Das liegt vor allem daran, dass konsequent aus der Ich-Perspektive Tanjas erzählt wird. Mit allen Teenager-Sehnsüchten, albernen Gedanken, Schuldgefühlen und Scham. WENN DAS MÄRCHEN BRÖCKELT Zu den Ereignissen in den 1980er Jahren kommen noch Kapitel, die weiter in die Gegenwart bis ins Jahr 2022 reichen – sie sind weniger dicht und etwas zu lang. Je älter Tanja wird, desto deutlicher erkennt sie, dass Eg nicht der Ritter war, der ihr eine romantische Flucht aus ihrem Dasein ermöglicht hat, sondern ein erwachsener Mann, der sie mit Erzählungen und Märchen manipuliert hat. Leider spiegelt sich diese Entwicklung kaum sprachlich wider. Doch damit unterstreicht sie wiederum, wie schwierig es für Tanja ist, sich von Eg, von diesem Dasein als junges Mädchen zu lösen. Sie hat stets getan, was er wollte, so dass Nachgeben zu lange ihre Reaktion ist. Dazu kommt: Sie hat keine Ahnung, wer sie ist. Sie hat kein Ich, zu dem sie zurückfinden kann, weil ihre Identität noch gar nicht ausgebildet war, bevor der Kontakt zu dem erwachsenen Mann begann. > In meinem Leben gab es kein Davor, zu dem ich zurückkehren konnte. Ein Mädchen verließ mit vierzehn das Zimmer und wurde nicht mehr gesehen. Ein weißer Fleck auf der Karte. Ein nasser Fleck auf dem Laken. Eine leere Puppe. Ein Loch in der Welt. > > > Quelle: Ulrikka S. Gernes – Ein Mädchen verließ das Zimmer GESELLSCHAFTLICH TOLERIERT Dieser Roman ist weniger eine Anklage als ein Versuch zu verstehen: Warum Eg bis zu seinem Tod nicht sah, dass sein Handeln falsch war. Warum weder ihre Eltern noch seine Mutter diese „Beziehung“ missbilligt haben. Verheimlicht haben Eg und Tanja sie nur, als Tanja noch 14 Jahre alt war. Danach war die minderjährige Tanja ganz selbstverständlich an seiner Seite auf Partys und Veranstaltungen. Es sind die 1980er Jahre, in denen insbesondere Künstler fast alles durften. Aber noch Jahrzehnte später wird akzeptiert, dass es in jenen Jahren so war – und diejenigen, die damals schon erwachsen waren, sagen zu Tanja: Du wolltest es doch selbst, oder? Wir alle kennen diese Geschichten. Ulrikka S. Gernes erzählt eindringlich von einem dieser Mädchen, das dem manipulierenden Versprechen von Liebe glaubte und mit den unauslöschlichen Folgen der Taten leben muss.
Reise durch ein Land im Wandel mit der USA-Expertin Rieke Havertz
Das Fragezeichen im Titel des Buches „Goodbye, Amerika?“ ist für die Journalistin Rieke Havertz entscheidend. Die Frage, ob sie selbst und wir Deutsche uns von Amerika verabschieden müssen, erweist sich als ebenso grundsätzlich wie schwierig. In einer Mischung aus persönlichen Erinnerungen und journalistischer Recherche vergleicht die Autorin ihre erste Amerika-Erfahrung als Austauschstudentin in Ohio im Jahr 2003 mit der heutigen Situation in den USA. Wie privilegiert sie damals als Stipendiatin im idyllischen, linksliberalen Universitätsstädtchen Athens in einer Studenten-WG lebte, ist ihr heute sehr bewusst. Sie brauchte keinen Nebenjob, um 20.000 Dollar Studiengebühr zu zahlen und startete nicht mit Schulden ins Berufsleben. Fast neunzig Prozent der Einwohner in Athens sind Weiße. Rassismus und Armut waren keine Alltagserfahrung für die deutsche Studentin. Amerika schien lässig, tolerant, freundlich und großzügig. „Ich lebe das Klischee, von dem ich angelockt wurde“, stellt Havertz im Rückblick kritisch fest. VERÄNDERUNGEN UND SELBSTTÄUSCHUNGEN BEIM USA-BILD Als spätere USA-Korrespondentin berichtet sie über Wahlkämpfe und spricht mit Menschen, die für einen Auftritt von Donald Trump sonntagsvormittags in einer Warteschlange anstehen, als käme der Messias. Nach Trumps erstem Wahlsieg 2016 bemerkt Havertz bei ihren Recherchen eine Veränderung. > Es ist vielleicht der erste Moment, an dem die Offenheit mir gegenüber kippt. Es gibt auch 2016 bereits Ladenbesitzer, die nicht mit mir sprechen wollen. Es gibt das Diner, in dem ich mich an den Tresen setze und hoffe, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und ungewöhnlich lange allein dort ausharre. > > > Quelle: Rieke Havertz – Goodbye, America? Aber was sind tatsächliche Veränderungen und wo muss man sich Selbsttäuschungen im eigenen Amerika-Bild eingestehen? Dass die Autorin herausfinden möchte, was sie selbst vielleicht allzu bereitwillig lange übersehen hat, macht das Buch so spannend, denn dies regt auch die Leser zu eigenen Reflexionen an. AMERIKANISCHE GESCHICHTE AUF DEM PRÜFSTAND Die 1980 geborene Journalistin ist wie viele Deutsche geprägt vom Einfluss amerikanischer Populärkultur. Kinofilme, Fernsehserien und Musik sind Teile einer mächtigen US-Unterhaltungsindustrie, die unser Bild vom „land of the free“, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, bestimmten. Doch dieses Land hat es so nie gegeben, wie Havertz klarstellt. > Das eigene Schicksal selbst in die Hand nehmen zu können, darauf basiert der amerikanische Traum immer noch, obwohl er nur für die wenigsten konkret lebbar ist und selbst unter den founding fathers in Bezug auf das Wahlrecht nur den wenigen Privilegierten gewährt wurde. Konkret: wohlhabenden, weißen Männern, die Land besaßen. Manche Bundesstaaten führten außerdem noch religiöse Tests ein, um sicherzustellen, dass nur christliche Männer wählen würden. > > > Quelle: Rieke Havertz – Goodbye, America? Havertz führt viele solcher Beispiele an, die unser idealisiertes Amerikabild in Frage stellen. Sie zeigt, dass auch der charismatische Barack Obama längst nicht alle Hoffnungen erfüllte. Obwohl die Autorin Amerika als ihre zweite Heimat empfindet, weiß sie um dessen Defizite: Kein Land hat so viele Waffen im Umlauf wie die USA, wo sich inzwischen ein Neopatriarchat mit frauenfeindlichen Slogans entwickelt. ABSCHIED VON ALTEN GEWISSHEITEN Die Vorgabe von der Familie als Herzstück des amerikanischen Lebens hat eine heteronormative Komponente, die vielen Minderheiten das Existenzrecht abspricht. In Amerika lebt man auf Kredit und sieht Armut immer noch als selbstverschuldetes Schicksal an. Ambivalenzen, die auch bei der Autorin Zweifel hinterlassen. Rieke Havertz hat ein leicht lesbares, gründlich recherchiertes Buch über die USA geschrieben, das keine einfachen Antworten auf die Frage „Goodbye, Amerika?“ bereithält. Ein schneller Abschied für immer mag es vielleicht nicht sein. Ein Abschied von alten Gewissheiten aber schon.
Elige tu suscripción
Oferta limitada
Premium
20 horas de audiolibros
Podcasts solo en Podimo
Podcast gratuitos
Cancela cuando quieras
2 meses por 1 €
Después 4,99 € / mes
Premium Plus
100 horas de audiolibros
Podcasts solo en Podimo
Podcast gratuitos
Cancela cuando quieras
Disfruta 30 días gratis
Después 9,99 € / mes
2 meses por 1 €. Después 4,99 € / mes. Cancela cuando quieras.