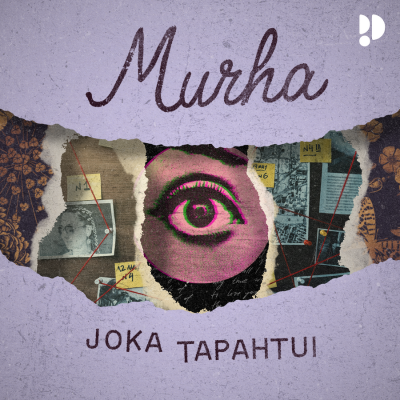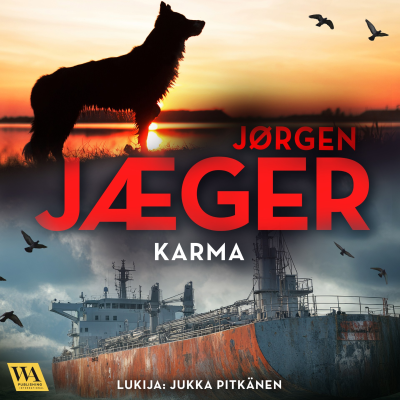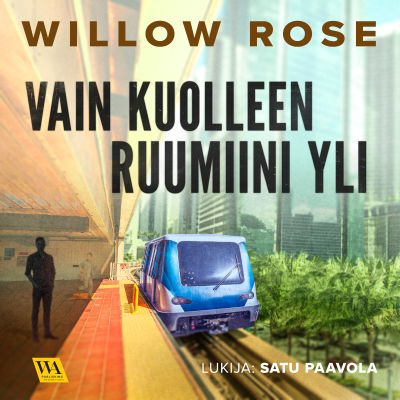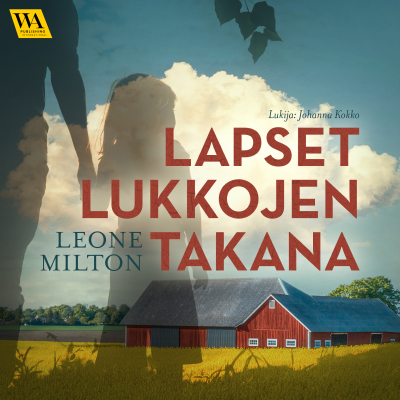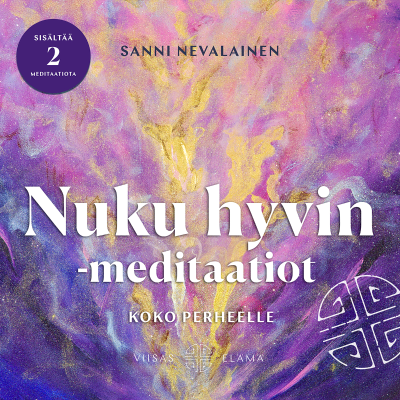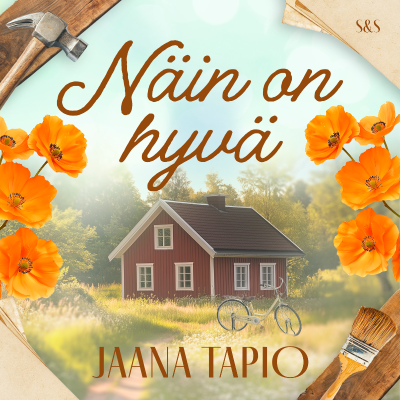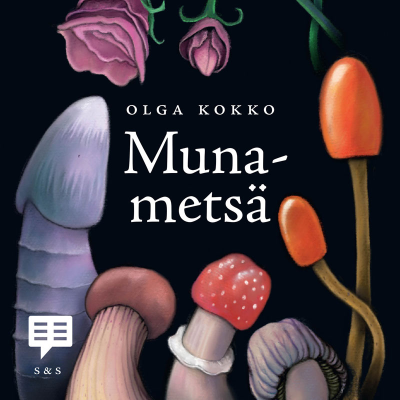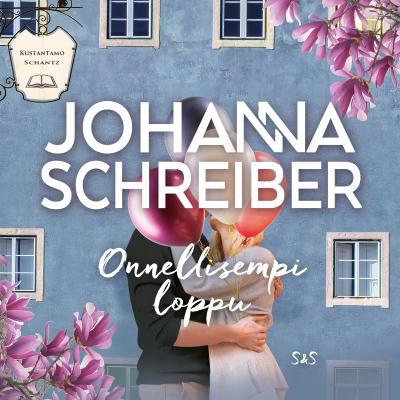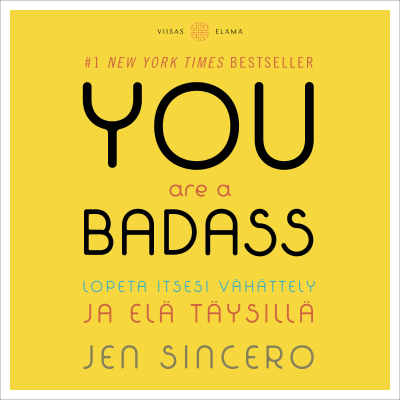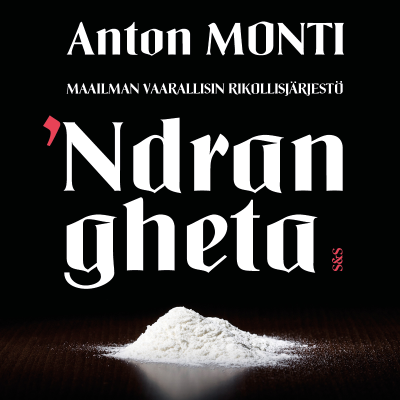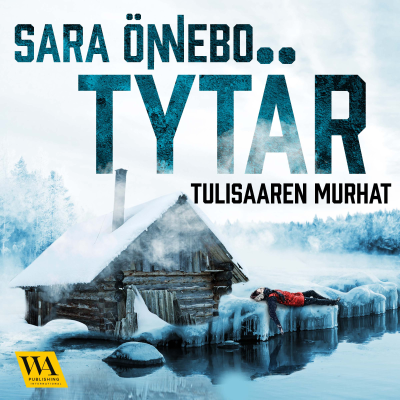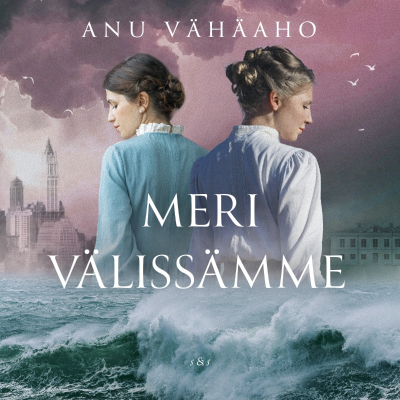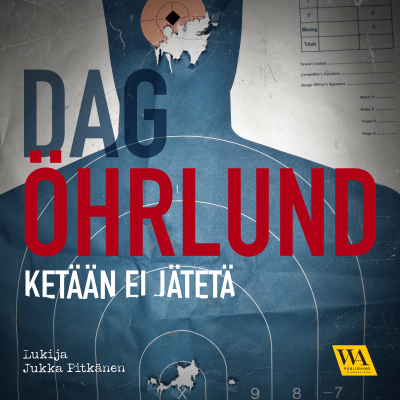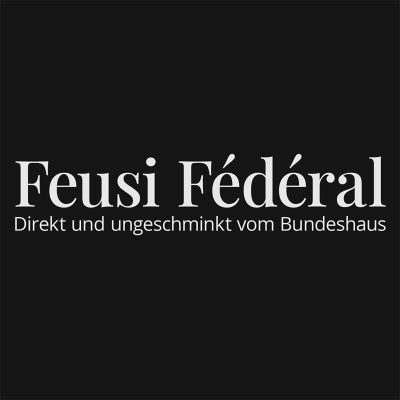
Feusi Fédéral. Direkt aus dem Bundeshaus
Podcast by Dominik Feusi
Rajoitettu tarjous
2 kuukautta hintaan 1 €
Sitten 7,99 € / kuukausiPeru milloin tahansa.

Enemmän kuin miljoona kuuntelijaa
Tulet rakastamaan Podimoa, etkä ole ainoa
Arvioitu 4.7 App Storessa
Lisää Feusi Fédéral. Direkt aus dem Bundeshaus
Feusi Fédéral – der wöchentliche Polit-Talk des Nebelspalters von Dominik Feusi aus dem Café Fédéral oder dem Bundeshaus in Bern. Direkt und ungeschminkt. Ein Gespräch wie kein anderes: Schweizer Politik und (meist) eine Flasche Wein. Jede Woche hier oder als Video auf Nebelspalter.ch.
Kaikki jaksot
171 jaksotDominik Feusi im Gespräch mit dem Schweizer Aussenminister über die Rahmenverträge. Ignazio Cassis betont, dass die Schweiz Zugang zu möglichst vielen Märkten brauche, aber jener der EU sei der wichtigste. Daran ändert für ihn auch die bundesrätliche Studie nichts, welche den möglichen Verlust der «Marktbeteiligung» mit 0,48 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bezifferte. Die Zuwanderung ist für Ignazio Cassis ein wichtiges Thema. Aber sie ist die Folge des wirtschaftlichen Erfolges: «Wollen wir die Zuwanderung reduzieren, müssen wir die Arbeitsstellen reduzieren, das heisst, anstatt ein Wachstum in der Wirtschaft einen Rückgang des Wachstums haben.» In die Schweiz komme nur, wer einen Arbeitsvertrag habe. Den Familiennachzug gebe es seit 25 Jahren und trotz Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie «ändert sich sehr, sehr wenig.» Auch die Übernahme von EU-Recht kenne die Schweiz seit 25 Jahren und sie sei im Interesse der Schweiz. Ein Schweizer Unternehmen, das nicht in die EU exportiere, müsse EU-Recht nicht übernehmen. Cassis unterstreicht diese Behauptung mit einem Beispiel: «Wenn ich als Unternehmen nur Erdbeerenkonfitüren für die Schweiz mache, dann ist es mir egal, was die EU reguliert.» Vollständig von der Regulierung betroffen seien allerdings Firmen «im Flugtransport, im Landtransport, in der Landwirtschaft oder in der Industrie.» Am politischen Prozess, den Institutionen, der direkten Demokratie und an der Rolle des Parlaments, des Bundesrates und der Bundesgerichte «ändert sich nichts», findet Ignazio Cassis. Bei der Streitbeilegung spiele das Schiedsgericht die entscheidende Rolle, nicht der Gerichtshof der EU.
Dominik Feusi im Gespräch mit der Ständerätin aus dem Aargau Trumps Zölle haben die Aargauerin «aus den Socken gehauen». Jetzt sei Zusammenhalt nötig. Der betroffenen Wirtschaft müsse geholfen werden. Von Gegenzöllen hält sie nichts. Wichtig sei, dass nicht noch die Beziehungen zur EU zu Bruch gehen würden. Marianne Binder legt dabei offen, ob sie die 1900 Seiten zu den Rahmenverträgen gelesen hat oder nicht. Zu wenig in die Sicherheit investiert Für Marianne Binder braucht es eine starke Verteidigung und die dazu nötige Finanzierung der Armee. Es wäre falsch, jetzt den F-35A abzubestellen, weil er teurer werde. Eine neue Abstimmung brauche es auch nicht. «Wir sind in einer sich eskalienden Situation in Europa», findet Binder. Gerade weil die Schweiz nicht in der Nato sei, müsse sie ihren Luftraum selber verteidigen. «Ein grosses Problem ist, dass wir jahrelang gewohnt waren, nicht in unsere Sicherheit adäquat zu investieren. Wir sind sehr verwöhnt.» Für die bewaffnete Neutralität Sie stellt sich hinter einen Gegenvorschlag zur Neutralitätsinitiative. Dieser erlaube internationale Kooperationen in Friedenszeiten und das sei unbedingt nötig. Die Initiative sei «zu strickt». Die Neutralität sei nur «Mittel zum Zweck». Entscheidend sei die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz.
Dominik Feusi im Gespräch mit dem Direktor des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SVV). Keine ausserordentlich hohe Schadenssumme Zwei Wochen nach dem Bergsturz hat Urs Arbter das verschüttete Lötschental besucht. «Ich war beeindruckt, wie die Gemeinde mit dem Unglück umgegangen ist», erzählt er. Die Versicherer haben den Schaden auf 320 Millionen Franken geschätzt. Die Summe sei nicht einmal ausserordentlich hoch. Die Privatversicherer würden solche Ereignisse über einen Elementarschadenpool abwickeln. «Das ist kein Problem.» Im Kanton Wallis gibt es keine staatliche, obligatorische Gebäudeversicherung. Was passiert mit jemandem, der nicht versichert ist? «Es gibt nur wenige, die nicht versichert sind», sagt Arbter. Nicht versichert sei die Infrastruktur und dafür werde die Gemeinde, der Kanton Wallis und mit fünf Millionen Franken der Bund aufkommen. Was passiert bei einem Erdbeben? Seit Jahren scheitern Vorstösse für eine nationale Erdbebenversicherung. Jetzt steht eine «Eventualverpflichtung» zur Diskussion. diese Würde bedeuten, dass nach einem Ereignis die ganze Bevölkerung zur Kasse gebeten würden. Der Versicherungsverband lehnt diese Lösung ab. Arbter befürchtet, dass ein solcher Schaden dann einfach mit Staatsschulden bezahlt würden. «Es gibt immer mehr Leute, die sich gegen Erdbeben versichern, das kann man auch so laufen lassen.» Versicherungen sind typisch schweizerisch Schweizer seien in der regel gut versichert. Das gemeinsame Tragen von Risiken ohne Staat sei typisch für unser Land. «Wir tun uns zusammen, jeder zahlt etwas ein und der, der einen grossen Schaden hat, bekommt Geld. Das funktioniert.» Der Bundesrat will im Rahmen des Entlastungspaketes den Kapitalbezug von angespartem Rentenkapital höher besteuern. «Der Vorschlag ist grundsätzlich falsch», findet Arbter. Diese Steuererhöhung setze die falschen Anreize. Betroffen wäre ein Grossteil der Bevölkerung. Der Missbrauch der Kapitalauszahlung sei gering.
Dominik Feusi im Gespräch mit dem Künstler und Freigeist Jürg Halter. «Der Druck, dass man in eine Schublade passt, hat zugenommen», sagt Jürg Halter. Das habe mit der Digitalisierung zu tun, aber auch mit dem Kulturbetrieb an sich. Bei jüngeren Schriftstellern stehe die Ich-Perspektive im Vordergrund. «Das reicht dann für ein Buch über die eigene Biografie und dann ist fertig», findet Halter. «Man ist nicht fähig, über sich hinauszudenken.» Und es gebe viel zu viel aktivistische Kunst, in der es nur darum gehe, eine politische Botschaft zu platzieren. «Es passiert keine Übersetzung oder intellektuelle Mehrleistung.» Kritik an der Identitätspolitik «Die Kunst hat sich gegen den Individualismus entwickelt», kritisiert Halter. Die Kultur habe sich der Identitätspolitik zur Verfügung gestellt. «Das wofür man nichts kann, das Geschlecht, die Herkunft, die sexuelle Orientierung, ist ins Zentrum gerückt.» Das sei auch in die Förderbedingungen im Kulturbetrieb eingeflossen. Damit werde rechte Identitätspolitik umgekehrt und von links übernommen, warnt Halter. «Ich habe das Gefühl, dass diese Entwicklung kontraproduktiv ist, weil sie wiederum zu Ausschluss führt, da sie das Trennende betont und nicht das Gemeinsame.» Selbstzensur im Kulturbetrieb Jürg Halter kritisiert dies seit Jahren ebenso deutlich wie differenziert. Er hat Anfeindungen aus dem Kulturbetrieb erlebt, weil er nicht nur rechte Positionen kritisiert, sondern auch auf linke Widersprüche aufmerksam gemacht hat. Viele im linken Spektrum sähen das genau so wie er, würden sich aber nicht getrauen, sich zu äussern. «Es gibt Selbstzensur, einerseits aus Angst, andererseits aus Bequemlichkeit», findet Halter. Verteidiger der liberalen Demokratie Seit er sich in der Jugend mit dem Zweiten Weltkrieg auseinander gesetzt habe, hege er eine extreme Abneigungen gegen Ideologien. «Je zugespitzter eine Ideologie, je absolutistischer, desto gefährlicher wird es.» Er sieht sich als Verteidiger der von rechts wie links gefährdeten «liberalen Demokratie». Die Linke sei drauf und dran, die Grundwerte der Aufklärung zu verraten. Besonders weil sie zum neuen Antisemitismus gegen die am meisten bedrohte Minderheit, den Juden, schweige. Die Verharmlosung des Islamismus habe eine lange Geschichte innerhalb der Linken. «Ich weiss gar nicht, wie man es in seinem Kopf schafft, die eigenen Werte komplett zu verraten.»
Dominik Feusi im Gespräch mit dem St. Galler SVP-Nationalrat Mike Egger. Und dann legt der ostschweizer Energiepolitiker die Herausforderungen in der Energiepolitik dar und weshalb diese nur mit Atomkraft zu meistern sind. «Umso mehr ich von diesem Vertrag lese, umso mehr staune ich über die Verhandlungsergebnisse», sagt Mike Egger. Er sei gar nicht einverstanden mit der Einschätzung von Bundesrat Cassis, dass es sich um das bestmögliche Verhandlungsresultat handle. Noch mehr Zuwanderung Egger befürchtet eine weitere Zunahme der Zuwanderung. Von Bundesrat Beat Jans’ Schutzklausel hält er gar nichts. «Der Bundesrat hat die Schutzklausel nie angewendet. Wieso soll er es jetzt machen, wenn er es vorher nicht gemacht hat?» Weil die Zuwanderung zunehme, dürfte der Bundesrat die Abkommen gar nicht unterschreiben, findet Egger. «Das widerspricht der mit der Masseneinwanderungsinitiative angenommenen Verfassungsartikel.» «Ich frage mich einfach, wieso die Schweiz das einzige Land auf der Welt ist, das eine Marktzugangsprämie zahlen soll», kritisiert Egger die Abkommen. Die Schweizer Wirtschaft solle sich nicht jener der EU angleichen. Die Alternative seien Freihandelsabkommen. «Da ist die Schweiz weltmeisterlich unterwegs.» Einschränkung der Demokratie Der Gerichtshof der EU würde die demokratischen Rechte beschneiden, befürchtet Egger. «Das ist ein No-Go!» Bei jeder Debatte zur Übernahme von EU-Recht würden die Befürworter vor den Sanktionen warnen, die der Schweiz drohten, wenn wir nicht mitmachen würden. «Dadurch wird die Demokratie eingeschränkt, jene des Parlamentes, der Kantonsregierungen am Schluss auch der Bevölkerung.» Beschleunigungserlass für AKWs In der Energiepolitik fordert Egger Technologieoffenheit und mehr inländische Stromproduktion. Man müsse wieder über Atomkraft reden können. Alles sei eine Frage des politischen Willens. «Es kann auch einen Beschleunigungserlass für Atomkraftwerke geben.» Die Politik müsse Verantwortung übernehmen, statt «Träumereien verkaufen».

Arvioitu 4.7 App Storessa
Rajoitettu tarjous
2 kuukautta hintaan 1 €
Sitten 7,99 € / kuukausiPeru milloin tahansa.
Podimon podcastit
Mainoksista vapaa
Maksuttomat podcastit