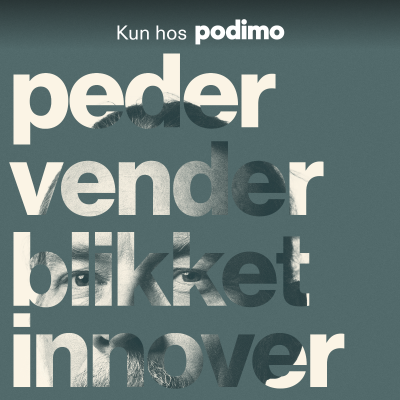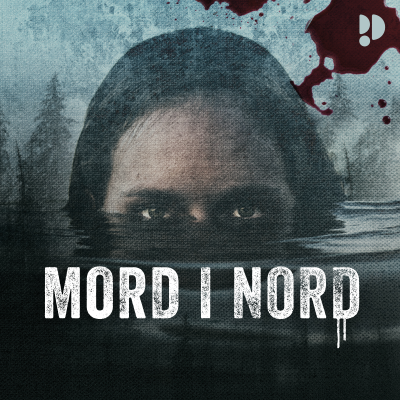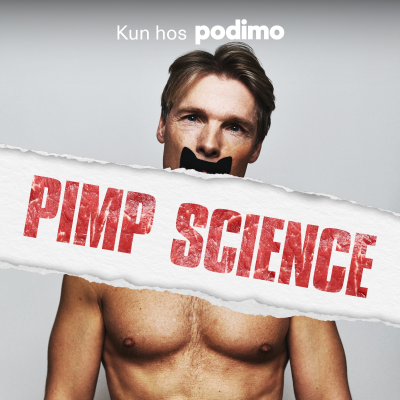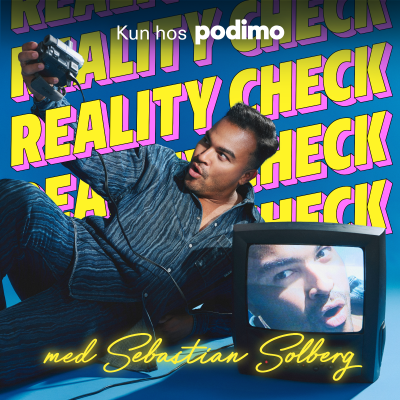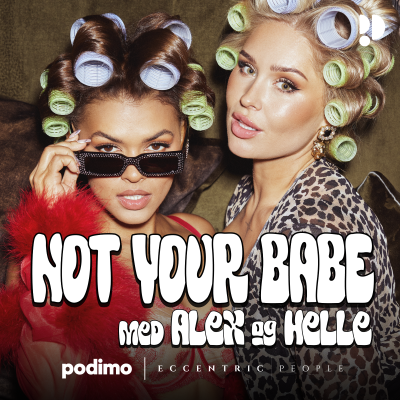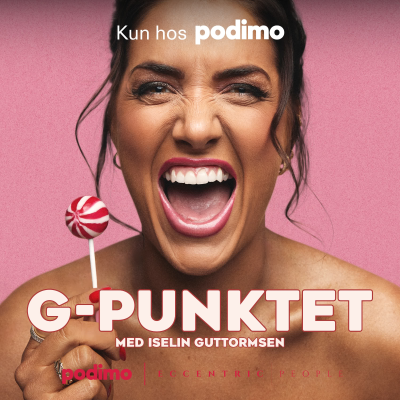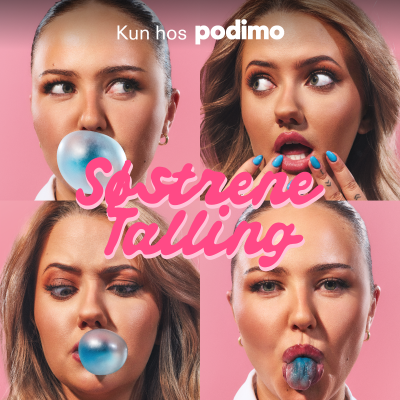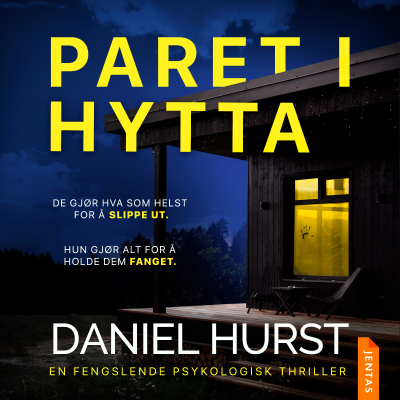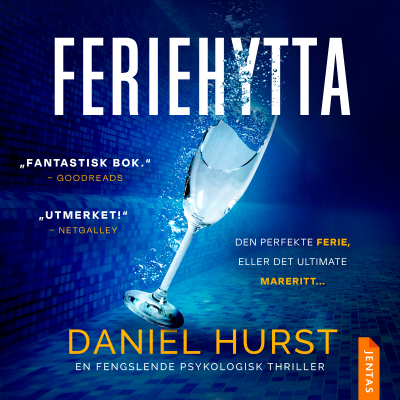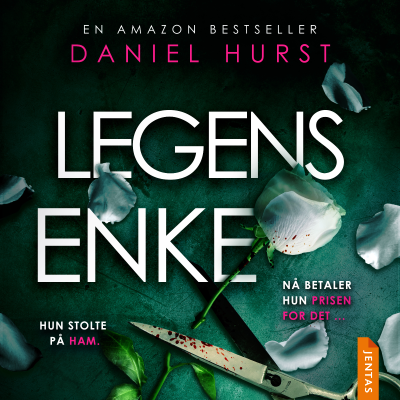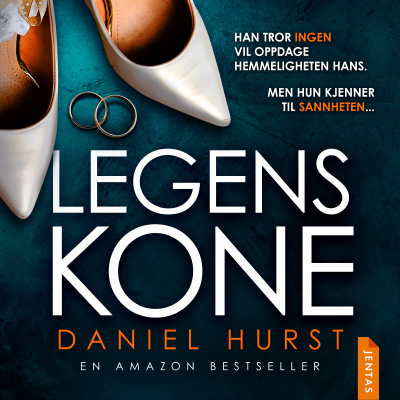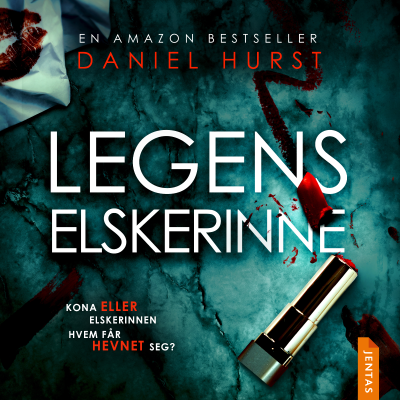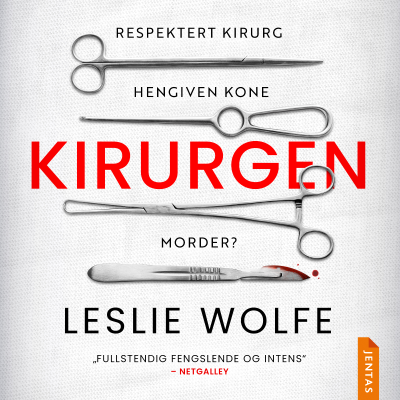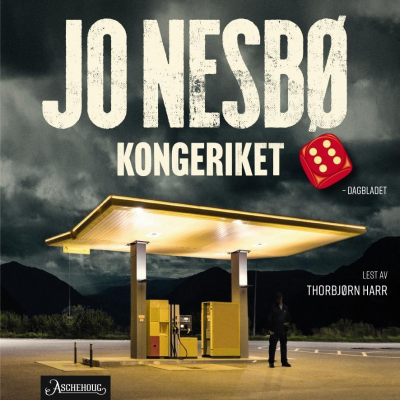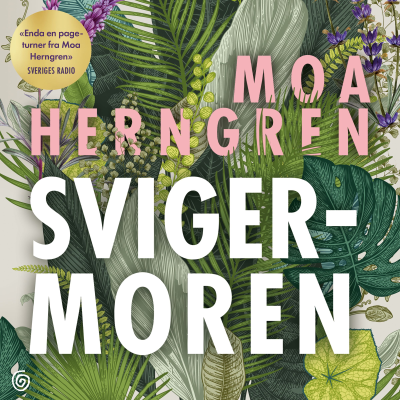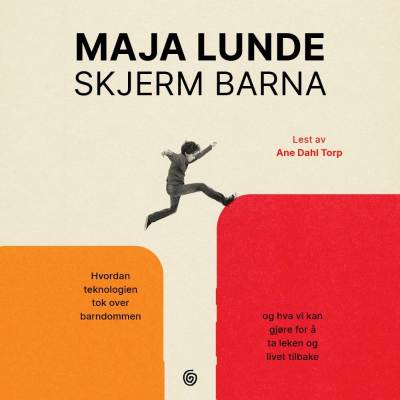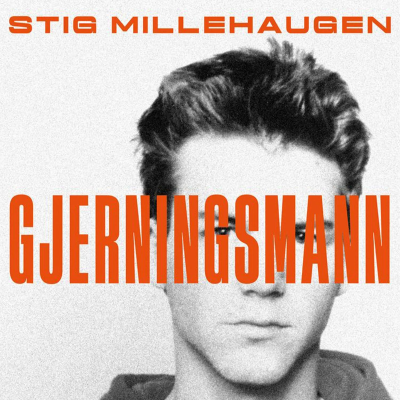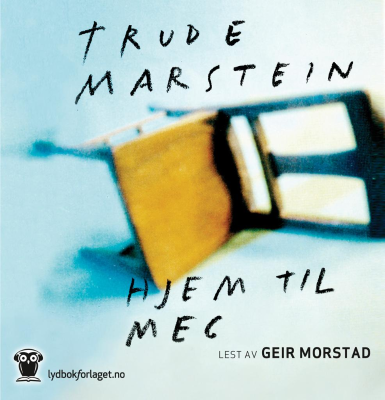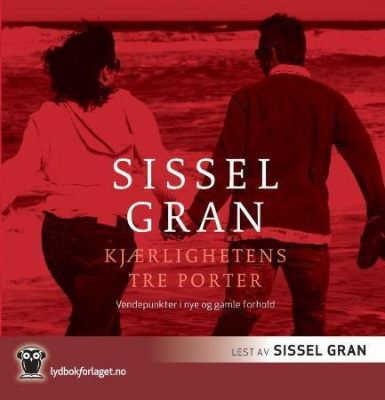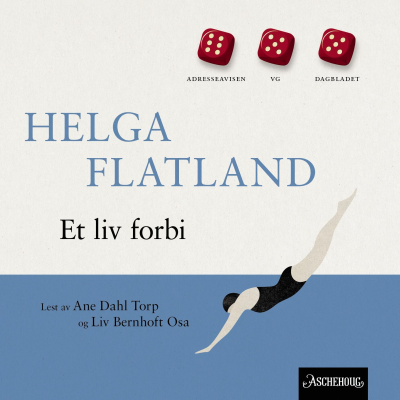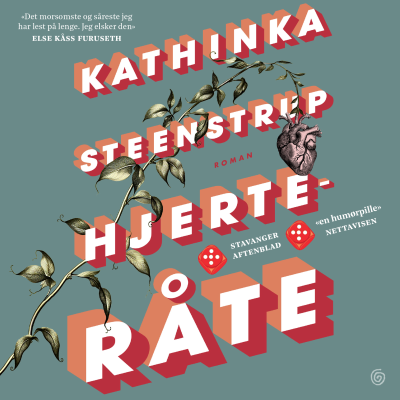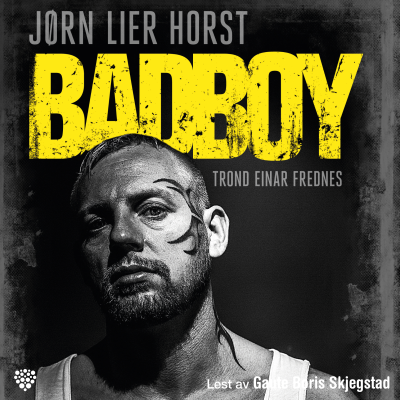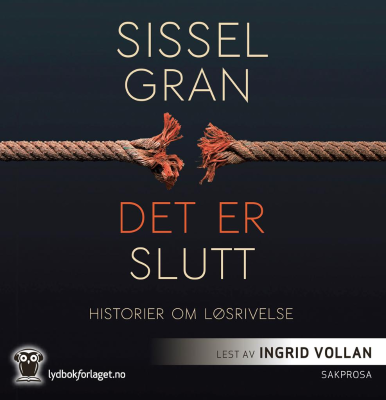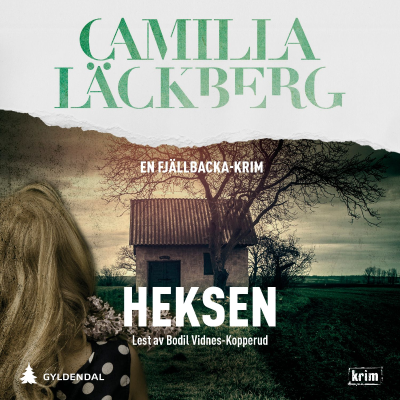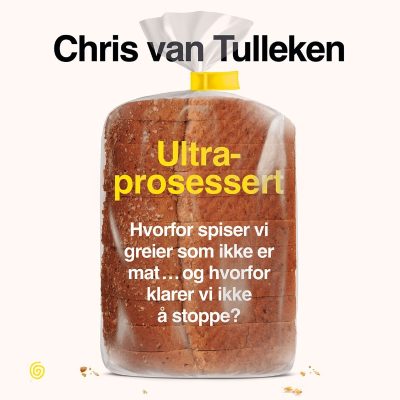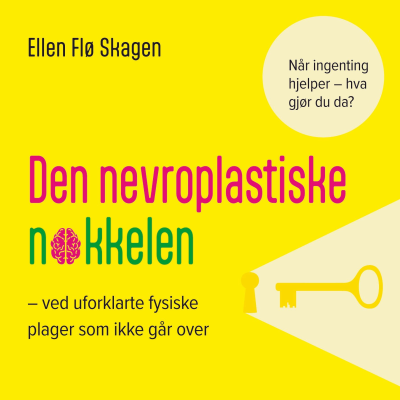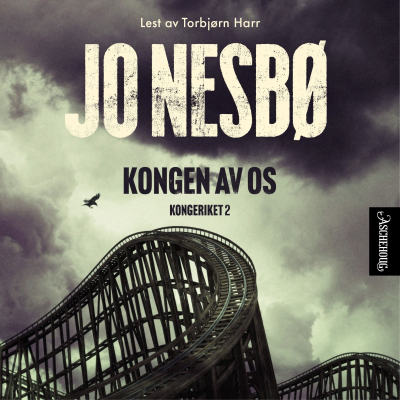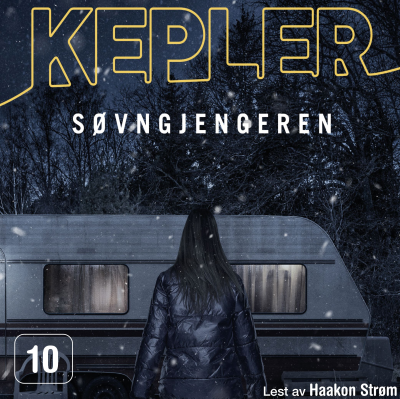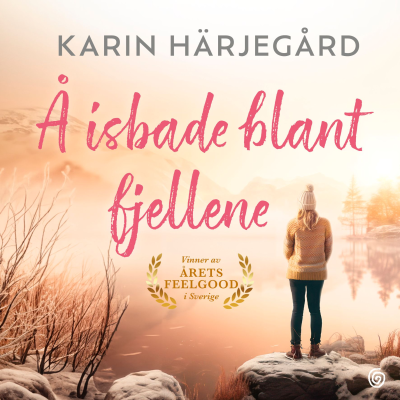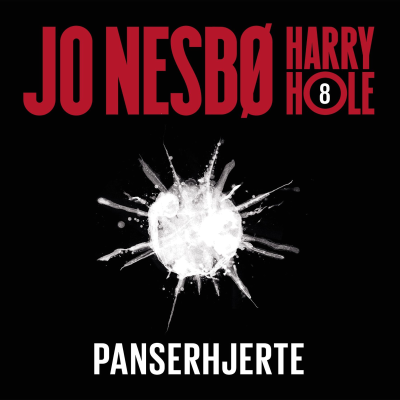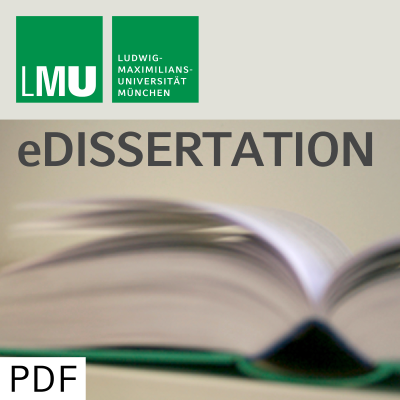
Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07
tysk
Opplysning
Prøv gratis i 14 dager
99 kr / Måned etter prøveperioden.Avslutt når som helst.
- 20 timer lydbøker i måneden
- Eksklusive podkaster
- Gratis podkaster
Les mer Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 07/07
Die Universitätsbibliothek (UB) verfügt über ein umfangreiches Archiv an elektronischen Medien, das von Volltextsammlungen über Zeitungsarchive, Wörterbücher und Enzyklopädien bis hin zu ausführlichen Bibliographien und mehr als 1000 Datenbanken reicht. Auf iTunes U stellt die UB unter anderem eine Auswahl an Dissertationen der Doktorandinnen und Doktoranden an der LMU bereit. (Dies ist der 7. von 7 Teilen der Sammlung 'Tierärztliche Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU'.)
Alle episoder
236 EpisoderSpeziesauswahl in der Neurowissenschaft bei toxikologischen Studien
Um in klinischen Studien die Sicherheit für den Menschen zu gewährleisten, ist es in der Arzneimittelentwicklung im Rahmen der toxikologischen Studien gesetzlich vorgeschrieben, neue Wirkstoffe sowohl am Nager als auch am Nichtnager zu testen (ICH Guideline M3(R2), 2009). Die Zulassungsbehörden fordern die Verwendung der empfindlichsten Spezies (FDA, 2005) für eine gute Übertragbarkeit auf den Menschen. Im Bereich der Neurowissenschaften liegt einer der Schwerpunkte speziell auf der Bewertung von neurologischen Symptomen, da hier Arzneimittel entwickelt werden, die neurologische Symptome behandeln sollen und bei denen auch mit Nebenwirkungen neurologischer Art bei Mensch und Tier zu rechnen ist. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Literatur zum Thema Versuchstierauswahl des Nichtnagers zusammengetragen und eine Übersicht für Hund, Affe, Minipig, Kaninchen und Frettchen erstellt. Hunde (Beagle) und Affen (Cynomolgus) sind bis heute die am häufigsten genutzten Nichtnagerspezies in toxikologischen Studien (Smith & Trennery, 2002) (Jacobs, 2006). Da in der Literatur jedoch keine aussagekräftigen Daten zu finden waren, die einen direkten Vergleich für neurologische Symptome erlaubt hätten, wurde retrospektiv eine interne Datenbasis erstellt. Diese Datenbasis sollte daraufhin evaluiert werden, ob toxikologische Studien retrospektiv den direkten Vergleich zwischen den Spezies ermöglichen. Es wurden 15 Substanzen (Indikationsgebiete Neurowissenschaften und Schmerz) mit 7 Wirkmechanismen und insgesamt 174 toxikologische Studien aus einem Zeitraum von 1995 bis 2013 analysiert. Insgesamt wurden Daten von 1308 Mäusen, 7201 Ratten, 868 Hunden und 758 Affen berücksichtigt. Das Auftreten von neurologischen Symptomen war nicht bei allen Substanzen in beiden Nichtnagerspezies gleich stark, was eine Auswertung über alle Substanzen hinweg nicht gestattete. Für eine Substanz jedoch waren für einen Vergleich neurologische Symptome in beiden Nichtnagerspezies in ausreichender Inzidenz und bei robusten Tierzahlen vorhanden. Symptomgruppen, aber auch einzelne Symptome wie Krämpfe oder Tremor wurden ausgewertet. Wenn sie in Relation zu den Wirkstoffkonzentrationen im Blut gesetzt wurden, schienen bei Betrachtung der totalen Wirkstoffmenge im Blut Hunde leicht empfindlicher. Interessanterweise waren bei Berücksichtigung der freien Wirkstoffmenge im Blut (Cmax free) beide Tierarten ähnlich empfindlich, z.B. für Krämpfe. Spontane Krämpfe bei Kontrolltieren traten weder bei den Hunden noch bei den Affen auf. Die Inzidenz für Krämpfe war bei Hunden und Affen in etwa gleich und eine Geschlechtsdisposition beim Hund wurde in dieser Arbeit nicht beobachtet. Somit kann die Aussage aus der Literatur, der Hund sei empfindlicher für spontane Krampfanfälle (Redman & Weir, 1969) (Bielfelt et al., 1971) (Edmonds et al., 1979) (Easter et al., 2009) (Hasiwa & Bailey, 2011), anhand der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit für substanzinduzierte Krampfanfälle nicht bestätigt werden. Im Einklang mit der Literatur ist das Symptom Tremor besonders hervorzuheben (Lichtfield, 1961) (Fletcher, 1978). Tremor war in der vorliegenden Analyse eins der am häufigsten aufgetretenen Symptome (Hund 16,24%, Affe 13,72%), ist ein relativ objektiv zu beobachtendes Symptom im Tierversuch, war am vergleichbarsten zwischen den beiden Tierspezies aufgetreten und ist daher vermutlich ein wertvoller Vergleichsparameter mit hohem prädiktiven Wert im Hinblick auf den Menschen. Das Erkennen und Bewerten von neurologischen Symptomen in toxikologischen Studien wurde tierartspezifisch diskutiert, genauso wie Abhängigkeit bestimmter Symptome von den Haltungsbedingungen, dem Grad an Erfahrung des tierbetreuenden Personals und dem Vokabular des verwendeten Dokumentationsprogramms. Grenzen der retrospektiven Analyse ergaben sich vor allem durch das Studiendesign, wie z.B. die Evaluierung von Symptomen und Messung der Wirkstoffkonzentrationen in toxikologischen Studien, die nur zu festgelegten Zeitpunkten
Statistische Erhebungen zur Prävalenz röntgenologisch erfassbarer Befunde an der Halswirbelsäule des Pferdes
Impact of aldehyde Dehydrogenase isotypes on xenograft and syngeneic mouse models of human primary glioblastoma multiforme
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common malignant primary brain tumour in adults with a median survival, despite of multimodal aggressive therapy, of only 15 months. Relapse occurs inevitably because of the infiltrative nature of GBM. To date, only the MGMT promoter methylation is a reliable marker for therapy sensitivity. Survival-associated prognostic factors as well as novel therapy targets are urgently needed. Multiple genetic and metabolic pathway alterations contribute to tumour progression and therapy resistance. Recently proposed CSC markers for solid cancers include the aldehyde dehydrogenase (ALDH) superfamily. This cytoplasmic enzyme family consists of 19 different isoforms. The ALDH enzymes act upon oxidative stress and participate in proliferation, differentiation, and cell cycle arrest. The evolutionary conservation of the protein family enables comparative considerations of different species. In the presented study, isotype specific expression of ALDH is analysed in human GBM tumours and in two commonly used mouse GBM models. Expression of ALDH in the mouse models is then compared with the human GBM to find a suitable model for further research. The presented results indicate that there is, though challenging, a necessity for isotype specific analysis of ALDH expression. ALDH1A1 immunohistochemical expression in human PGBM was found primarily in the tumour adjacent region, whereas ALDH1A3 positive cells were more frequently found among tumour cells. Prognostic relevance for PGBM patients’ outcome was found for the ALDH1 immunohistochemical expression. Moreover, female PGBM patients were shown to have prolonged survival if neither ALDH1A1 nor ALDH1A3 expression is present. For male PGBM patients, ALDH1A1 and ALDH1A3 immunohistochemical expression could not be correlated to the medium overall survival. The reasons for this gender difference remain yet undetermined. Both the murine and the human GBM cells analysed in this thesis did not show ALDH1A1 immunohistochemical expression in cell culture or after implantation. The expression of ALDH1A3 is inhomogeneous in the analysed groups, raising further questions, which will be investigated in the future.The investigative approach of this thesis showed that the analysed canine GBM samples express ALDH1A3 but not ALDH1A1. This difference to human PGBM tumours in ALDH expression can help to understand more about the metabolic processes in tumour cells and the reactions to the tumour cells in the surrounding tissue. Finally, there are two particularly promising research subjects for future investigations: the gender specific prognostic power of ALDH expression in PGBM patients and the reason for the change in ALDH1A3 expression between in vitro and in vivo conditions. This knowledge can contribute to finding new targets for PGBM therapy and to prolonging patient survival.
Parasites and vector-borne diseases in client-owned dogs in Albania
Molekular- und populationsgenetische Untersuchungen zur Fruchtbarkeit der Rinderrasse Holstein-Friesian
Hintergrund dieser Arbeit ist die in den letzten Jahrzehnten stetig abnehmende Fruchtbarkeit der Rinderrasse Holstein-Friesian (SILVIA, 1998, PRYCE et al., 2004). Dem Titel entsprechend hat es sich diese Studie zum Ziel gesetzt, Genom-regionen mit Einfluss auf die Fruchtbarkeit durch einen Kartierungsansatz ausfin-dig zu machen. Aufgrund ihres Einflusses auf quantitative Merkmale werden sol-che Regionen auch als Quantitative Trait Loci (QTL) bezeichnet. Bei den in dieser Arbeit untersuchten zehn Fruchtbarkeits- und Kalbemerkmale handelt es sich um die folgenden vom VIT übermittelten Zuchtwerte: Verzögerungszeit für Rinder (VZR) und Kühe (VZK); der Anteil der nicht erneut brünstigen Tiere 56 Tage nach Besamung bei Rindern (NR56R) und Kühen (NR56K); Rastzeit (RZ); Güstzeit (DO); paternaler (direkter) Kalbeverlauf (pKV) für Rinder; maternaler (indirekter) Kalbeverlauf (mKV) für Rinder; paternale Totgeburt (pTG) für Rin-der und maternale Totgeburt (mTG) für Rinder. Die für diese Studie verwendeten 2527 HF Bullen wurden auf BOVINE SNP50 BEADCHIPS (Illumina) genotypisiert. Die eigentliche Kartierung der 29 bovinen Autosomen erfolgte anschließend mit einer kombinierten Kopplungsungleichge-wichts- und Kopplungsanalyse (cLDLA). Hierzu wurde das Genom in 40 SNP umfassende Gleitfenster unterteilt und in jeder Fenstermitte eine Varianzkompo-nentenanalyse durchgeführt. Basierend auf dem cLDLA-Kartierungsansatz wurden insgesamt 90 signifikante lokale Maxima gefunden, die anhand mehrerer Kriterien 50 verschiedenen QTL zugeordnet werden konnten. Einige dieser kartierten Loci bestätigten bereits zuvor publizierte QTL, andere QTL waren neu. Der signifikanteste QTL wurde auf BTA18 in einer Region gefunden, welche bereits durch zahlreiche Autoren als besonders signifikant deklariert wurde. Allerdings befand sich das hier kartierte Maximum (59.179.424 bp) etwa 1,59 Megabasen von der Stelle entfernt, an welcher aufgrund der Ergebnisse früherer Studien aktuell geforscht wird, dem SNP ARS-BFGL-NGS-109285 bei 57.589.121 bp. Nach genauerer Analyse des signifikantesten 40-SNP Fensters konnte ein ‚ursächlicher‘ Haplotyp identifiziert werden, der im weiteren Verlauf als Haplotyp Q1 bezeichnet wird. Dieser Haplotyp ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ursächlich für den QTL, welcher für pKV und pTG im Bereich 55.282.968 60.119.636 bp kartiert wurde. Um den Haplotyp Q1 weiter zu verfeinern, wurden 86 Bullen zusätzlich auf BOVINEHD BEADCHIPS (Illumina) mit wesentlich mehr Markern und dadurch höherer Markerdichte genotypisiert. So konnte der auf BTA18 identifizierte Haplotyp Q1 schließlich auf einen Bereich von 58.280.048 bis 58.819.413 bp eingegrenzt werden. In weiterführenden Analysen, unter anderem in zwei genomweiten Assoziations-studien (GWAS), die keine SNP-Fenster sondern einzelne SNP betrachteten (MLMA#1 und MLMA#2), sowie vier weiteren cLDLAs (MODELL#2 - MODELL#5) auf Chromosom 18, konnte gezeigt werden, dass die gewählte Methode (cLDLA) als Hauptursache für die oben genannte Positionsabweichung gesehen werden kann. Die Ergebnisse der Modelle zeigten, dass der Einfluss des Haplotyps Q1 in der Lage ist, die Effekte bezüglich der Kalbemerkmale im Bereich von 50 bis 60 Megabasenpaaren weitestgehend auszulöschen und nicht der von vielen Forschern für paternalen Kalbeverlauf kartierte SNP ARS-BFGL-NGS-109285 für den Effekt als ursächlich angesehen werden kann. Trotz reger bisheriger Forschung im Bereich dieses SNP konnten erst jüngst vier mögliche kausale Varianten im Bereich um den SNP ARS-BFGL-NGS-109285 identifiziert werden. Da aber in vier sequenzierten HF Bullen mit Haplotyp Q1 keine der Varianten von PURFIELD et al. (2015) entsprechend der Genotypen nachvollzogen werden konnte, können diese nicht als gegenseitige Bestätigung verstanden werden. Unsere Ergebnisse sprechen deutlich für eine weiterhin unbe-kannte Mutation innerhalb des Haplotyps Q1. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die hier in dieser Arbeit dargelegten Ergebnisse wichtige
Velg abonnementet ditt
Premium
20 timer lydbøker
Eksklusive podkaster
Gratis podkaster
Avslutt når som helst
Prøv gratis i 14 dager
Deretter 99 kr / måned
Premium Plus
100 timer lydbøker
Eksklusive podkaster
Gratis podkaster
Avslutt når som helst
Prøv gratis i 14 dager
Deretter 169 kr / måned
Prøv gratis i 14 dager. 99 kr / Måned etter prøveperioden. Avslutt når som helst.