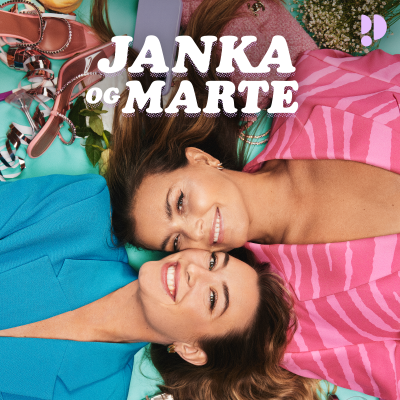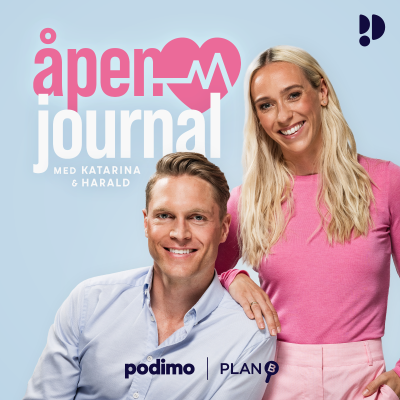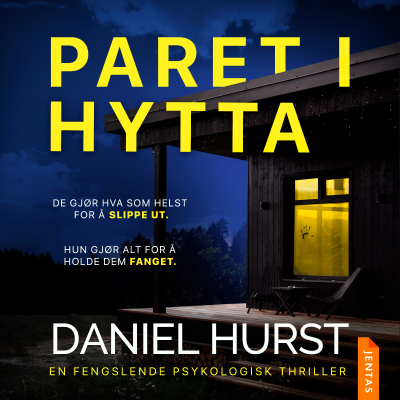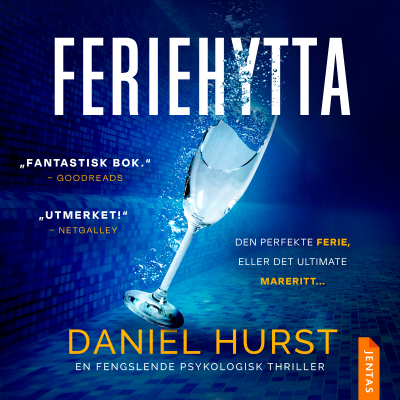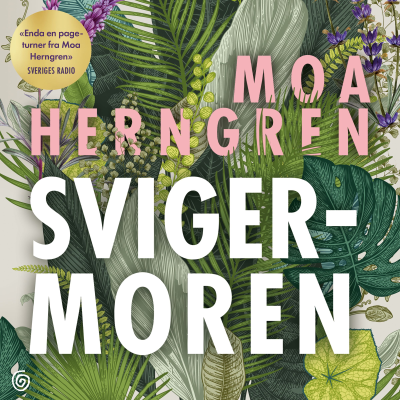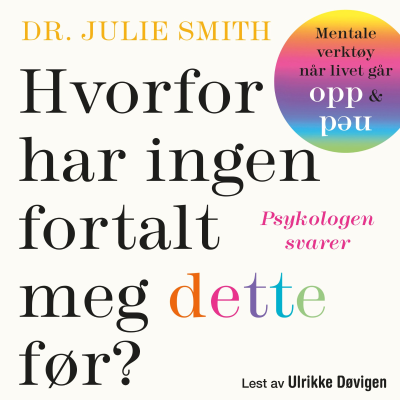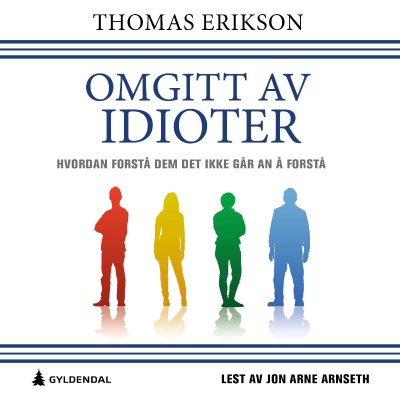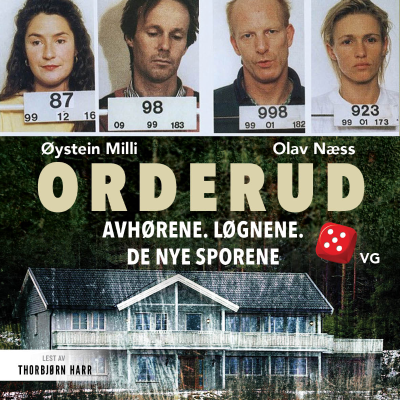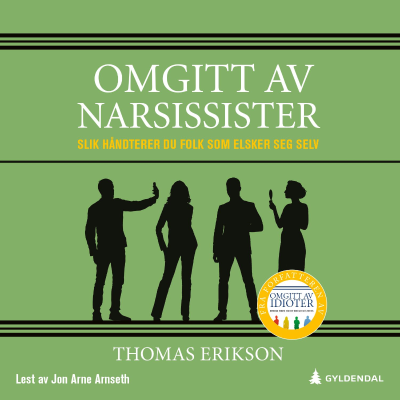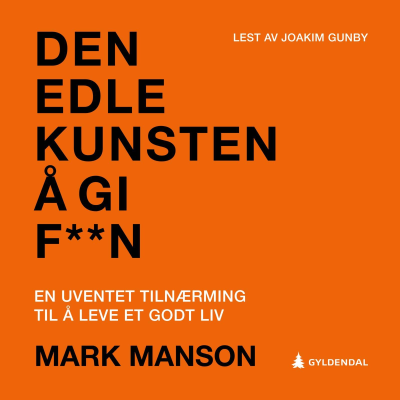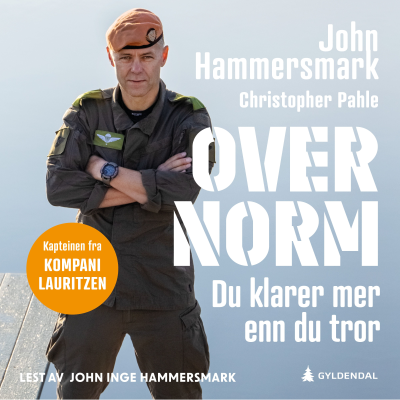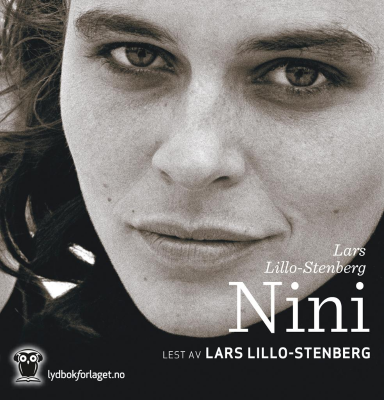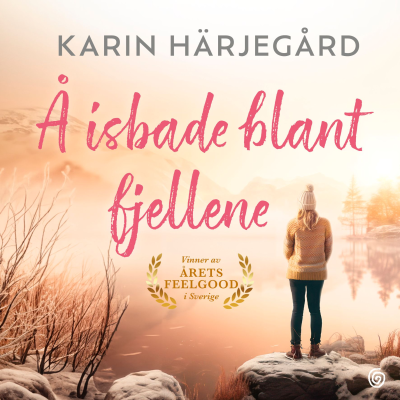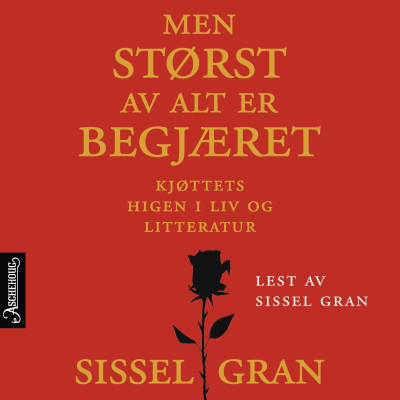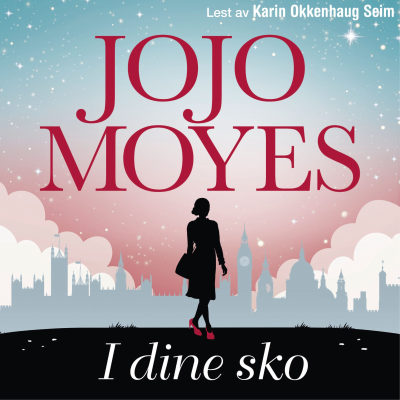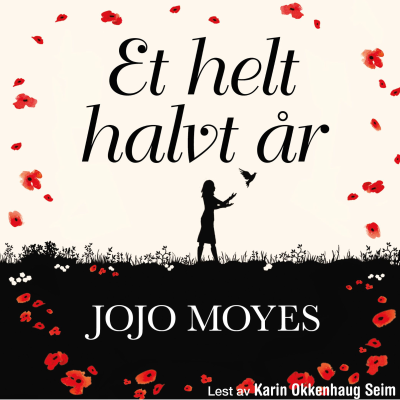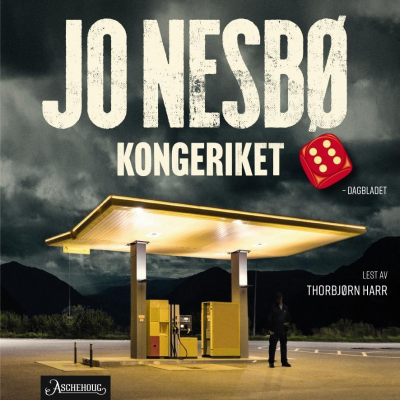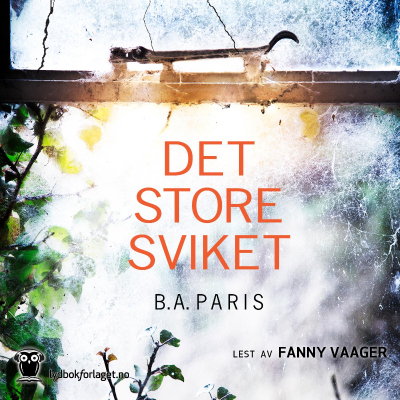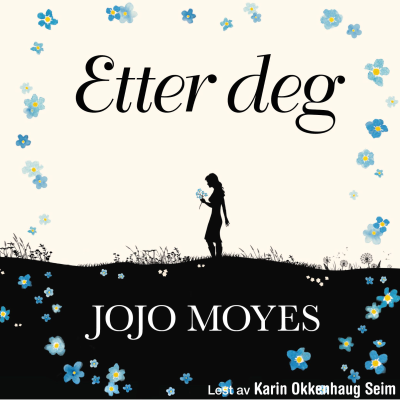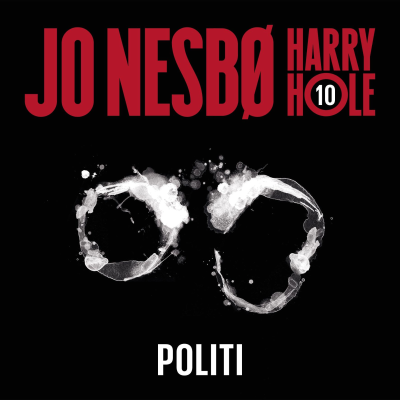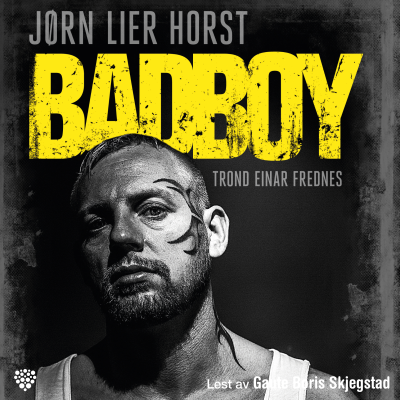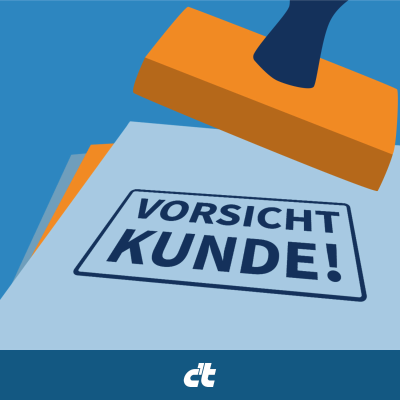
Vorsicht, Kunde!
Podkast av c’t Magazin
Tidsbegrenset tilbud
1 Måned for 9 kr
Deretter 99 kr / MånedAvslutt når som helst.
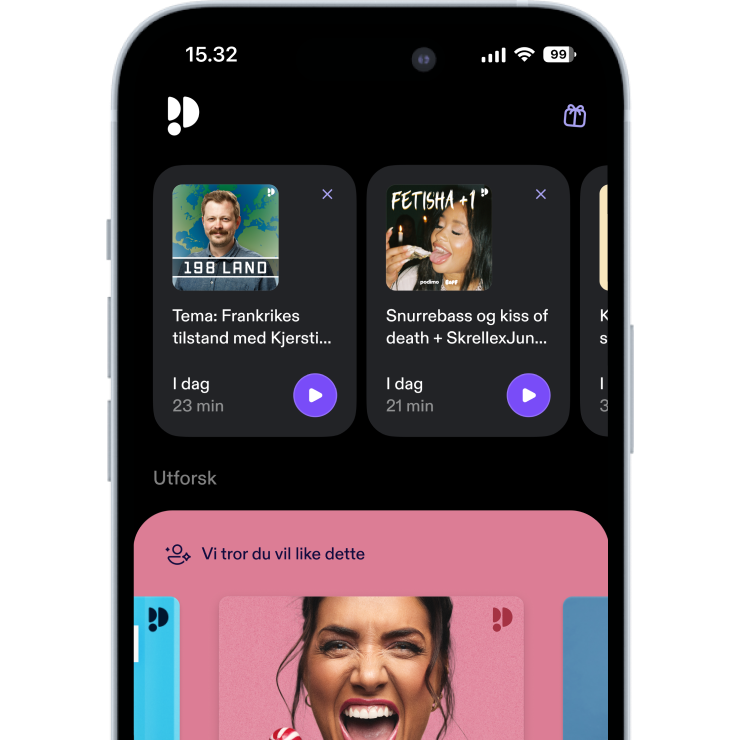
Mer enn 1 million lyttere
Du vil elske Podimo, og du er ikke alene
Vurdert til 4,7 stjerner i App Store
Les mer Vorsicht, Kunde!
Wer einen Vertrag anbietet, ist daran gebunden – einige Unternehmen ignorieren das. Wer ein Gerät zur Reparatur schickt, hätte es gern wieder – manchmal kommt das falsche Gerät zurück. Wer einen Gutschein kauft, möchte ihn auch nutzen können – bei einigen Anbietern keine Selbstverständlichkeit. Im Podcast „Vorsicht, Kunde!“ beleuchtet c’t-Redakteurin Ulrike Kuhlmann einen Konflikt, den ein Kunde ausfechten musste. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Kollegen Urs Mansmann und Rechtsanwalt Niklas Mühleis. Die drei diskutieren die rechtlichen Aspekte und erklären, was euch in solchen und ähnlichen Fällen zusteht. Sie liefern Tipps und praktische Ratschläge, was ihr unbedingt vermeiden solltet und wie ihr euch am Besten verhaltet, um zu eurem Recht zu kommen. „Vorsicht, Kunde“, der Verbraucherschutzpodcast von c’t, alle 14 Tage freitags überall dort, wo es Podcasts gibt.
Alle episoder
40 EpisoderDer Verbraucherschutz-Podcast der c’t In der aktuellen Episode sprechen wir über die Verwaltung von Office-Lizenzen, die Bedeutung von Hersteller-Accounts und die Vor- und Nachteile von Einmallizenz versus Abomodell. Grundlage ist der Fall von Andreas B., der beim Aufräumen seines IT-Kram nicht mehr benötigte Zugänge und Passwörter gelöscht hat, darunter auch einen seiner beiden Microsoft-Konten. Das stellte sich bei einem späteren Notebook-Wechsel als fataler Fehler heraus, denn ebendieser Account war mit seinem Office-Paket verknüpft. Die Bürosoftware hatte B. vor einigen Jahren als dauerhafte Lizenz erworben. Bei dauerhaften Office-Lizenzen kauft man das Produkt einmal und kann es ohne monatliche Kosten unbegrenzt nutzen. Die Lizenz ist jedoch an einen bestimmten PC gebunden. Abo-Modelle wie Office 365 funktionieren anders: Sie sind nutzer- statt gerätebezogen und können auf mehreren Geräten gleichzeitig verwendet werden. Dafür fallen aber regelmäßige Kosten an. Microsoft Office-Lizenzen sind grundsätzlich an einen Microsoft-Account gebunden, sowohl bei dauerhaften Lizenzen als auch bei Abo-Modellen wie Office 365. Diese Verknüpfung dient der Kundenbindung, dem Support und soll Lizenzpiraterie verhindern. Löscht man das Konto, mit dem die Lizenz verknüpft ist, kann der zugehörige Produktschlüssel nicht mehr verwendet werden. Probleme mit Softwarelizenzen regelt seit 2022 Paragraf 327 BGB, darin geht es allgemein um die Haftung und Gewährleistung bei Produktmängeln für digitale Produkte. Die im Online-Handel übliche Beweislastumkehr gilt bei einmaligen Käufen ein Jahr lang, bei dauerhaften Bereitstellungen wie Abo-Modellen dagegen unbegrenzt, erklärt Niklas. Problematisch wird es bei Account-Verknüpfungen: Ob deren unwiderrufliche Bindung einen Integrationsmangel darstellt, ist rechtlich zumindest derzeit umstritten. Im Podcast diskutieren wir die Vor- und Nachteile von Abo- und Einmal-Lizenz-Modell und klären, wie Kunden bei Lizenzproblemen vorgehen können. Der Fall Andreas B.: Schwierige Reaktivierung von Office-Lizenzen bei Microsoft [https://www.heise.de/-10289657] Gesetze § 327 BGB: Verbraucherverträge zur Bereitstellung digitaler Produkte [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__327.html] § 327 e BGB: Produktmangel [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__327e.html] $ 327 k: Beweislastumkehr [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__327k.html] § 305 BGB: Einbeziehung der AGB [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__305.html] § 307 Abs. 2 BGB: Inhaltskontrolle/Unangemessene Benachteiligung [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__307.html]
Der Verbraucherschutz-Podcast der c’t In der aktuellen Episode sprechen wir über die Einspeisevergütung für Solaranlagen und die Probleme, die damit nicht selten einhergehen. Grundlage ist der Fall von Marco H., der eine große Solaranlage installiert hat und seinen selbst produzierten Solarstroms einspeisen möchte. Alles scheint in Ordnung zu sein: Die Installation wurde durchgeführt und bestätigt, alle Formalitäten sind erledigt, doch der Netzbetreiber bleibt die Einspeisevergütung mehr als ein Jahr lang schuldig. Die sogenannte Einspeisevergütung steht Betreibern von anmeldepflichtigen Solaranlagen zu, die ihren selbst produzierten Strom zumindest teilweise ins Netz einspeisen. Besitzer von Balkonkraftwerken gehören nicht dazu, sie erhalten kein Geld für eventuell eingeleiteten Strom. Während der Netzanbieter für die Einspeisung rund 10 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, müssen Kunden für den Strom vom Stromanbieter mindestens 30 Cent zahlen. Deshalb rechnet es sich, auch den Strom aus größeren Solaranlagen zunächst möglichst selbst zu nutzen und nur Überschüsse einzuleiten. Dass sich die Bearbeitung im Fall von Marco H. immer wieder verzögert hat, schiebt der Netzbetreiber auf die ungewöhnlich hohe Anzahl an Neuanmeldungen. Das lässt Urs nicht gelten. Der Netzbetreiber hätte ausreichend Ressourcen bereitstellen müssen, um die Nachfrage in angemessener Zeit zu bewältigen, fordert er. Wenn die Einspeisevergütung zu spät ausgezahlt wird, stehen Kunden ab dem Tag nach der ersten ausgefallenen Zahlung Verzugszinsen zu. Die Höhe hängt vom Basiszinssatz ab: Von einer 15 Monate verzögerten monatlichen Zahlung in Höhe von 38 Euro – das war die Vergütung für Marco H. – wären laut Niklas über 60 Euro Verzugszinsen fällig. Die technische Inbetriebnahme und die formelle Anmeldung gehen Hand in Hand, doch sobald der Netzbetreiber den PV-Strom abnimmt, entsteht die Pflicht zur Zahlung, erklärt Niklas. Im Podcast diskutieren wir, wie Verbraucher gegen Netzbetreiber vorgehen können, um ihre Forderungen durchzusetzen. Außerdem geht es um den Inselbetrieb von Photovoltaikanlagen und warum PV-Betreiber dabei sicherstellen müssen, dass kein Strom ins Netz fließt. Der Fall Marco H.: Vorsicht Kunde: Netzbetreiber EAM bleibt Solarvergütung schuldig [https://www.heise.de/-10289657] Gesetze §3, Nr. 30 EEG, Inbetriebnahme [https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__3.html] § 8 EEG: Anschluss [https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__8.html] § 11 EEG: Abnahme, Übertragung und Verteilung [https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__11.html] § 12 EEG, Pflichten des Netzbetreibers, Netzinfrastruktur [https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__12.html] § 53 EEG Verringerung der Einspeisevergütung [https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__53.html]
Der Verbraucherschutz-Podcast der c’t In der aktuellen Episode sprechen wir über Probleme beim Paketversand, insbesondere wenn Pakete verloren gehen. Niklas klärt über die Rechte von Sender und Empfänger und die Pflichten des Transportdienstleisters auf: Wer kann einen Nachforschungsantrag stellen, wie lange hat der Paketdienstleister Zeit, auf eine Verlustmeldung zu reagieren und wer haftet bei Verlusten? Wer bei einem missglückten Versand haftet, hängt vom sogenannten Gefahrübergang ab. Verkaufen Unternehmen eine Ware an private Verbraucher, sind sie bis zur Zustellung der Ware für die Sendung zuständig. Bei Geschäften zwischen Privatleuten endet die Haftung des Versenders dagegen mit Übergabe des Pakets an den Versanddienstleister. Urs rät dringend dazu, die zu versendende Ware sicher zu verpacken, damit sie beim Transport auch mal rauer behandelt werden kann. Außerdem empfiehlt er, sich Sendungen an einen Paketshop schicken zu lassen statt nach Hause, oder aber eine Abstellgenehmigung am Haus zu erteilen. Ulrike weist darauf hin, dass die Pakete dann nicht mehr versichert sind, sobald der Lieferdienst sie abgelegt hat. Sie bevorzugt deshalb eine Packstation, bei Niklas nehmen stattdessen die Nachbarn alle Sendungen entgegen. Geht ein Paket verloren, sollte man einen Nachforschungsantrag stellen und in diesem alle nötigen Fakten zum verschickten Inhalt nennen, also was ist drin, welchen Wert hat die Ware, wann wurde sie verschickt und mit welcher Liefernummer quittiert. Außerdem sollte man alle Belege anhängen, eine Frist setzen und gegebenenfalls Schadensersatzansprüche geltend machen. Wie man beim Paketdienst effektiv sein Recht einfordert, welche Fristen beim Paketversand und der Verlustklärung angemessen sind und was es mit der Bring-, Hol- und Schickschuld auf sich hat, klären wir Podcasts. Der Fall Andreas K.: Vorsicht Kunde: Lange Reaktionszeiten bei DPD [https://www.heise.de/-10289657] Gesetze und Verordnungen: § 446 Gefahr- und Lastenübergang [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__446.html] § 447 BGB Gefahrübergang beim Versendungskauf [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__447.html] § 475 Abs. 2 BGB Verbrauchsgüterkauf: Gefahr des zufälligen Untergangs [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__475.html] § 823 Absatz 1 BGB Schadensersatzpflicht [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__823.html]
Der Verbraucherschutz-Podcast der c’t Ein verlockendes Angebot im Rahmen einer Kundenrückgewinnung, eine mündliche Zusage am Telefon und am Ende gilt der versprochene Rabatt doch nicht. Was passiert, wenn die mündlichen Absprachen später in der Vertragszusammenfassung fehlen und wie verbindlich sind mündlichen Zusagen überhaupt? Grundsätzlich gilt in Deutschland Vertragsfreiheit, erklärt Niklas. Ein Vertrag kann mündlich, schriftlich oder sogar rein durch schlüssiges Verhalten wie täglich beim Brötchenkauf zustande kommen. Nur wenige Verträge wie Miet- oder Arbeitsverträge und notarielle Beurkundungen benötigen die Schriftform. Eine mündliche Zusage am Telefon ist demnach bindend, doch kommt es zum Streit, steht Aussage gegen Aussage. Deshalb solltet ihr die schriftliche Vertragszusammenfassung der mündlichen Vereinbarung, die ein Anbieter nach einem Telefonat schickt, sofort prüfen. Falls sie nicht mit der mündlichen Absprache übereinstimmt, solltet ihr möglichst schnell schriftlich reklamieren und dem Anbieter eine kurze Frist zur Korrektur setzen. Dabei ist es wichtig, das gesetzliche Widerrufsrecht im Auge zu behalten. Wer zu lange auf Korrekturen wartet, verliert diese einfache Möglichkeit, aus dem Vertrag auszusteigen und steckt im Beweisdilemma, warnt Niklas. Urs vermutet hinter den vagen Aussagen von Kundenservices oft Systemprobleme: Was im System nicht vorgesehen ist, kann der Mitarbeiter auch nicht eingeben. Für den Kunden ist das jedoch unerheblich. Niklas bringt mal wieder seine Lateinkenntnissen an, die Ulrike leider fehlen. "Pacta sunt servanda" bedeutet im Zivilrecht "Verträge sind einzuhalten". Dass in einigen Fällen §164 BGB weiterhilft und wieso der Gesprächspartner sich nicht mit einem Hinweis auf Datenschutz aus der Affäre ziehen kann, besprechen wir im Podcast. Der Fall Martin K.: O2 verweigert Rabatt für DSL-Anschluss [https://www.heise.de/-10491460] Gesetze und Verordnungen: § 164 BGB: Vertretungsmacht bei Stellvertretung [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__164.html] § 355 BGB: Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__355.html] Artikel 15 DSGVO: Auskunftsrecht der betroffenen Person [https://dejure.org/gesetze/DSGVO/15.html] § 59 Telekommunikationsgesetz (TKG): Anbieterwechsel und Rufnummernmitnahme [https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2021/__59.html]
Der Verbraucherschutz-Podcast der c’t Wer mehr über den eigenen Stromverbrauch erfahren möchte und diesen flexibel auf die jeweils aktuellen Strompreise anpassen kann, braucht ein Smart Meter. Solche intelligenten Messstellen erfassen den Verbrauch im Viertelstundentakt und übermitteln die Daten zum Messstellenbetreiber, der sie an den örtlichen Netzbetreiber und der wiederum an den Stromanbieter weiterreicht. Seit diesem Jahr haben Kunden Anspruch auf ein intelligentes Messsystem: Theoretisch muss es auf Wunsch innerhalb von vier Monaten eingebaut werden. In der Praxis scheitert das aber oft daran, dass die Messstellenbetreiber beziehungsweise die von ihnen beauftragten Handwerksbetriebe nicht mit der Installation, der Einbindung ins Netzwerk und der Anmeldung hinterherkommen. Die Installation funktioniert meist noch, denn die kann jeder Elektriker übernehmen. Problematischer ist schon die Netzwerkanbindung, und bei der Kommunikation der beteiligten Unternehmen untereinander geht das meiste schief, berichtet Urs. Hat man mit dem Energieversorger einen Vertrag über einen dynamischen Stromtarif abgeschlossen, bietet dieser oft einen preislich interessanten Übergangstarif an. Der sollte nicht an einen festen Ablauftermin geknüpft sein, sondern bis zur Einrichtung des Smart Meters und der Umstellung auf den neuen Tarif läuft, rät Niklas. Dauert der Wechsel dann länger und entstehen dadurch zusätzliche Kosten, können Kunden Schadensersatz nach §280 BGB einfordern. Die Bundesnetzagentur hält auf ihrer Webseite Vorlagen für Beschwerden bereit. Der Einbau des Smart Meter darf bei einem Stromverbrauch von unter 6000 kWh pro Jahr maximal 100 Euro kosten. Hinzu kommen jährliche Betriebskosten, die zwischen 30 und 50 Euro liegen. Höhere Installationskosten muss der Messstellenbetreiber sehr genau begründen. Das gilt aber nur, wenn man den grundzuständigen Messstellenbetreiber beauftragt hat, warnt Urs. Überlässt man den Einbau einem anderen Unternehmen, etwa dem Installateur der Photovoltaikanlage, sollte man den Kostenvoranschlag sehr genau daraufhin prüfen. Außerdem kommen oft weitere Kosten hinzu, etwa wenn ein neuer Zählerkasten eingebaut werden muss oder es an Ort und Stelle weder WLAN noch Ethernet gibt. Weil sich aus den erfassten Energiedaten einige sehr persönliche Dinge ableiten lassen, prüft und zertifiziert das Bundesamt für Sicherheit in der In¬formationstechnik (BSI) sowohl Geräte als auch Betreiber. Wer die personenbezogenen Daten verarbeiten darf, beschreibt das Messstellenbetriebsgesetz. Der Fall Martin B.: Octopus Energy vergeigt Smart-Meter-Installation [https://www.heise.de/-10474248] Gesetze, Regelungen, Vorlagen: § 21 Messstellenbetriebsgesetz: Mindestanforderungen an intelligente Messsysteme [https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/__21.html] § 49 MsbG: Verarbeitung personenbezogener Daten [https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/__49.html] § 14a EnWG: Netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen [https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__14a.html] Artikel 25, DSGVO: Datenschutz durch Technikgestaltung [https://dejure.org/gesetze/DSGVO/25.html] Artikel 32, DSGVO: Sicherheit der Verarbeitung [https://dejure.org/gesetze/DSGVO/32.html] Broschüre der Bundesnetzagentur zu intelligenten Messsystemen [https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Metering/Flyer_iMSys.pdf?__blob=publicationFile&v=1] Vorlagen der BSI für Beschwerden [https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/BeschwerdeSchlichtung/start.html]
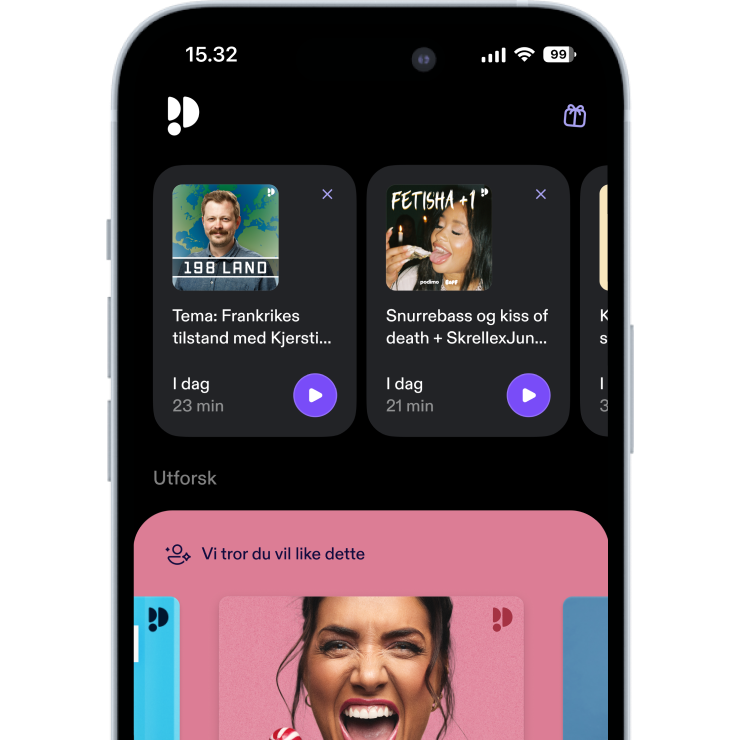
Vurdert til 4,7 stjerner i App Store
Tidsbegrenset tilbud
1 Måned for 9 kr
Deretter 99 kr / MånedAvslutt når som helst.
Eksklusive podkaster
Uten reklame
Gratis podkaster
Lydbøker
20 timer i måneden