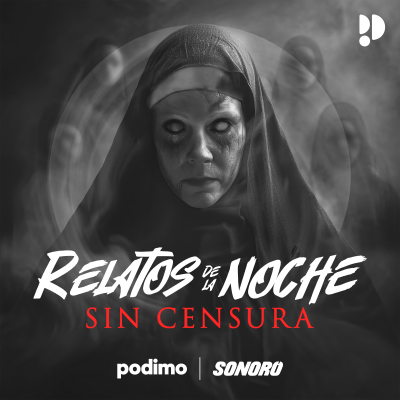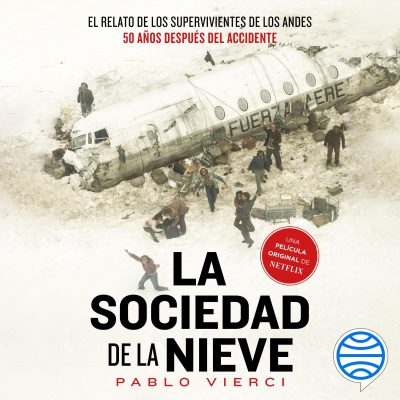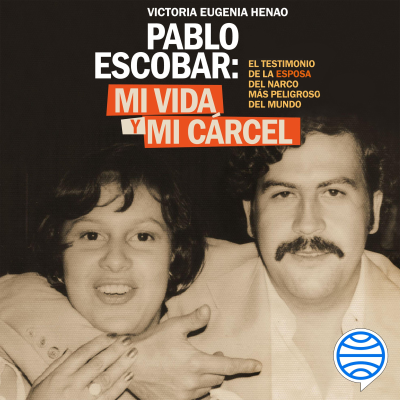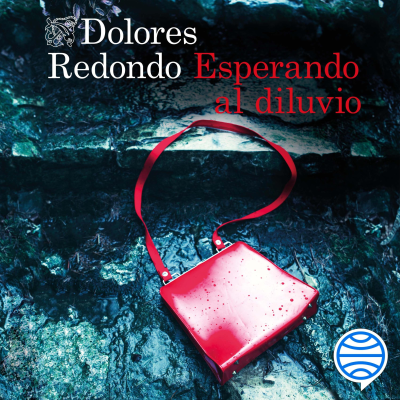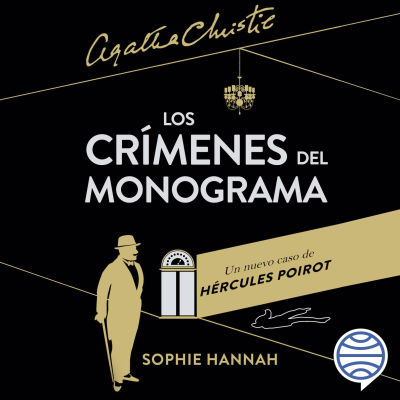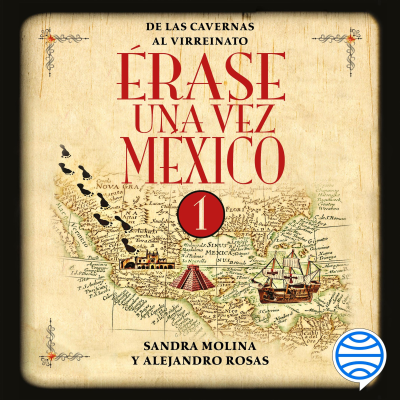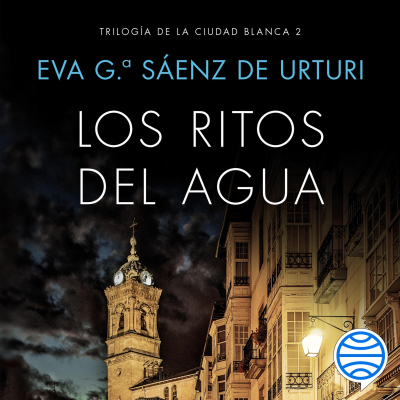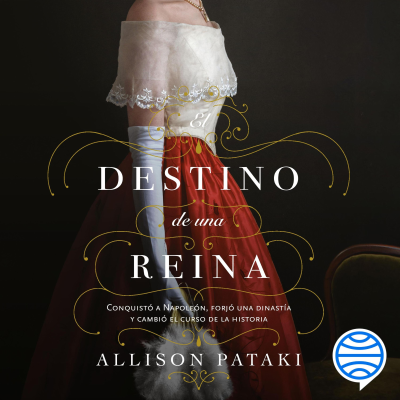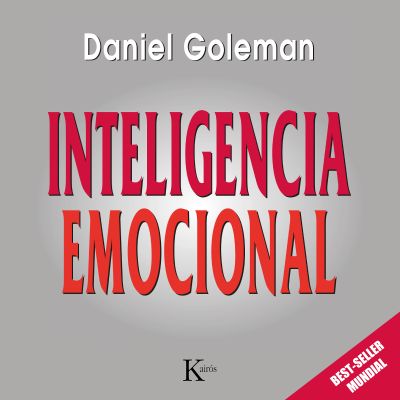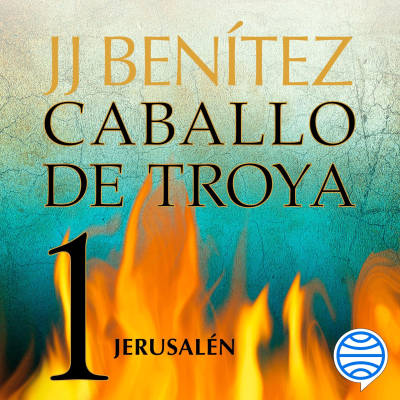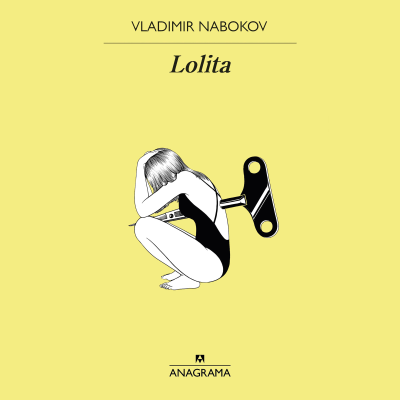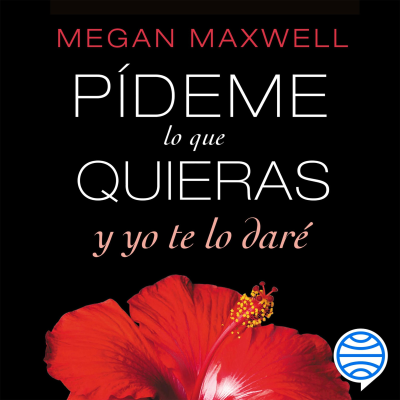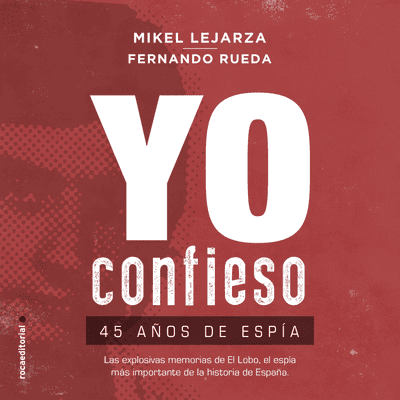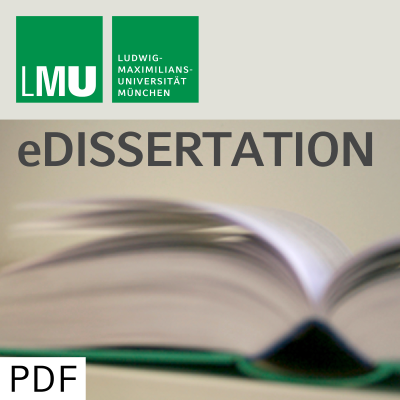
Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
German
Health & personal development
Limited Offer
2 months for 19 kr.
Then 99 kr. / monthCancel anytime.
- 20 hours of audiobooks / month
- Podcasts only on Podimo
- All free podcasts
About Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU - Teil 08/19
Die Universitätsbibliothek (UB) verfügt über ein umfangreiches Archiv an elektronischen Medien, das von Volltextsammlungen über Zeitungsarchive, Wörterbücher und Enzyklopädien bis hin zu ausführlichen Bibliographien und mehr als 1000 Datenbanken reicht. Auf iTunes U stellt die UB unter anderem eine Auswahl an Dissertationen der Doktorandinnen und Doktoranden an der LMU bereit. (Dies ist der 8. von 19 Teilen der Sammlung 'Medizinische Fakultät - Digitale Hochschulschriften der LMU'.)
All episodes
250 episodesAnalyse der Schlafstruktur mittels zyklisch alternierendem Muster bei Patienten mit Narkolepsie und REM-Schlaf-Verhaltensstörung im Vergleich zu einer schlafgesunden Kontrollgruppe
Die Suche nach Inhibitoren der Histonmethyltransferase Su(var)3-9 aus Drosophila melanogaster
Stoßwellentherapie bei Induratio penis plastica
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Evaluation der Therapieergebnisse nach ESWT bei Patienten mit erworbener IPP. Im Gegensatz zu bisher publizierten Studien wurde insbesondere die im Rahmen der Erkrankung auftretenden psychosozialen Beeinträchtigungen des Patienten und seiner Partnerin, die Auswirkungen der Erkrankung auf die partnerschaftliche Beziehung sowie eine mögliche Beeinflussung dieser Effekte durch die ESWT untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Anwendung der Stoßwellentherapie bei IPP zu einer signifikanten Reduktion der Schmerzintensität führt und dadurch die psychische Beeinträchtigung der Patienten verringert werden kann. Diese Beobachtung geht mit einer signifikanten Steigerung der Geschlechtsverkehrsfrequenz einher und bewirkte eine messbare Verbesserung der partnerschaftlichen Beziehungsqualität. Hingegen zeigte sich keine signifikante Beeinflussung von Plaquegröße, Deviation und erektiler Funktion durch die ESWT. Diese Beobachtungen entsprechen der aktuellen Studienlage. Die IPP stellt in der männlichen Bevölkerung eine seltene Erkrankung dar. Ebenso wie zahlreiche publizierte Studien weist auch das dieser Arbeit zugrunde liegende Patientenkollektiv eine geringe Fallzahl auf, welche die Aussagekraft der Ergebnisse einschränkt. Darüber hinaus befanden sich viele der untersuchten Patienten zum Behandlungszeitpunkt in einer relativ späten Erkrankungsphase. Die beobachtete Schmerzreduktion könnte daher auch durch den natürlichen Krankheitsverlauf der IPP bedingt sein. Weiterhin konnte aufgrund des retrospektiven Studiendesigns keine Vergleichsgruppe zur Beurteilung hinzugezogen werden. Eine definitive Effektzuschreibung zur ESWT ist daher nicht sicher möglich. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass die ESWT eine minimalinvasive, nebenwirkungsarme und kostengünstige Methode zur Behandlung der IPP darstellt. Auf der Basis einer effektiven Schmerzreduktion gelingt durch ihren Einsatz die signifikante Verbesserung der psychosozialen Situation von Patient und Partnerin.
Bedeutung frühkindlicher Ernährungsfaktoren bei Kindern mit einem erhöhten Typ 1 Diabetes Risiko
In vivo Validierung eines neuen Verfahrens zur Pulsoxymetrie im niedrigen Sauerstoffsättigungsbereich
Ziel der vorliegenden tierexperimentellen Studie an narkotisierten neugeborenen Hausschweinen war die in vivo Validierung eines neuen technischen Konzepts zur Pulsoxymetrie im niedrigen Sauerstoffsättigungsbereich. Bei dem neuen Reflexions-Pulsoxymeter (REOX) erlauben zwei Sensoren-Paare aus Licht emittierender Diode und Photodiode in Kombination mit einem neuen Berechnungsverfahren die Bestimmung der Lichtabschwächung durch das Gewebe, die für die zunehmende Ungenauigkeit der Pulsoxymetrie im Bereich unterhalb von 70% Sauerstoffsättigung mit verantwortlich gemacht wird. Es wurden 17 neugeborene gesunde Hausschweine in Allgemeinanästhesie mit einem hypoxischen Gasgemisch aus Raumluft und Stickstoff beatmet und so die inspiratorische Sauerstofffraktion (FiO2) schrittweise von 21% bis auf 1,25% reduziert. In jeder Absättigungsstufe wurden die Messwerte des neuen Sensors simultan mit denen eines Standard- Pulsoxymeters und der Near infrared spectroscopy (NIRS) registriert. Als Referenz wurde bei jeder Messung eine Blutprobe aus der Arteria femoralis entnommen. Die Lichtabschwächung konnte mit dem neuen Verfahren berechnet werden und unterschied sich signifikant an unterschiedlichen Applikationsorten. Im Vergleich mit der Standard-Pulsoxymetrie zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Messgenauigkeit mit der Reflexionspulsoxymetrie (REOX). Die vorliegende Studie zeigt ebenfalls, dass bereits der experimentelle Aufbau des neuen Pulsoxymetriesensors (REOX) bei der Bestimmung der arteriellen Sauerstoffsättigung der Bestimmung des Anteils oxygenierten Hämoglobins im Gewebe durch die near infrared spectroscopy (NIRO-300) überlegen ist.
Choose your subscription
Limited Offer
Premium
20 hours of audiobooks
Podcasts only on Podimo
All free podcasts
Cancel anytime
2 months for 19 kr.
Then 99 kr. / month
Premium Plus
Unlimited audiobooks
Podcasts only on Podimo
All free podcasts
Cancel anytime
Start 7 days free trial
Then 129 kr. / month
2 months for 19 kr. Then 99 kr. / month. Cancel anytime.