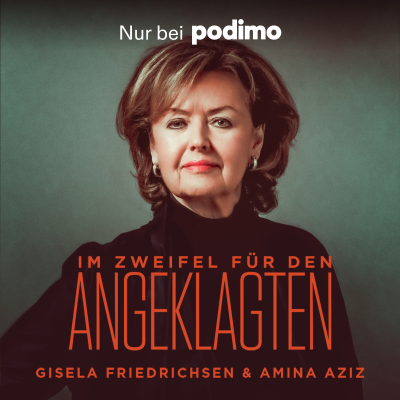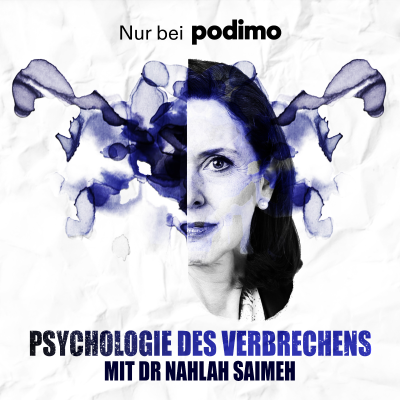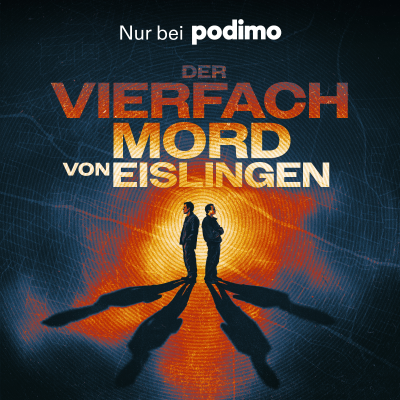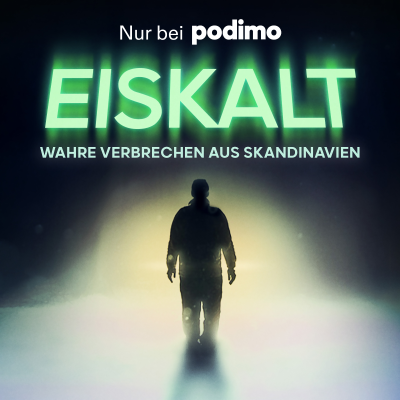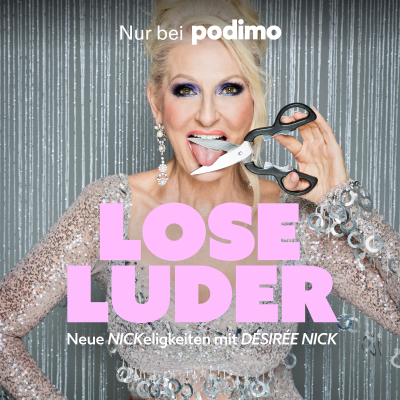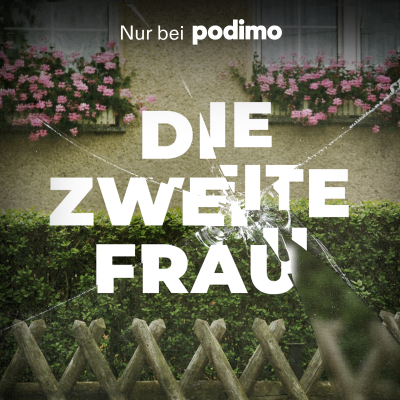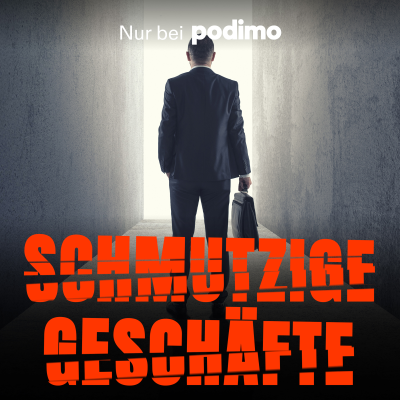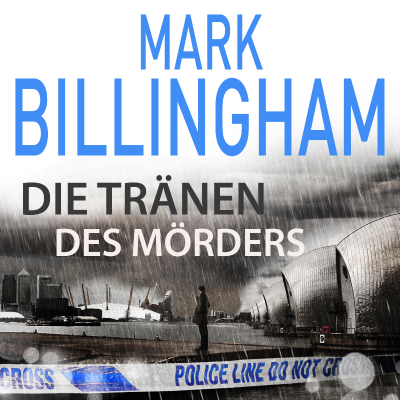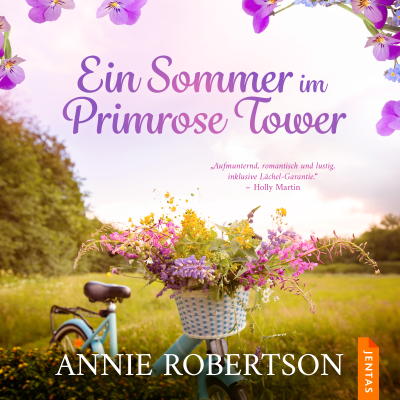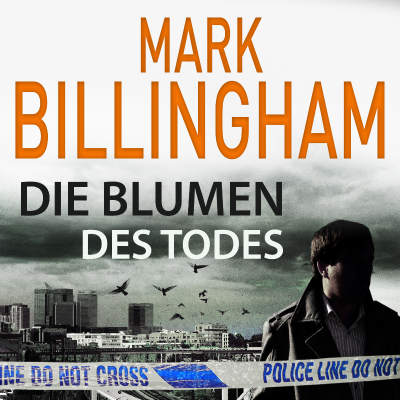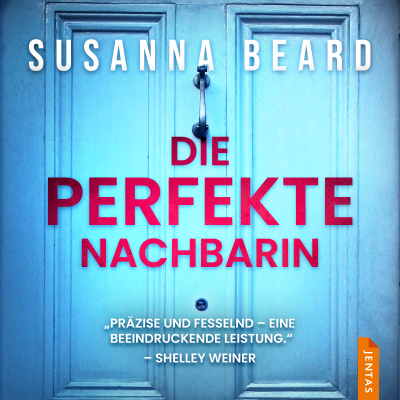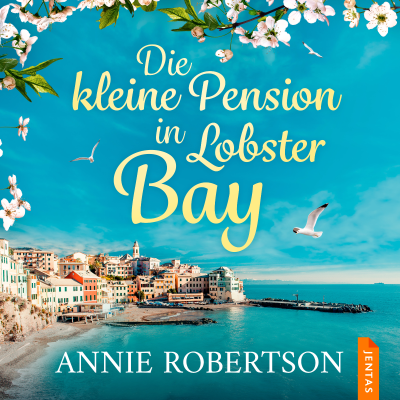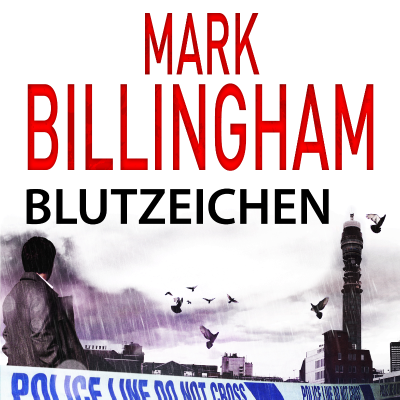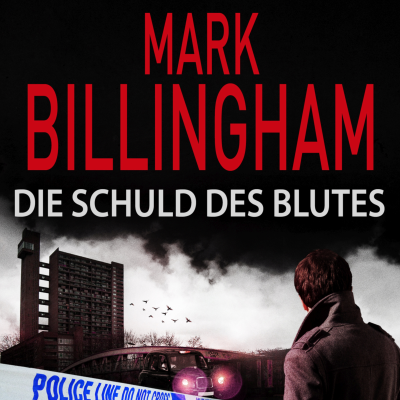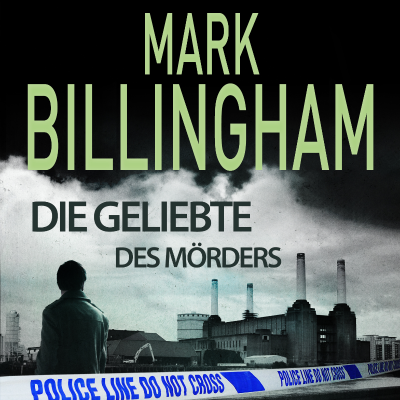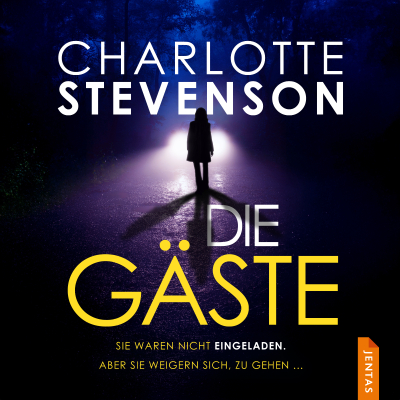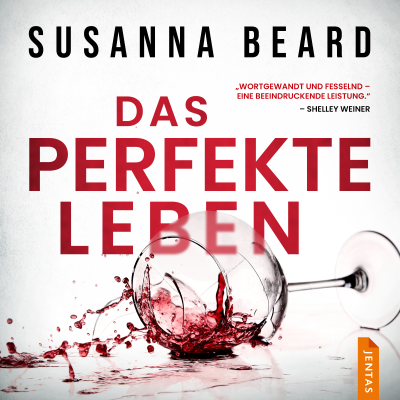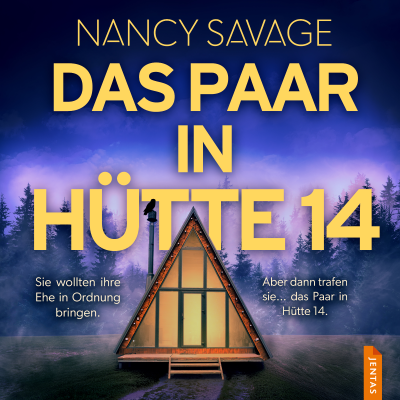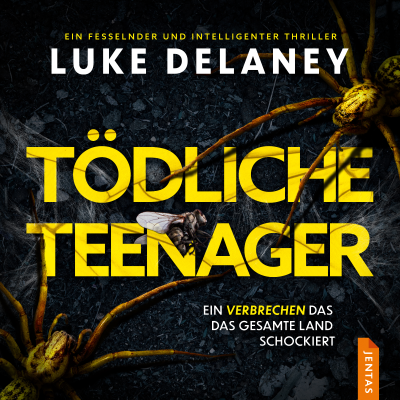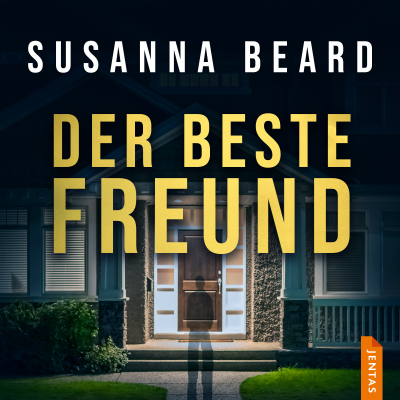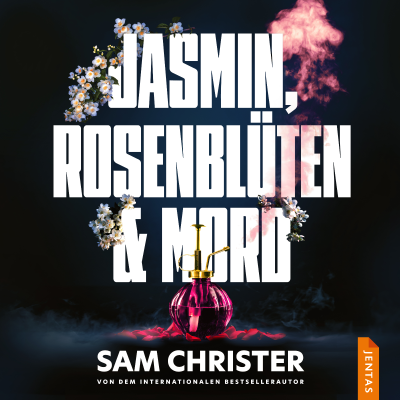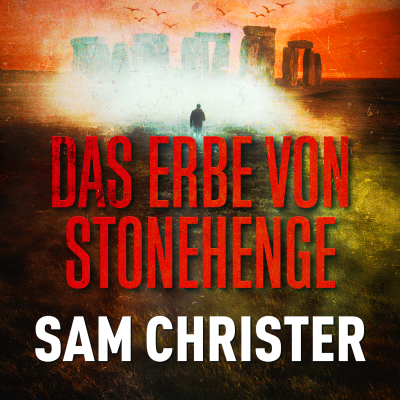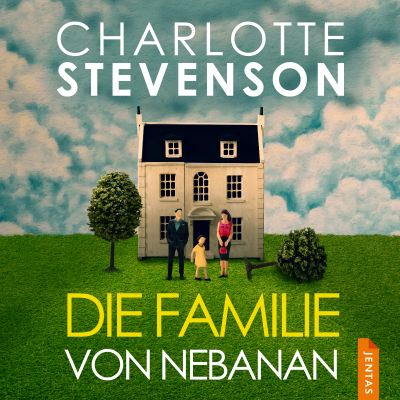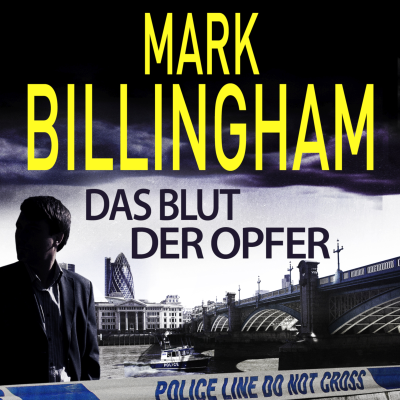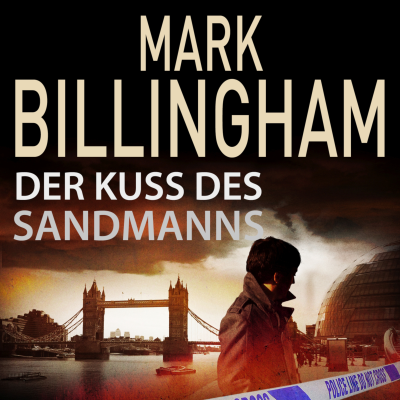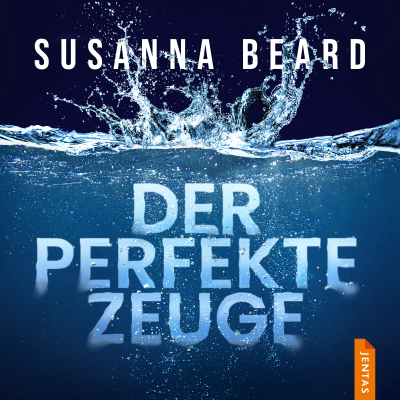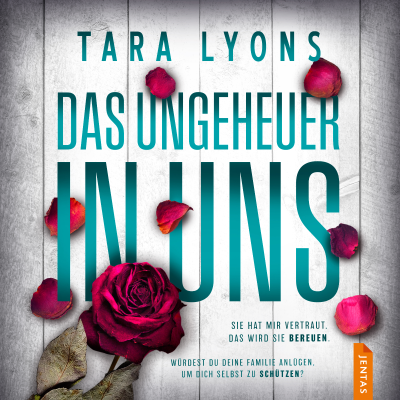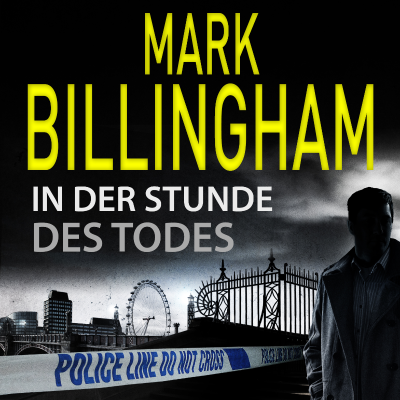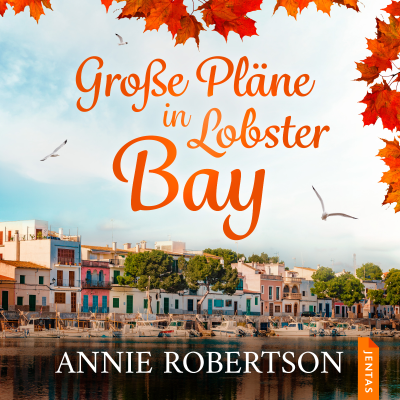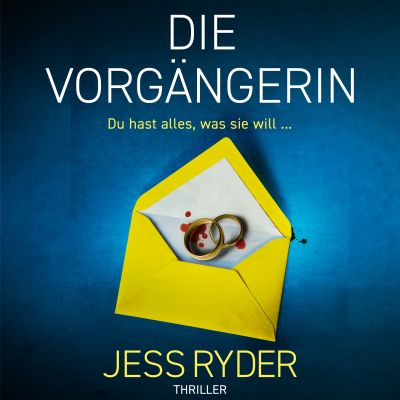Wissenschaft Veränderung
Deutsch
Kostenlos bei Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr Wissenschaft Veränderung
Ein Klick, unendliche Möglichkeiten! »Wissenschaft Veränderung – der Podcast zur digitalen Transformation« ist dein Kompass durch das grenzenlose Feld neuer Technologien und Innovationen. In lehrreichen Gesprächen über alles, was den digitalen Wandel vorantreibt, lernst du Innovator:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft kennen. Welche Rolle spielt ihre Arbeit für den Fortschritt? Drück auf Play und sei dabei, wenn es heißt: Wissen schafft Veränderung. Dieser Podcast ist ein Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastian Fischer, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
Alle Folgen
18 Folgen#17 Multimodale KI: Wenn der Chatbot auch Bilder und Tabellen liest
Firmen-Chatbots sollen auf Knopfdruck das gesamte Unternehmenswissen zugänglich machen. Doch die meisten sind blind für alles, was kein reiner Text ist: Prozessdiagramme, Bilder und Tabellen werden ignoriert. Die Folge: unvollständige oder nutzlose Antworten. In dieser Folge sprechen wir mit Richard Zimmermann, der sich in seiner Bachelorarbeit genau dieser Herausforderung gestellt hat. Er erklärt, wie man mit dem Ansatz der "Retrieval-Augmented Generation" (RAG) einem Sprachmodell beibringt, auch multimodale Daten zu verstehen und zu nutzen. Wir tauchen tief in die Technik ein und klären, warum es nicht nur darum geht, der KI Daten zu geben, sondern auch darum, ihr die richtigen Informationen in der richtigen Menge zu präsentieren, um das "Lost in the Middle"-Problem zu vermeiden.
#16 KI gegen die Zettel-Flut: Wie Machine Learning Schachpartien digitalisiert
Nach einer langen, anstrengenden Schachpartie noch 30 Minuten lang mühsam jeden einzelnen Zug vom Papier in den Computer übertragen, nur um das Spiel analysieren zu können? Das muss nicht sein, dachte sich auch Benjamin Kostka und hat das Problem für seine Bachelorarbeit einfach selbst gelöst. In dieser Folge von "Wissenschaft Veränderung" sprechen wir mit Ben über seinen Weg. Als aktiver Vereinsspieler wollte er den Prozess von der handschriftlichen Partie-Notation zur digitalen Analyse automatisieren. Er entwickelte ein Machine-Learning-Modell, das Fotos von ausgefüllten Partieformularen einlesen und in das digitale PGN-Format umwandeln kann. Wir tauchen tief in die Praxis ein: Wie geht man damit um, dass jedes Turnierformular anders aussieht? Wie erstellt man einen sauberen Datensatz, wenn die echten Daten zu unordentlich sind? Und wie gut funktioniert die Handschrifterkennung am Ende wirklich?
#15 Von der Halluzination zur Präzision: Ein Blick in die Trickkiste der KI-Entwicklung
Wir alle nutzen KI-Sprachmodelle, doch wie verlässlich sind ihre Antworten wirklich? Studien zeigen, dass selbst fortschrittliche Modelle wie GPT-4 bei Faktenfragen oft nur eine Trefferquote von rund 60 % erreichen und zum "Halluzinieren" neigen. Aber es gibt Methoden, das zu ändern. In dieser Folge sprechen wir mit Nicolas Kohl, der sich im Rahmen seiner Bachelorarbeit bei SAP genau diesem Problem gewidmet hat. Er erklärt den Ansatz der "Retrieval-Augmented Generation" (RAG), bei dem eine KI lernt, ihre Antworten auf Basis externer, verlässlicher Dokumente zu formulieren, anstatt sich auf ihr eigenes, manchmal fehlerhaftes Wissen zu verlassen. Wir tauchen tief ein in die Optimierung dieser Methode und klären, warum es nicht nur darauf ankommt, der KI überhaupt Daten zu geben, sondern auch darauf, ihr die richtigen Daten in der richtigen Menge zu präsentieren.
#14 NIS 2, DSGVO & Co.: Was das neue Cybersicherheitsrecht für Unternehmen bedeutet
Ein Software-Fehler legt weltweit Krankenhäuser lahm. Neue EU-Richtlinien wie NIS 2 und der Cyber Resilience Act erzeugen Handlungsdruck. Das Thema Cybersicherheit ist längst mehr als nur eine IT-Aufgabe – es ist eine strategische Herausforderung mit enormen rechtlichen Konsequenzen. In dieser Folge sprechen wir mit dem Rechtsanwalt Dr. Tilmann Dittrich. Als Experte für IT-Strafrecht erklärt er, wie sich das Cybersicherheitsrecht aus vielen verschiedenen Gesetzen zusammensetzt und was das für Unternehmen, insbesondere für kritische Infrastrukturen, bedeutet. Wir klären, welche Pflichten auf Geschäftsführer zukommen, warum selbst "freundliche" Hacker rechtliche Probleme bekommen können und wieso der Staat bei der Umsetzung seiner eigenen Gesetze an Grenzen stösst.
#13 40.000 E-Mails, 10 Wochen, 1 Student: Ein KI-System im Praxistest
Täglich hunderte E-Mails von Mietern: "Die Heizung ist defekt", "Der Nachbar ist zu laut", "Frage zur Betriebskostenabrechnung". Für Immobilienverwaltungen wie die ProPotsdam ist das manuelle Sortieren dieser Flut eine enorme Herausforderung. Doch kann KI hier helfen? In dieser Folge sprechen wir mit David Brockmeyer, der sich in seiner Bachelorarbeit genau dieser Frage gewidmet hat. Mit einem Datensatz von 40.000 echten Mieter-E-Mails hat er ein Machine-Learning-Modell entwickelt, das lernt, die Anliegen automatisch zu klassifizieren und dem richtigen Bearbeiter vorzuschlagen. Wir tauchen tief in die Praxis ein: Wie verwandelt man unstrukturierten Text in Daten, mit denen ein Algorithmus arbeiten kann? Und wie gut funktioniert das am Ende wirklich – wo liegen die Stärken und wo die überraschenden Schwächen?