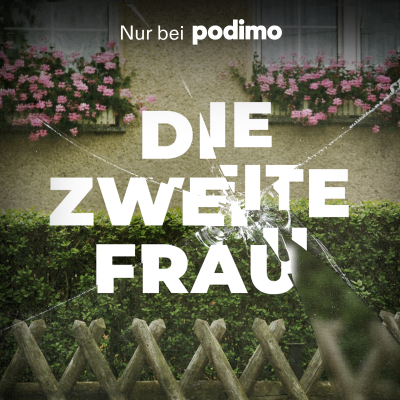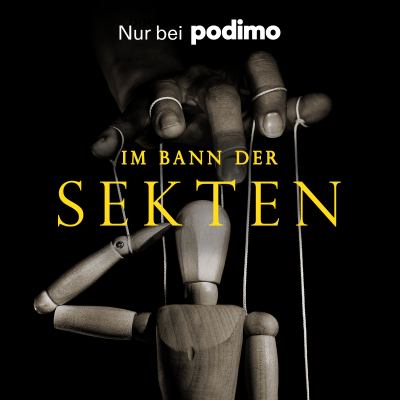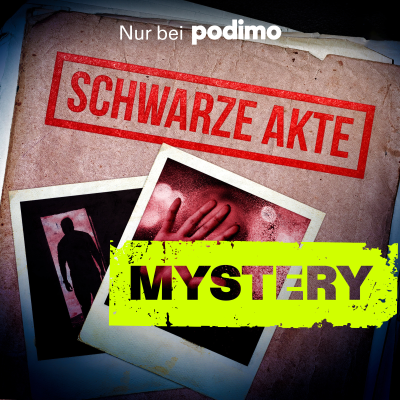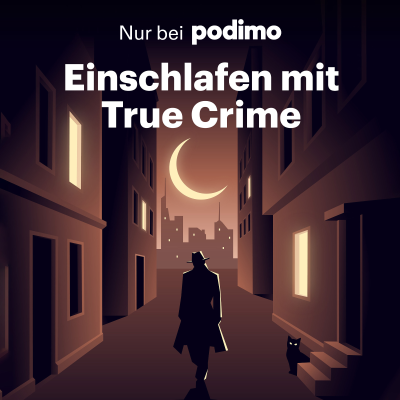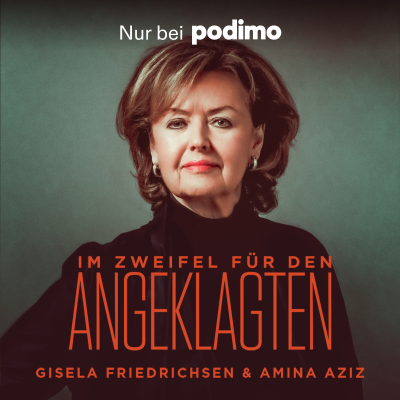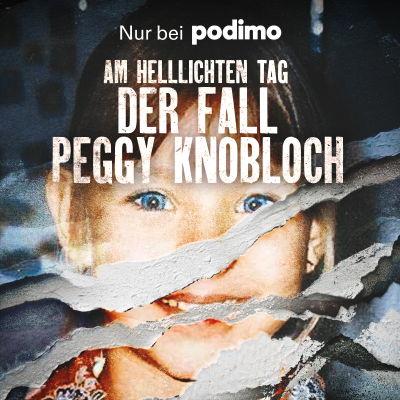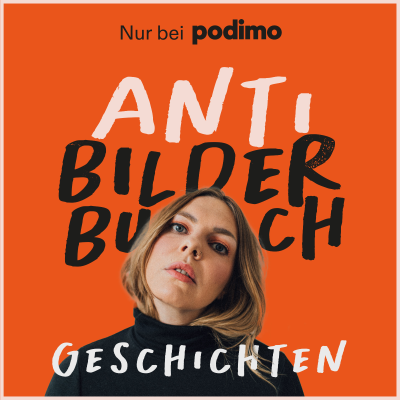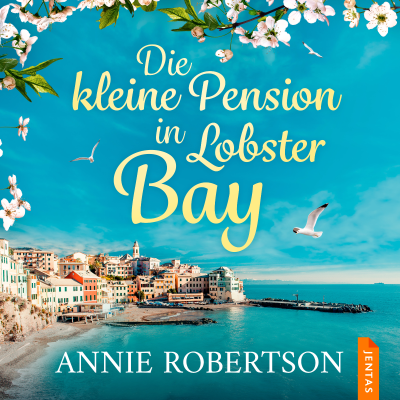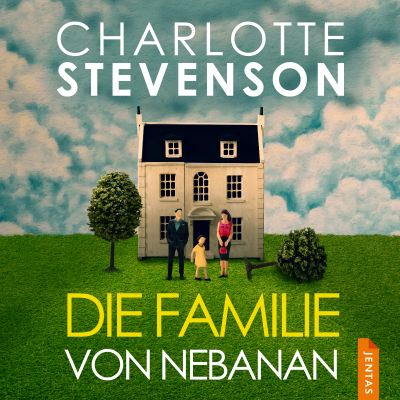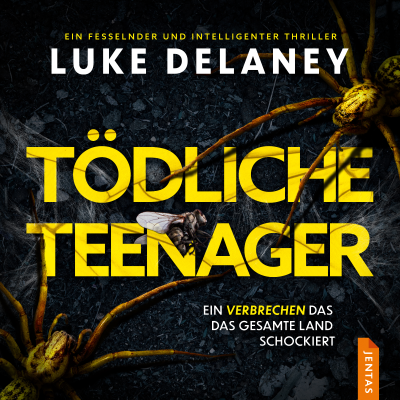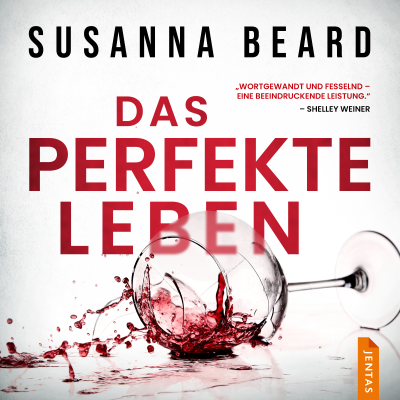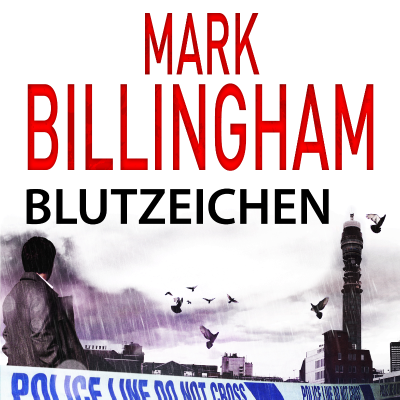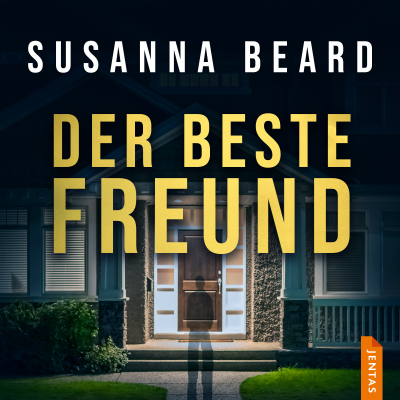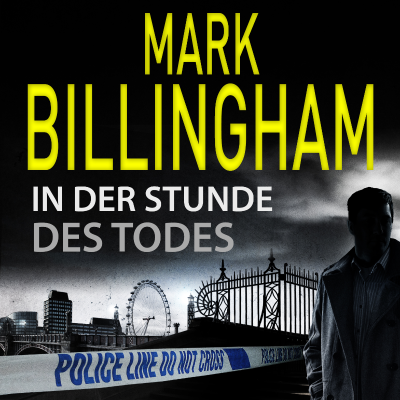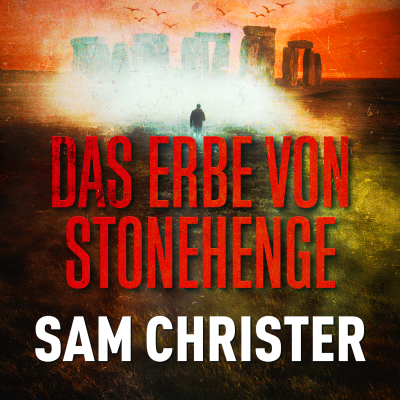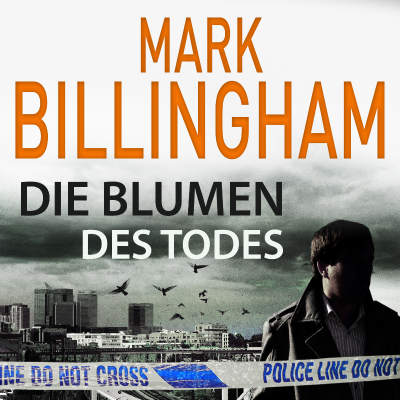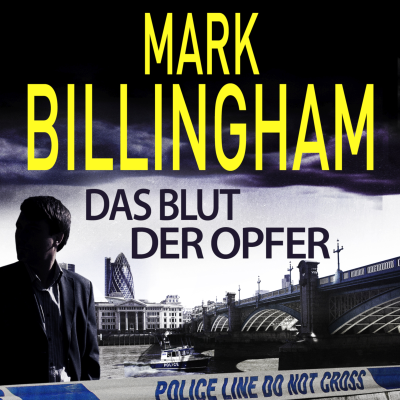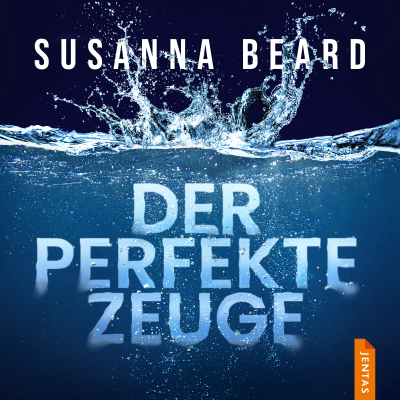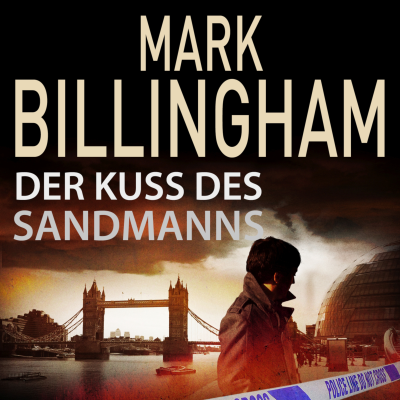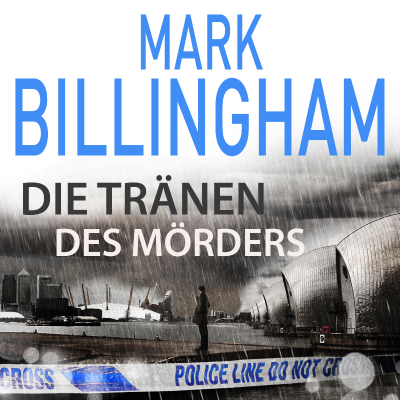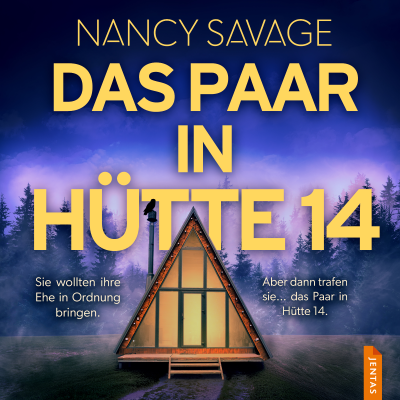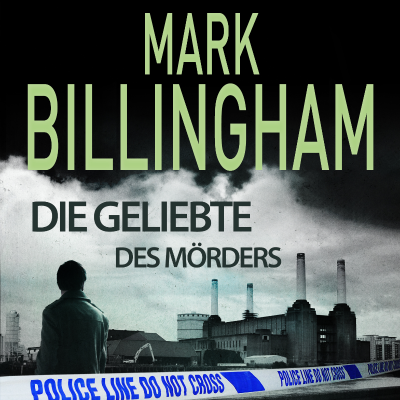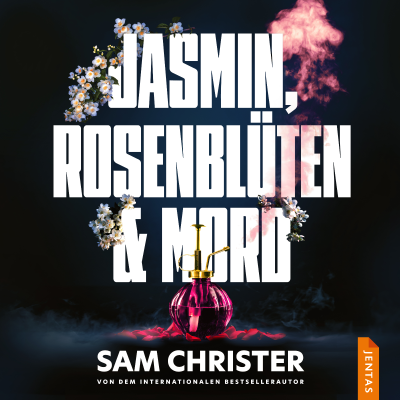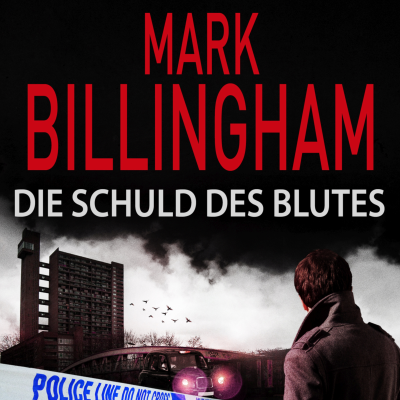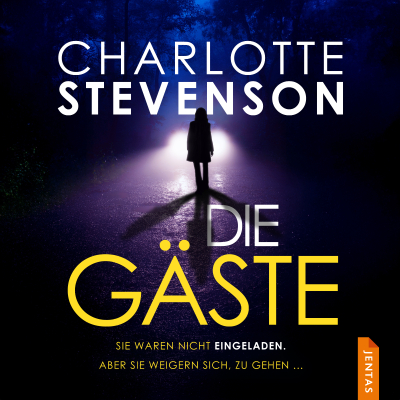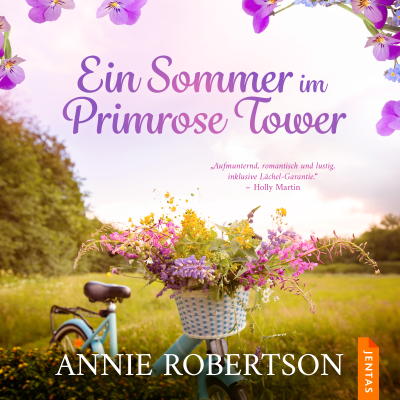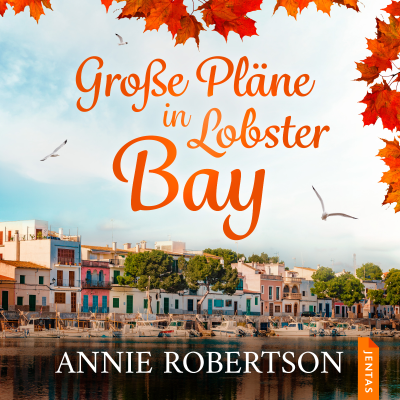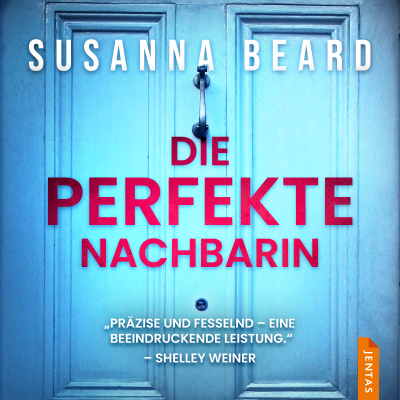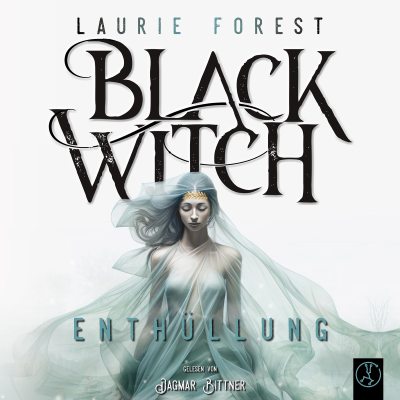Reporter HD
Deutsch
Gratis en Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr Reporter HD
Information: Dieser Video Podcast wird per Ende Juli 2021 eingestellt. Künftige und bisherige Episoden finden Sie auf unserem Play SRF Portal (www.srf.ch/play). Die Reportagen rücken Menschen ins Zentrum. Gezeigt werden deren Schicksale und Abenteuer.
Alle Folgen
79 FolgenRassismus in der Schweiz – Der Sommer, in dem ich «Schwarz» wurde
Angélique Beldner ist die erste Schwarze News-Moderatorin des Schweizer Fernsehens. Ihre Hautfarbe und den Rassismus, den sie erlebt hat, wollte sie allerdings nie zum Thema machen. Bis zu diesem Sommer, der alles verändert hat. In Frutigen verbrachte sie ihre ersten Jahre, in der Agglomeration von Bern wuchs sie auf. Angélique Beldner, 44 Jahre alt, verheiratet, Mutter zweier Kinder. In einer weitgehend behüteten Umgebung wurde sie gross. Die weisse Mutter alleinerziehend, unterstützt von der Schweizer Grossfamilie, der schwarze Vater weit weg. «Ich bin voll und ganz Schweizerin, realisierte aber schon früh, dass ich anders war. Ich habe diese Erinnerung, wie sich Menschen in den Kinderwagen beugen und meine Haare berühren. Das begleitet mich bis heute und ist mir sehr unangenehm. Leute, die mir ungefragt ins Haar langen, das gibt es immer noch», sagt Angélique Beldner. Trotzdem: Solche Erlebnisse behält sie für sich. Wenn, spricht sie nur mit ihrer Mutter darüber. Beldners Strategie war stets: Rassismus überhören oder ihn kleinreden. «Bis zu diesem Sommer hat das bestens funktioniert.» «Black Lives Matter» hat ihre heile Welt aus den Fugen gebracht: «Auf einmal fragten mich alle nach meiner Meinung zum Thema Rassismus, und ich realisierte: Wenn alle schweigen, so wie ich, wird sich nie etwas verändern», sagt Beldner. «Reporter» begleitet Angélique Beldner auf Spurensuche ihrer eigenen Vergangenheit in der Schweiz. Warum hat Beldner Rassismus stets beschönigt und nicht sehen wollen? Warum fällt es ihr so schwer, darüber zu reden? Angélique Beldner spricht mit engen Familienangehörigen erstmals über ihre Hautfarbe und macht dabei auch schmerzhafte Erfahrungen.
Abt mit Leib und Seele
Christian Meyer ist seit zehn Jahren der Vorsteher des Klosters Engelberg. Als Abt ist er für die Gemeinschaft der zwanzig Mönche und die Klosterbetriebe verantwortlich. Wegen der Corona-Pandemie muss er das Kloster durch schwierige Zeiten manövrieren. Vor 900 Jahren wurde das Kloster Engelberg gegründet. Nun hat das Coronavirus dem Abt das Jubiläumsjahr verhagelt. Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Im Frühjahr war das Kloster im Shutdown. Mit etwa hundert Angestellten ist das Kloster nach den Bergbahnen der zweitgrösste Arbeitgeber in Engelberg. Daher ist bis heute vom «Klosterdorf» die Rede. Die Gemeinschaft in Engelberg zählt derzeit zwanzig Mönche. Ihr Durchschnittsalter beträgt 63 Jahre. Für Abt Christian Meyer ist das Kloster kein lustfeindlicher Ort. Er isst, kocht und singt gerne. Wie lebt er die klösterlichen Versprechen Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit? Wie führt Abt Christian Meyer seine Mitbrüder und was bedeutet die Coronakrise für das Kloster im Jubiläumsjahr? Reporter Norbert Bischofberger begleitet Abt Christian Meyer in seinem Alltag im Kloster in bewegten Corona-Zeiten, ins Pfadilager und nach Basel, wo er aufgewachsen ist.
Mythos Matterhorn – Ein Erfahrungsbericht
Kein anderer Berg der Welt übt eine solche Anziehung aus. Das Matterhorn oder «Horu», wie es die Einheimischen nennen, ist ein Magnet für Bergsteigerinnen und Bergsteiger aus aller Welt. Sie scheuen keine Mühen und Kosten, um einmal auf dem bekannten Gipfel stehen zu dürfen. Kein anderer Berg dieser Welt hat so viele Todesopfer zu beklagen: Jährlich sterben durchschnittlich sechs Menschen am Matterhorn. Darunter letztes Jahr auch ein Bergführer mit seinem Klienten, als ein Fixseil aus dem Fels brach. Ist das Bergsteigen in den letzten Jahren gefährlicher geworden? Bröckelt der Berg aufgrund des schwindenden Permafrosts? Sind die Alpinistinnen und Alpinisten weniger gut vorbereitet als früher? Oder ist einfach zu viel los am bekanntesten Berg der Schweizer Alpen? An einem sonnigen Tag im Juli sind hundert Menschen auf dem Gipfel des Matterhorns keine Seltenheit. Reporter Matthias Lüscher steigt mit dem Zermatter Bergführer Anjan Truffer aufs Matterhorn und schaut dabei auf und hinter die Fassade des weltbekannten Fotosujets. Anjan Truffer war schon über zweihundert Mal ganz oben und hat als Chef der Bergrettung Zermatt unzählige Rettungen am Berg durchgeführt. Er kennt das Horu wie kein Zweiter. Eine Reportage auf den Spuren des Mythos Matterhorn.
Tschopps Haus auf der Krim
Nach einem Herzinfarkt und einem Burnout wagt der Baselbieter Roland Tschopp einen Neuanfang. Und das auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim, einem Brennpunkt der Geopolitik. Die Krim ist aber auch die ursprüngliche Heimat seiner Frau Karyna. Diese wiederum will in der Schweiz bleiben. Irgendwann ging es einfach nicht mehr. Der heute 56-jährige Roland Tschopp hatte genug. Über zwanzig Jahre war er als Inhaber einer Metallbaufirma stets auf Trab. Das Bangen um die Aufträge, das emotionale und finanzielle Auf und Ab hinterliessen Spuren. Bei Tschopp waren ein Herzinfarkt, ein Burnout und Gliederschmerzen die Folgen. So entschloss er sich zu einem radikalen Schritt: Er verkaufte seine Werkstatt und Wohnung und zog mit seiner Frau auf einen Zeltplatz. Sein Ziel: sich auf der Krim ein Haus zu bauen, dort zu leben und Wohnungen an russische Touristen zu vermieten. Ihm behage das Klima auf der Krim und er habe hier viel weniger Stress als in der Schweiz, sagt er. Baubeginn war im Herbst 2017. Der Anfang ist vielversprechend. Roland und Karyna sind oft vor Ort. Aber die Probleme häufen sich. Arbeiten werden schlecht ausgeführt, Termine nicht eingehalten. Und eine unliebsame Nachbarin beobachtet ständig die Baustelle und überschüttet sie mit Klagen und Einsprachen. Das verzögert den Bau. Langsam wird das Geld knapp. Auch für die Beziehung wird der Bau zur Belastungsprobe. Reporter Christof Franzen hat das Baselbieter Ehepaar Karyna und Roland Tschopp im Verlauf eines Jahres mehrmals besucht – auf dem Campingplatz in Läufelfingen und im Rohbau auf der Krim.
Ein Apotheker mit Nebenwirkungen
Im Schaufenster der ältesten Quartierapotheke der Stadt Bern stehen keine Mittel gegen Husten oder Halsschmerzen. Hier hängt Kunst. Ganz bewusst. «Reporter» begleitet den eigenwilligen Apotheker Silvio Ballinari und geht der Frage nach, was im Leben wirklich heilsam ist. Wenn der Profit wichtiger ist als die Patientin oder der Patient, ärgert sich der Berner Apotheker Silvio Ballinari. Er will deshalb Pharmariesen keine Plattform bieten und verzichtet in seinem Geschäft auf Produktewerbung. Im Schaufenster stellen stattdessen Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus. Ballinaris Arbeit hat ihn in die Schlagzeilen gebracht, sogar im Parlament war davon die Rede: Vor ein paar Jahren brachte eine amerikanische Pharmafirma einen alten Wirkstoff als teures Medikament auf den Markt. Ballinari zeigte, wie er ein Mittel mit gleichem Wirkstoff in seiner Apotheke herstellt. Der Preis: zehnmal günstiger. Ballinari macht viel im Leben – und alles mit viel Leidenschaft. Er ist nicht nur Apotheker, sondern auch Künstler, Philosoph und Musiker. In «Reporter» tüftelt er an einem alten Rezept aus dem Emmental, er zeigt, warum der Garten seiner Apotheke im Frühling zur Quartierattraktion wird, und er erklärt der Reporterin Samira Zingaro, warum ein Wirkstoff allein nicht gesund macht.