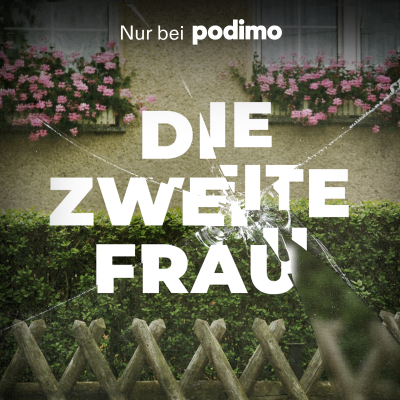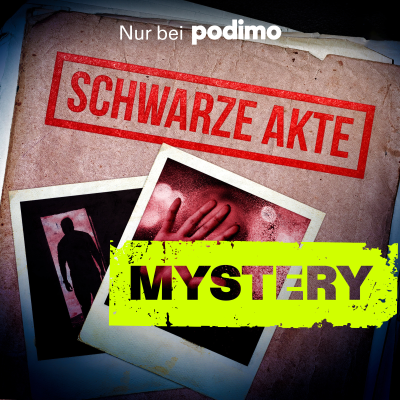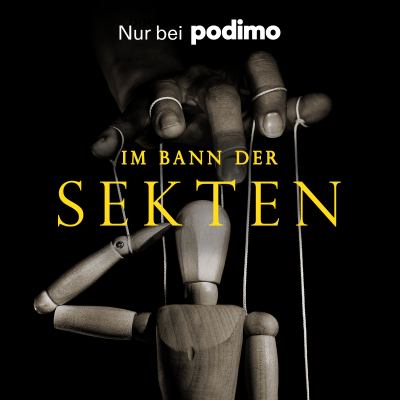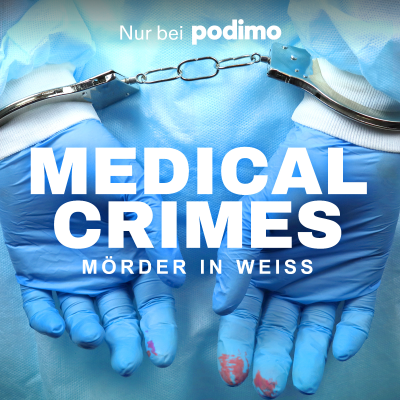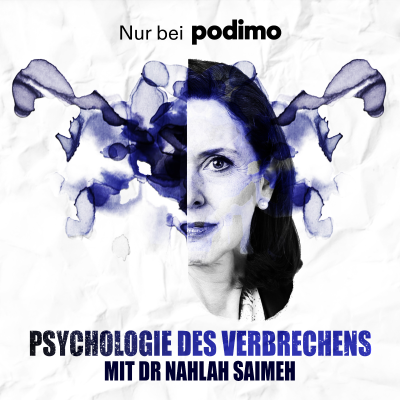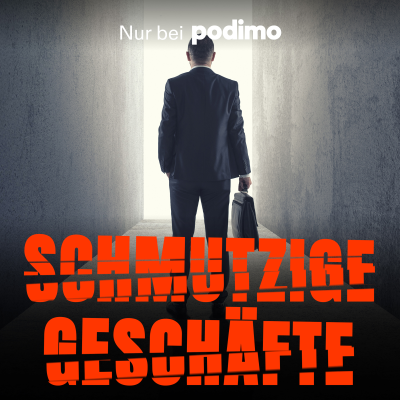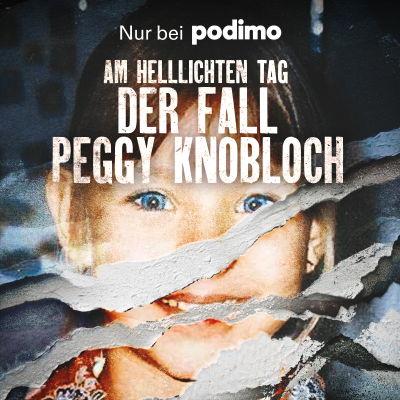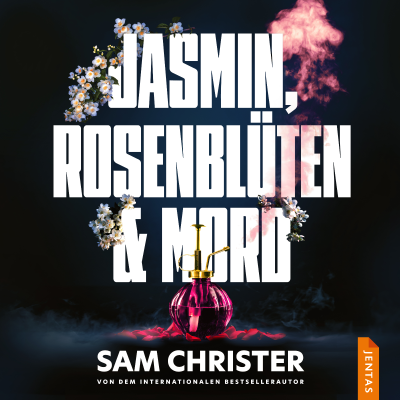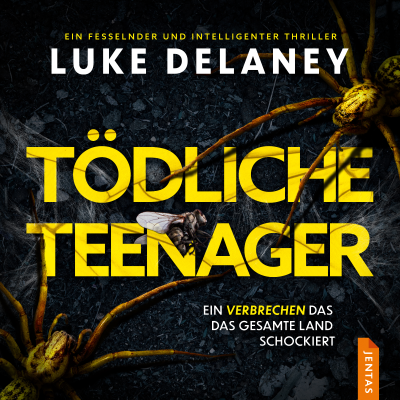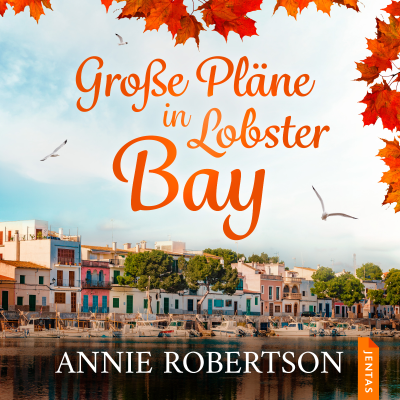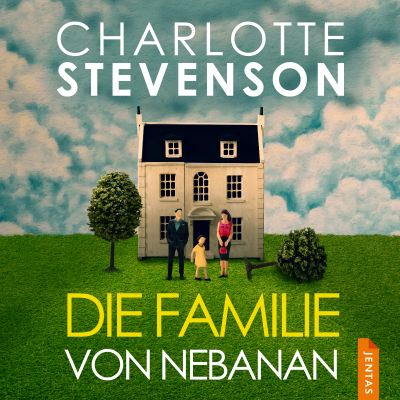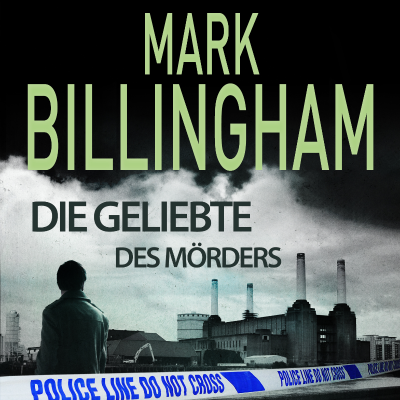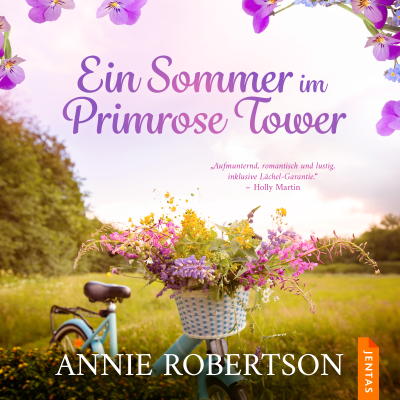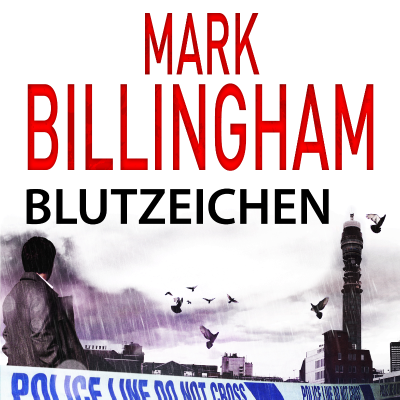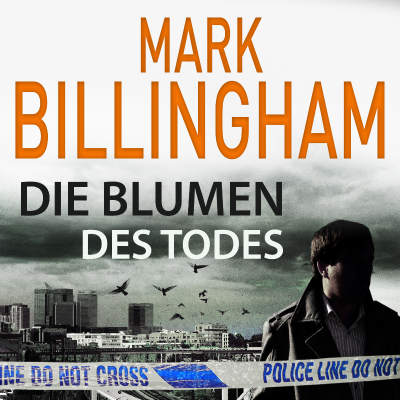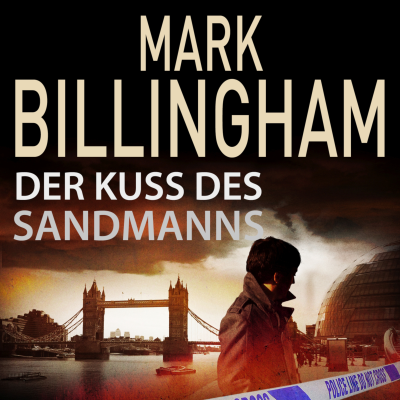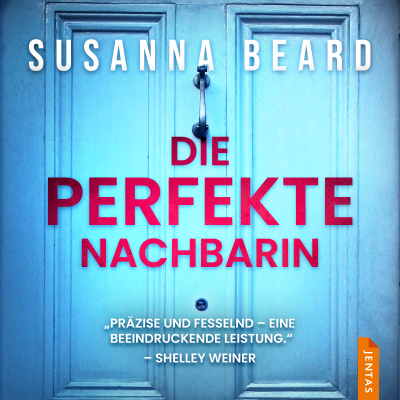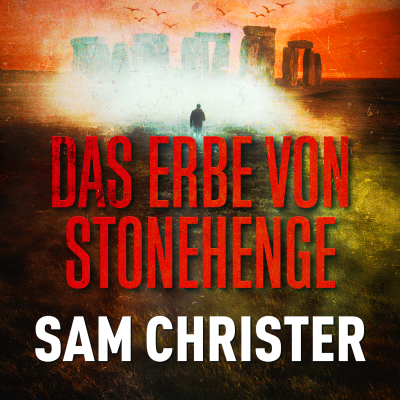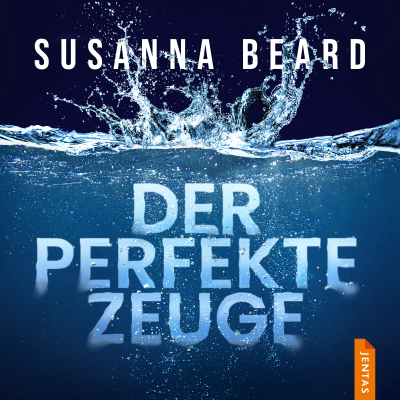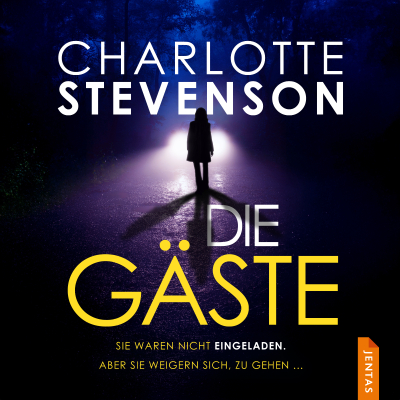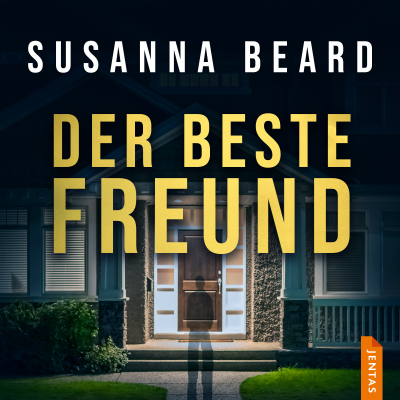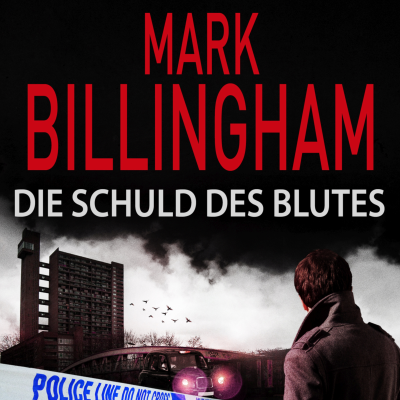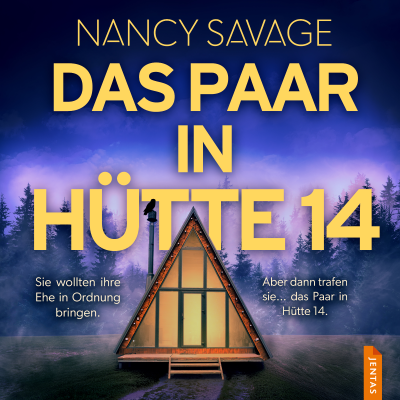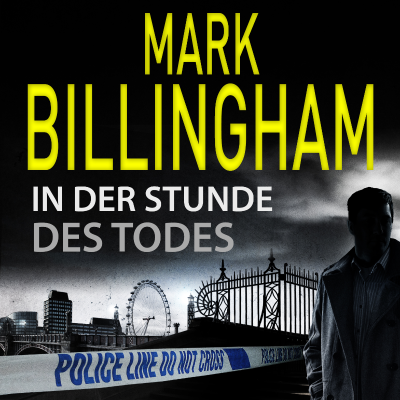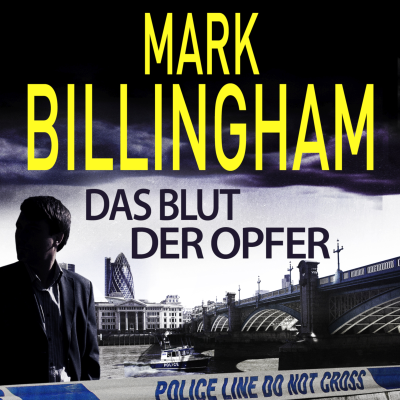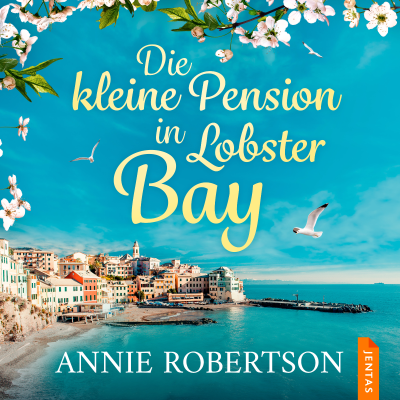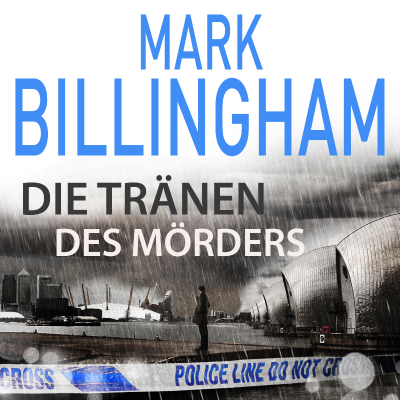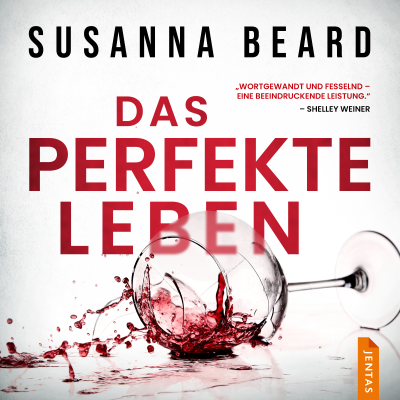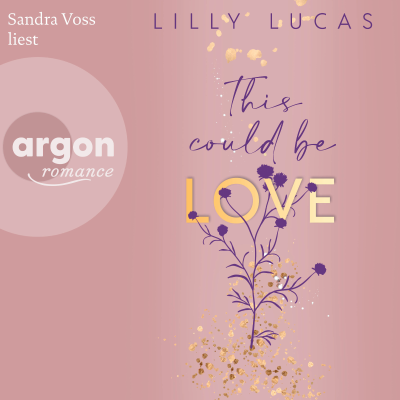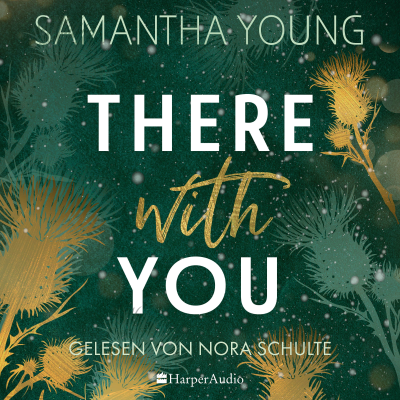Wissenswelle
Deutsch
Gratis en Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr Wissenswelle
Podcast der Universität Hamburg
Alle Folgen
39 Folgen„Es muss einfacher werden, sich für Nachhaltigkeit zu entscheiden“
Was brauchen Unternehmen, Staaten oder auch einzelne Menschen, um sich nachhaltiger zu verhalten? In der neuen Folge der Wissenswelle erklärt die Professorin für Nachhaltiges Wirtschaften an der Universität Hamburg, Laura Marie Edinger-Schons, wie man dafür benötigte Daten erhebt und neue Definitionen für den Erfolg von Organisationen entwickelt. Am Beispiel der Osterinseln beschreibt die Wirtschaftsprofessorin Laura Edinger-Schons gelegentlich, wie schwierig es sowohl für Einzelne wie auch für Gesellschaften ist, Gewohnheiten zu verändern und zu einer nachhaltigen Lebensweise zu kommen. Denn dort wurden für den Transport der berühmten Steinskulpturen so lange Bäume gefällt, bis die Inseln entwaldet und nahezu unbewohnbar waren. Heutigen westlichen Staaten attestiert Edinger-Schons zwar Bemühungen, die langsame Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen zu stoppen, doch: „Wir kommen zu langsam voran!“, sagt sie. In der Verantwortung von Politik und Gesetzgebung, Unternehmen und anderen Akteurinnen und Akteuren läge es, sogenannte „ermöglichende Umgebungen“ zu schaffen: „Wir sollten es für alle einfach machen, sich nachhaltig zu verhalten – beispielsweise im Bereich Mobilität oder Ernährung. Nachhaltige Entscheidungen kommen uns allen zu Gute und sind für uns selbst darüber hinaus häufig die gesünderen Entscheidungen.“ An der Universität Hamburg will die CSO zeigen, wie es gehen kann. Dafür hat sie beispielsweise jeden Bestellvorgang und jede Dienstreise der vergangenen Jahre unter die Lupe genommen. Was ist nachhaltiger – eine Zoom-Konferenz oder ein Treffen vor Ort? Der Umstieg auf Fernwärme oder der Einbau einer Wärmepumpe? Meist gibt es keine einfachen Antworten und es ist viel Recherche notwendig. Entscheidend für den Erfolg sei aber auch das Engagement der Mitarbeitenden, so die Professorin. Den meisten Menschen sei heutzutage zwar klar, dass sie als Konsumentinnen und Konsumenten etwas bewirken können. Doch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schöpfen sie die Möglichkeiten, ihre Arbeitsplätze und Arbeitsgeber zu verändern, noch lange nicht aus. Zumindest an der Universität Hamburg will sie dies ändern, beispielsweise indem sie die Mitarbeitenden und Studierenden zu den Offenen Plenen Nachhaltigkeit einlädt – oder einfach mal zu einem Gedankenaustausch ins neue Tiny House. Diese Folge der Wissenswelle wurde Ende 2023 aufgenommen.
„Wir müssen die Nachhaltigkeit digitaler Lösungen stärker hinterfragen“
https://podcast.blogs.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/wissenswelle-recker.mp3 [https://podcast.blogs.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/wissenswelle-recker.mp3]Digitalisierung kann zu mehr Nachhaltigkeit führen, tut das aber nicht per se, sagt Jan Recker, Professor für Informationssysteme und Digitale Innovation an der Universität Hamburg. Als Nucleus-Professor erforscht er, wie Unternehmen wirklich ressourcensparend wirtschaften können – und wie man die Menschen dazu bringt, nachhaltige Lösungen zu nutzen. Es ist besser, ein Dokument auf dem Computer zu speichern als es zu drucken. Aber wie sieht es bei einem Zoom-Call aus? Und ist ein digitales Meeting in jedem Fall nachhaltiger als die analoge Alternative? Das alles ist nicht so einfach zu beurteilen, wie viele denken, erklärt Nucleus-Professor Jan Recker, der als Wirtschaftsinformatiker in der BWL-Fakultät lehrt und forscht. Denn auch zoomen, mailen oder googeln verursacht ökologische Folgekosten – und diese betrachten wir nach Reckers Erfahrung viel zu wenig. So wird der ökologische Fußabdruck der IT-Branche kaum diskutiert, obwohl er inzwischen größer ist als der Fußabdruck aller Fluglinien weltweit pro Jahr. Anderseits kann die Digitalisierung wie kaum ein anderes Werkzeug zur Vermeidung von Ressourcenverschwendung beitragen. Beispielsweise in der Recyclingwirtschaft: Hier ist die Weitergabe von Informationen häufig ein zentrales Problem und digitale Tools können diese verbessern. Zudem können Computerprogramme oder Apps Menschen zu einem ökologischeren Verhalten animieren – indem sie beispielsweise über freie Parkplätze informieren oder darüber, dass sich eine Abgabestation für den Mehrweg-Kaffeebecher in der Nähe befindet. Solch sanftes Erinnern oder „Anstupsen“, in der Fachwelt „nudging“ genannt, sei oft besser als das Verhängen von Strafen und bürokratische Regelungen, so Recker. Im Podcast Wissenswelle erklärt er, welche erfolgversprechenden Ideen es im Bereich Digitale Innovationen gibt, warum Regulierungen durch Behörden trotz allem wichtig sind und wie es kommt, dass die Europäische Union hier sogar eine internationale Vorbildfunktion übernommen hat.
„Wir müssen mehr darüber wissen, was Menschen zum Arbeiten motiviert“
Motivierte Mitarbeitende sind innovativ und produktiv, sie fehlen seltener und machen weniger Fehler als ihre Kolleginnen und Kollegen. Doch eine aktuelle Studie einer internationalen Unternehmensberatung hat gezeigt: In Deutschland arbeitet nicht einmal jeder Zweite motiviert. Wie man das ändern kann, erforscht Iris Kesternich, Nucleus-Professorin an der Universität Hamburg. Geld, Karrierechancen, freie Zeitgestaltung oder Sinnhaftigkeit – was motiviert Menschen zu arbeiten? Diese Frage untersucht die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Iris Kesternich mit Hilfe von Befragungen und auch in Experimenten. Beispielsweise hat sie zwei Gruppen von Arbeitssuchenden denselben, realen Job zu unterschiedlichen Konditionen angeboten. Einer Gruppe gegenüber betonte sie, dass es sich um die Digitalisierung wichtiger medizinischer Forschungsdaten handele, während die Kontrollgruppe erfuhr, dass die Daten nach der Digitalisierung vermutlich nicht mehr verwendet werden würden. Das Ergebnis: Die Gruppe, die glaubte, einer sinnhaften Arbeit nachzugehen, machte weniger Fehler als die Kontrollgruppe. Menschen arbeiten also schlechter, wenn sie befürchten, einer mehr oder weniger sinnlosen Tätigkeit nachzugehen. Einige Arbeitssuchende waren sogar bereit, zu Gunsten einer sinnhaften Arbeit für weniger Geld tätig zu werden, während andere dies genau andersherum sahen: Sie fanden, dass eine sinnvolle Tätigkeit besser bezahlt werden sollte als Arbeit für die Ablage. Kesternichs Forschung mit Langzeitarbeitslosen bildet eine Ausnahme, denn bisher wurden meist gut bezahlte Gruppen untersucht, um etwas über ihre Arbeitsmotivation herauszufinden. „Besserverdienende sind oft bereit, für einen sinnhaften Job auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten“, erklärt die Professorin. „Es ist aber wichtig, dies auch für andere sozioökonomische Gruppen unter die Lupe zu nehmen, damit die Politik die richtigen Weichen für den Arbeitsmarkt stellen kann.“ Im Podcast Wissenswelle erklärt sie, wie sie zu ihren Daten kommt, was eine Nucleus-Professur eigentlich ist und warum Wirtschaftswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen nicht lügen dürfen, wenn sie Experimente durchführen.
„Wir müssen mehr darüber wissen, was Menschen zum Arbeiten motiviert“
Motivierte Mitarbeitende sind innovativ und produktiv, sie fehlen seltener und machen weniger Fehler als ihre Kolleginnen und Kollegen. Doch eine aktuelle Studie einer internationalen Unternehmensberatung hat gezeigt: In Deutschland arbeitet nicht einmal jeder Zweite motiviert. Wie man das ändern kann, erforscht Iris Kesternich, Nucleus-Professorin an der Universität Hamburg. Geld, Karrierechancen, freie Zeitgestaltung oder Sinnhaftigkeit – was motiviert Menschen zu arbeiten? Diese Frage untersucht die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Iris Kesternich mit Hilfe von Befragungen und auch in Experimenten. Beispielsweise hat sie zwei Gruppen von Arbeitssuchenden denselben, realen Job zu unterschiedlichen Konditionen angeboten. Einer Gruppe gegenüber betonte sie, dass es sich um die Digitalisierung wichtiger medizinischer Forschungsdaten handele, während die Kontrollgruppe erfuhr, dass die Daten nach der Digitalisierung vermutlich nicht mehr verwendet werden würden. Das Ergebnis: Die Gruppe, die glaubte, einer sinnhaften Arbeit nachzugehen, machte weniger Fehler als die Kontrollgruppe. Menschen arbeiten also schlechter, wenn sie befürchten, einer mehr oder weniger sinnlosen Tätigkeit nachzugehen. Einige Arbeitssuchende waren sogar bereit, zu Gunsten einer sinnhaften Arbeit für weniger Geld tätig zu werden, während andere dies genau andersherum sahen: Sie fanden, dass eine sinnvolle Tätigkeit besser bezahlt werden sollte als Arbeit für die Ablage. Kesternichs Forschung mit Langzeitarbeitslosen bildet eine Ausnahme, denn bisher wurden meist gut bezahlte Gruppen untersucht, um etwas über ihre Arbeitsmotivation herauszufinden. „Besserverdienende sind oft bereit, für einen sinnhaften Job auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten“, erklärt die Professorin. „Es ist aber wichtig, dies auch für andere sozioökonomische Gruppen unter die Lupe zu nehmen, damit die Politik die richtigen Weichen für den Arbeitsmarkt stellen kann.“ Im Podcast Wissenswelle erklärt sie, wie sie zu ihren Daten kommt, was eine Nucleus-Professur eigentlich ist und warum Wirtschaftswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen nicht lügen dürfen, wenn sie Experimente durchführen.
„Wir müssen mehr darüber wissen, was Menschen zum Arbeiten motiviert“
Motivierte Mitarbeitende sind innovativ und produktiv, sie fehlen seltener und machen weniger Fehler als ihre Kolleginnen und Kollegen. Doch eine aktuelle Studie einer internationalen Unternehmensberatung hat gezeigt: In Deutschland arbeitet nicht einmal jeder Zweite motiviert. Wie man das ändern kann, erforscht Iris Kesternich, Nucleus-Professorin an der Universität Hamburg. Geld, Karrierechancen, freie Zeitgestaltung oder Sinnhaftigkeit – was motiviert Menschen zu arbeiten? Diese Frage untersucht die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Iris Kesternich mit Hilfe von Befragungen und auch in Experimenten. Beispielsweise hat sie zwei Gruppen von Arbeitssuchenden denselben, realen Job zu unterschiedlichen Konditionen angeboten. Einer Gruppe gegenüber betonte sie, dass es sich um die Digitalisierung wichtiger medizinischer Forschungsdaten handele, während die Kontrollgruppe erfuhr, dass die Daten nach der Digitalisierung vermutlich nicht mehr verwendet werden würden. Das Ergebnis: Die Gruppe, die glaubte, einer sinnhaften Arbeit nachzugehen, machte weniger Fehler als die Kontrollgruppe. Menschen arbeiten also schlechter, wenn sie befürchten, einer mehr oder weniger sinnlosen Tätigkeit nachzugehen. Einige Arbeitssuchende waren sogar bereit, zu Gunsten einer sinnhaften Arbeit für weniger Geld tätig zu werden, während andere dies genau andersherum sahen: Sie fanden, dass eine sinnvolle Tätigkeit besser bezahlt werden sollte als Arbeit für die Ablage. Kesternichs Forschung mit Langzeitarbeitslosen bildet eine Ausnahme, denn bisher wurden meist gut bezahlte Gruppen untersucht, um etwas über ihre Arbeitsmotivation herauszufinden. „Besserverdienende sind oft bereit, für einen sinnhaften Job auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten“, erklärt die Professorin. „Es ist aber wichtig, dies auch für andere sozioökonomische Gruppen unter die Lupe zu nehmen, damit die Politik die richtigen Weichen für den Arbeitsmarkt stellen kann.“ Im Podcast Wissenswelle erklärt sie, wie sie zu ihren Daten kommt, was eine Nucleus-Professur eigentlich ist und warum Wirtschaftswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen nicht lügen dürfen, wenn sie Experimente durchführen.