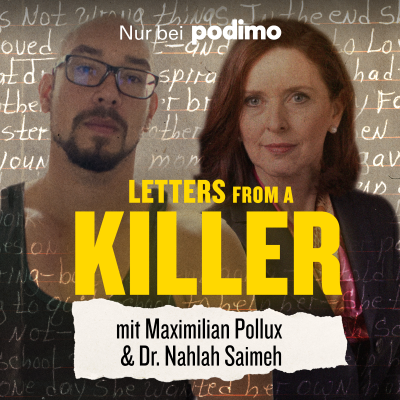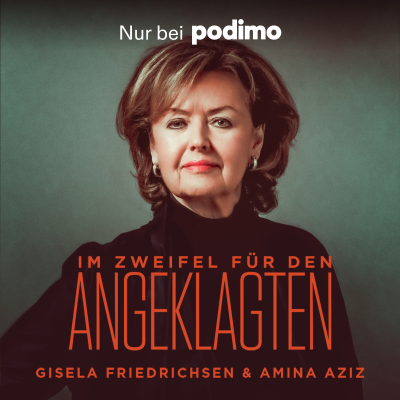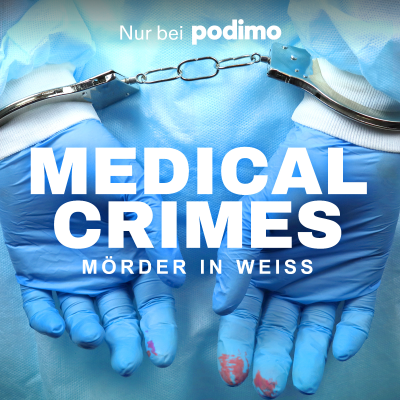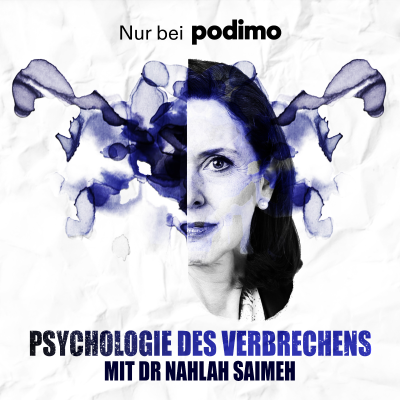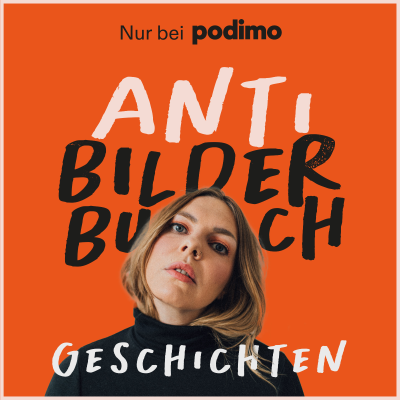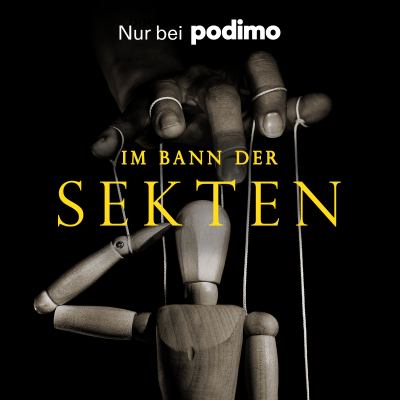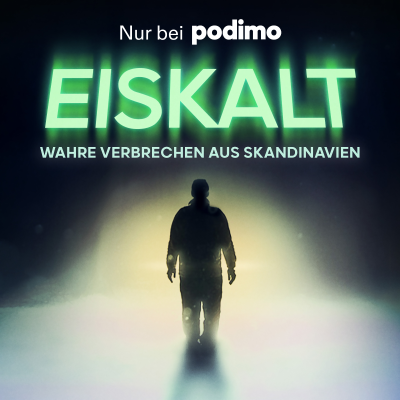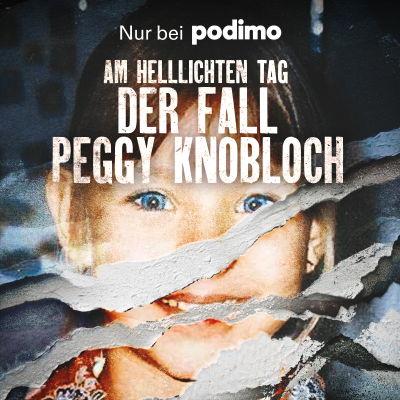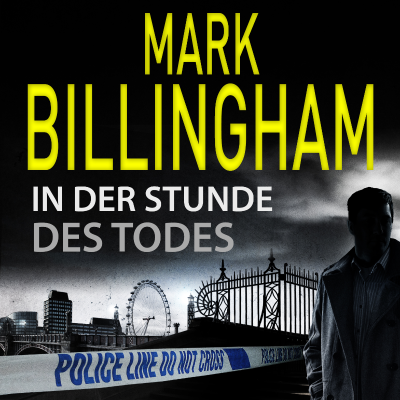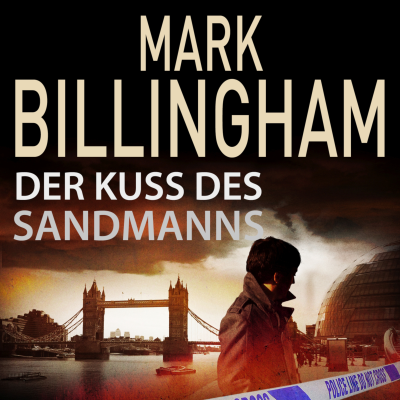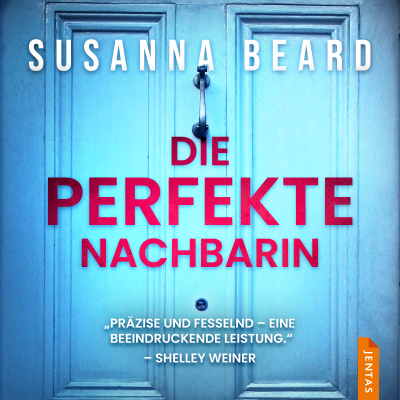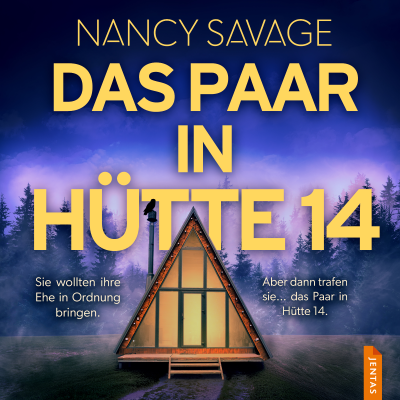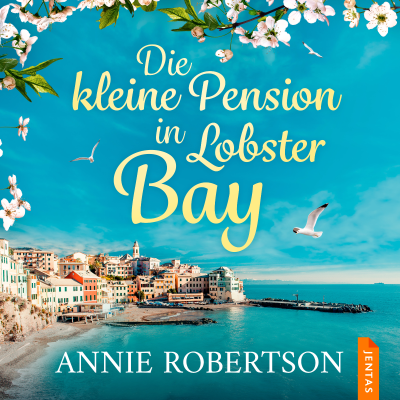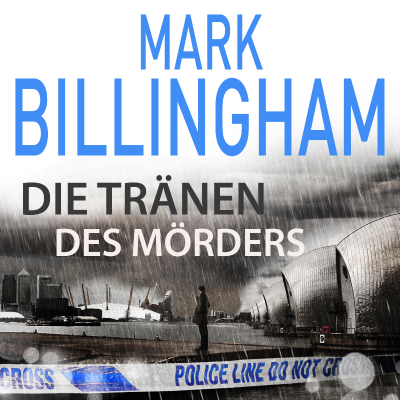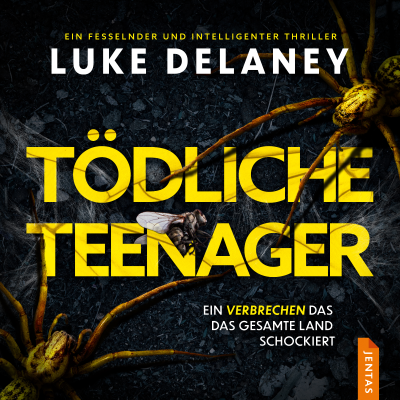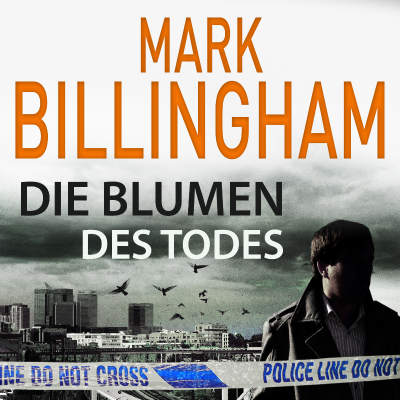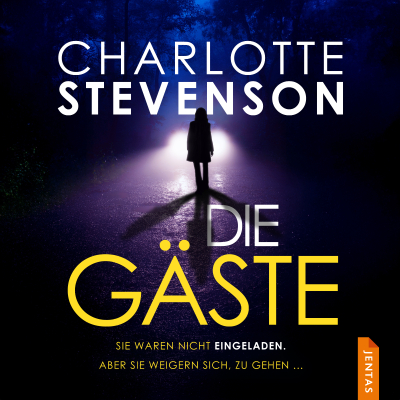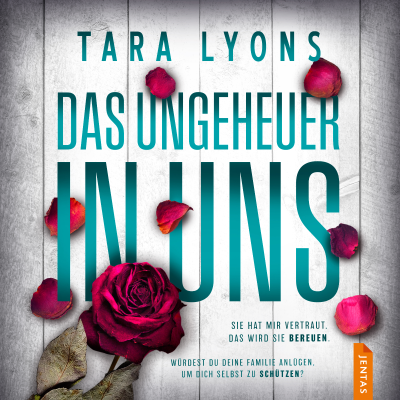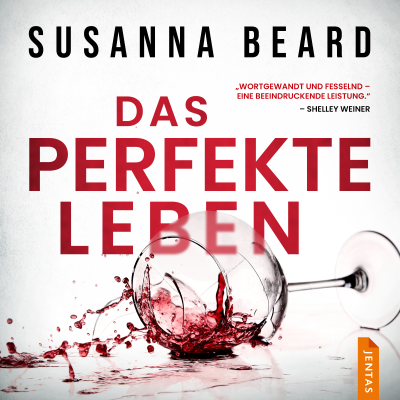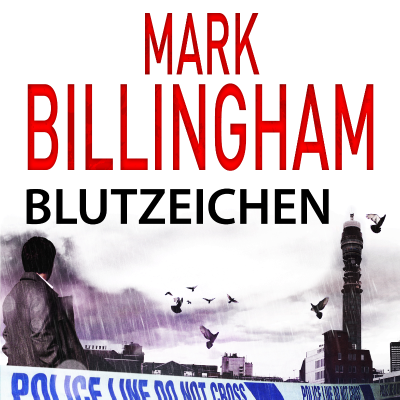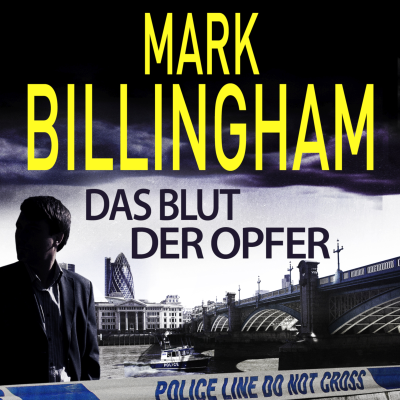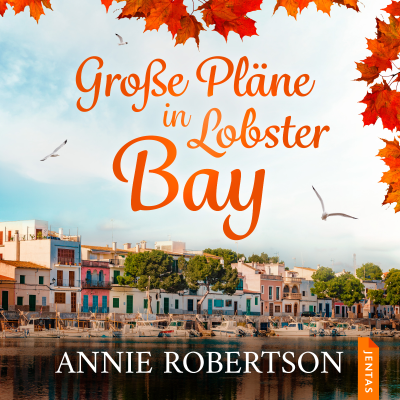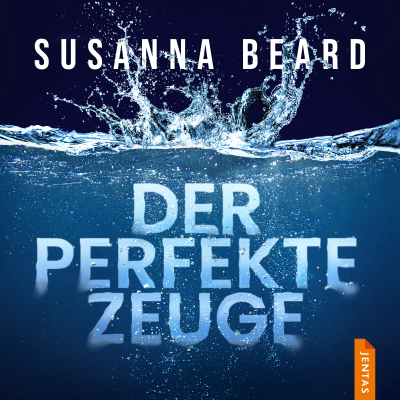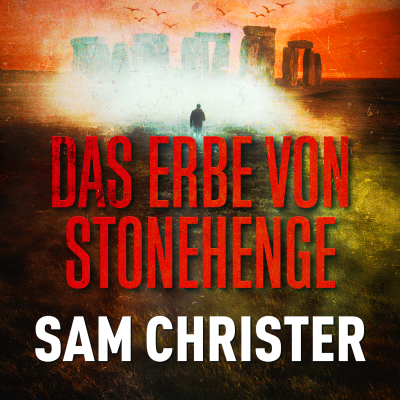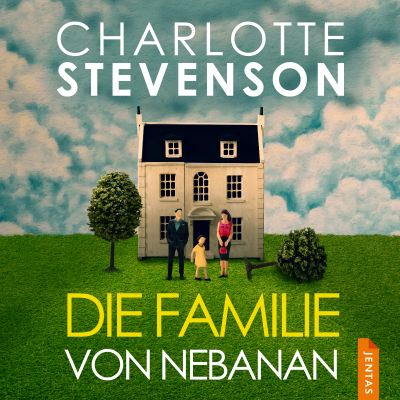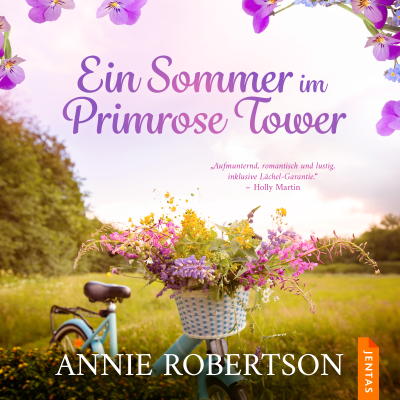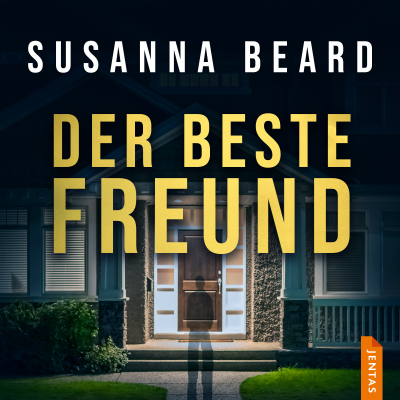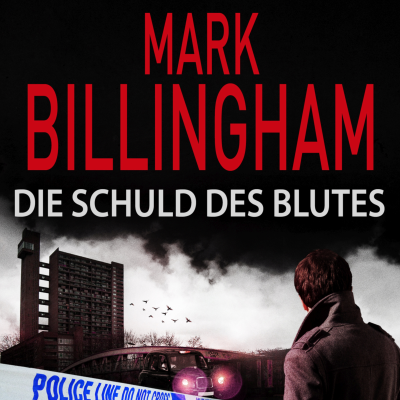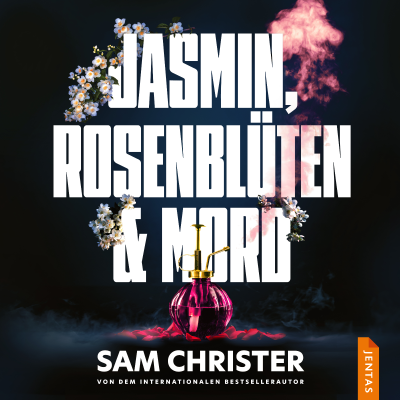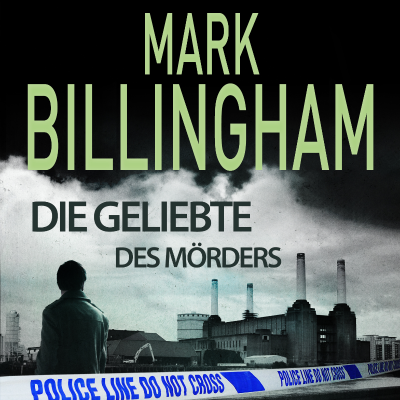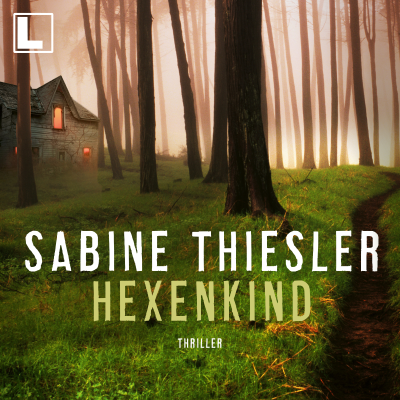Chaosradio
Deutsch
Kostenlos bei Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr Chaosradio
Das monatliche Radio des Chaos Computer Club Berlin
Alle Folgen
293 FolgenLästige KI-Crawler ignorieren große Nein-Schilder
CR303: Warum KI-Crawler so übermäßig belastend sein können und wie man sie loswird Der Anlass für das Chaosradio 303 war eine gefühlt gehäufte Anzahl von Beschwerden in den letzten Monaten über das Ärgernis KI-Crawler, hier ein typisches Beispiel [https://cyberpunk.lol/@weirdmustard/115485013793338814]: cr-288-team [https://chaosradio.de/wp-content/uploads/2025/11/cr303.jpg] Das Team des Chaosradio 303: Constanze, Marcus, Jonas und Leah (v.o.n.u.). > Der Aufwand, den jede einzelne Person, die ihr Zeug nicht gescraped haben will, nun betreiben muss, um AI crawler zu blocken. Es ist wirklich unfassbar, dass dafür niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn alles auf deiner Website Nein sagt, die robots.txt ein großes Nein-Schild hochhält und du auch öffentlich ganz klar gegen AI positioniert bist, sollte es ein Straftatbestand sein, Crawler in deine Richtung zu schicken. Wir sprechen in dieser Sendung über diese KI-Crawler. Es sind automatisierte Computerprogramme, die das Netz durchsuchen. Sie sammeln dabei Daten ein, um Sprachmodelle (gemeinhin oft „KI“ genannt) zu trainieren, oft jedoch ohne Zustimmung der Anbieter. Während einige dieser Bots oder Crawler ein gut vorhersagbares Verhalten zeigen, nimmt das missbräuchliche Scraping zu. Das kann übermäßig belastend werden. Wir reden auch über bisher geltende Konventionen wie die besagte robots.txt und darüber, wie man die uneingeladenen Gäste realistisch wieder loswerden kann. Natürlich kommen wir dabei nicht an der Frage vorbei, wer die Verantwortung trägt. Wir reden auch über konkrete Beispiele aus dem Alltag eines Hosting-Unternehmens. Marcus Richter spricht mit Jonas und Leah, die bei Uberspace auch mit KI-Crawlern kämpfen [https://blog.uberspace.de/2024/08/bad-robots/], und mit Constanze Kurz im Chaosradio 303 über die KI-Bots und über Ideen für bessere Regeln und technische Schutzmechanismen. Und sind eigentlich die ganzen Leute, die KI-Assistenten nutzen, mitverantwortlich für die schulterzuckende Ignoranz der KI-Crawler-Betreiber? Das alles – und noch viel mehr – diskutieren wir in diesem Podcast. Leah ist Mit-Administratorin der Mastodon-Instanz chaos.social [https://chaos.social/]. Außerdem ist sie Leiterin des Infrastrukturbereichs beim Hosting-Unternehmen Uberspace und ärgert sich regelmäßig über die unnötige Arbeit, die ihr die KI-Systeme machen. Jonas führt Uberspace [https://uberspace.de] seit fast fünfzehn Jahren.
15 Jahre epicenter.works
CR302: Wie man nachhaltigen netzpolitischen Aktivismus in Österreich organisiert und finanziert Wir sprechen in dieser Sendung über einen Verein, der dieses Jahr sein 15-jähriges Jubiläum feiert: epicenter.works [https://epicenter.works] aus Wien. Entstanden aus dem politischen Streit um die Vorratsdatenspeicherung ist es heute die wirkmächtigste netzpolitische Organisation Österreichs, die sich vor allem um Datenschutz, Netzneutralität und Überwachungstechnologien kümmert und ein waches Auge auch auf Vorhaben aus Brüssel hat. Auskunft gibt uns Tanja Fachathaler, die bei epicenter.works seit 2021 Policy Advisor ist und uns im Januar 2024 schon einmal beehrte und erklärte, was es mit dem völkerrechtlichen Vertrag „Cybercrime Convention“ [https://chaosradio.de/cr286-dicke-bretter-diesmal-mit-internationaler-computerkriminalitaet] auf sich hat. Außerdem steht uns Thomas Lohninger Rede und Antwort, einer der beiden Geschäftsführer des Vereins und langjähriger Aktivist in netzpolitischen Fragen. Das 15-jährige Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um zu erfahren, wie der Verein arbeitet und welche Themen ihn bewegen. Wir erklären: Was macht der Verein heute, was waren seine Anfänge? Wie hat sich der netzpolitische Aktivismus in Österreich entwickelt? An welchen Rechtsstreitigkeiten in Österreich und Europa war epicenter.works beteiligt? Und wie finanziert man das alles? Wie kann man mitmachen [https://epicenter.works/mitmachen]? Darüber sprechen Tanja Fachathaler, Thomas Lohninger, Marcus Richter und Constanze Kurz im Chaosradio 302.
Dicke Bretter, diesmal über die Schwarz-Schwarz-Roten und ihr neues Digitalministerium
CR301: Wie man ein neues Ministerium zusammenbaut Die „Dicken Bretter“ melden sich zurück. In der Zwischenzeit haben wir die neue schwarz-schwarz-rote Regierung und ein Digitalministerium bekommen. Das nehmen wir zum Anlass, um darüber zu sprechen, wie man eigentlich ein Ministerium gründet. In „Dicke Bretter“ versuchen wir, politische Prozesse am Beispiel von netzpolitischen Fragen zu erklären. In den letzten Monaten gab es einige Blaupausen und Ideen für ein Digitalministerium, jetzt ist es also da. Es versteht sich als „Zukunfts-, Chancen- und Effizienzministerium“ und soll sich nach eigenen Angaben [https://bmds.bund.de/themen/internationale-digitalpolitik] auch EU-weit „um wirtschaftsfreundliche, praxistaugliche und innovationsfördernde Lösungen“ in Digitalien bemühen. Wird nun der ganze digitale Verwaltungsapparat mit einem Schlag revolutioniert? Wohl kaum. Denn erstmal hatte das Ministerium nicht mal ein eigenes Gebäude, seine Fachleute sind aus fünf anderen Ministerien zusammengeklaubt. In dieser Folge machen wir einen Schritt zurück und sprechen darüber, was das Digitalministerium leisten soll. Wir erklären auch, was für Ministerien es eigentlich gibt, wie neue Ministerien entstehen und wie sie aufgebaut sind. Am Rande sprechen wir natürlich auch über die wichtigsten Personal- und Fachfragen des Digitalministeriums. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war noch nicht viel über das Digitalministerium bekannt, mittlerweile gibt es konkrete Pläne. Diese Folge mit Elisa Lindinger und Elina Eickstädt dient der allgemeinen Einführung in die Welt der Ministerien. „Dicke Bretter“ ist ein Podcast von Elisa Lindinger, Elina Eickstädt und Constanze Kurz, produziert von der Chaosradio-Crew, mit Musik von erdgeist.
Das Video Operation Center
CR300: Was ist dieses VOC und wann ist die beste Gelegenheit mitzumachen? Seit etwa 15 Jahren produziert das Video Operation Center [https://de.wikipedia.org/wiki/Video_Operation_Center], auch als VOC bekannt, Vortragsvideos vom jährlich stattfindenden Chaos Communication Congress und zahlreichen weiteren Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs (CCC) und befreundeter Vereine. Wer steht hinter dem VOC? Wie entstand es und wie hat es sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt? Außerdem klärt Marcus Richter mit Sophie, Jenny und danimo, welche Herausforderungen beim Versand der Technik entstehen, wie Interessierte beim VOC mitmachen können und vor allem, wann die beste Gelegenheit dazu ist. Längst nicht alle Videos, die das VOC aufnimmt, sind von Veranstaltungen, die der CCC ausrichtet. Deswegen klären wir auch die Frage: Zu welchen Veranstaltungen kommt das VOC eigentlich? Außerdem zeigen wir, was das VOC überhaupt mit dem Chaosradio zu tun hat. Referenzen * c3voc events [https://c3voc.de/eventkalender] * HowTo's [c3voc] [https://c3voc.de/wiki/howto:start] * C3VOC Infrastruktur und Geschichte [https://media.ccc.de/v/subscribe11-58190-c3voc-infrastruktur-und-geschichte] * VOC Case 2.0 - Modularize Everything [https://media.ccc.de/v/gpn23-82-voc-case-2-0-modularize-everything] * media.ccc.de [https://media.ccc.de] * mediacccde-YouTube-Kanal [https://www.youtube.com/mediaccc.de] * FireWire – Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/FireWire] * XLR – Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/XLR] * Serial Digital Interface (SDI)– Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Digital_Interface] * Dante (Netzwerkprotokoll) – Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/Dante_(Netzwerkprotokoll)] * AES/EBU a.k.a AES3 – Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/AES/EBU] * AES67 - Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/AES67] * GitHub - voc/voctomix: Full-HD Software Live-Video-Mixer in python [https://github.com/voc/voctomix]
Dicke Bretter, diesmal mit weniger Videoüberwachung
CR299: Wie man sich erfolgreich dagegen wehrt, dass immer mehr videoüberwacht wird Die „Dicken Bretter“ melden sich zurück: Wir sprechen über Videoüberwachung in Köln, deren Hard- und Software und Einsatzorte und über juristische Gegenwehr gegen staatliche Beobachtung und Speicherung. Wir versuchen in „Dicke Bretter“ [https://chaosradio.de/chaosradio-neustart-2023], Technologien und digitale Themen aus dem Blickwinkel von Aktivismus und politischer Willensbildung zu betrachten. Deswegen befragen wir in dieser Folge Calvin Baus, der sich gegen polizeiliche Videoüberwachung engagiert. Er kämpft schon mehrere Jahre im Rahmen der Kölner Initiative „Kameras stoppen“ dagegen an, dass an immer mehr Standorten permanent Kameras betrieben werden. Videoüberwachung kann zu einer Verdrängung von Kriminalität führen, verletzt aber Grundrechte von Vorbeilaufenden, Anwohnern oder Demo-Teilnehmern. Ein erstes Gerichtsurteil gegen die Videoüberwachung erging Ende 2024. Wie Calvin dabei vorging, besprechen wir in dieser Ausgabe von „Dicke Bretter“. Er berichtet uns auch, wie die Polizei auf das Urteil reagiert hat. „Dicke Bretter“ ist ein Podcast von Elisa Lindinger, Elina Eickstädt und Constanze Kurz, produziert von der Chaosradio [https://chaosradio.de/team]-Crew, mit Musik von erdgeist. Eine gekürzte schriftliche Version des Gesprächs zwischen Elina, Calvin und Constanze kann man bei netzpolitik.org [https://netzpolitik.org/2025/koeln-kampf-gegen-polizeiliche-videoueberwachung] lesen. Referenzen * Kameras stoppen! [https://kameras-stoppen.org]