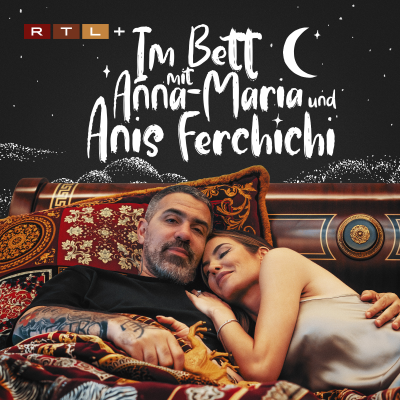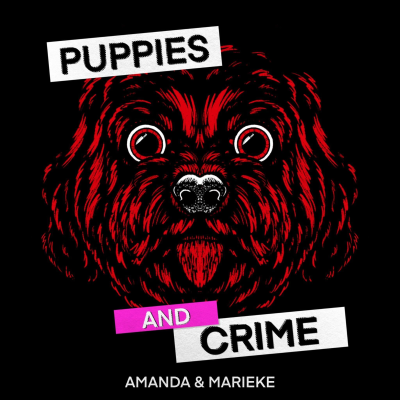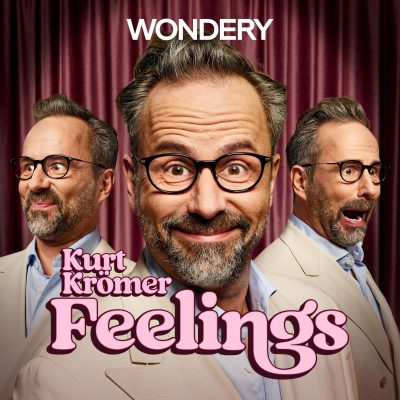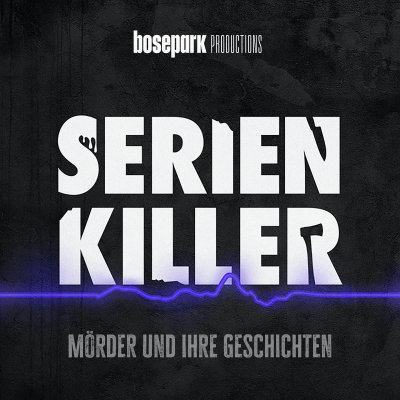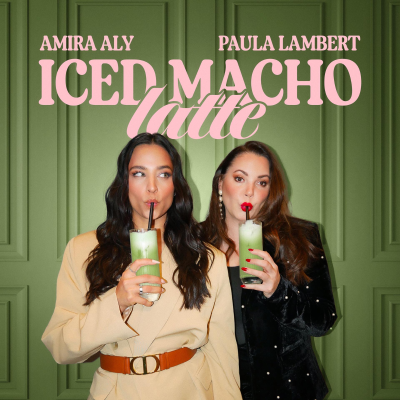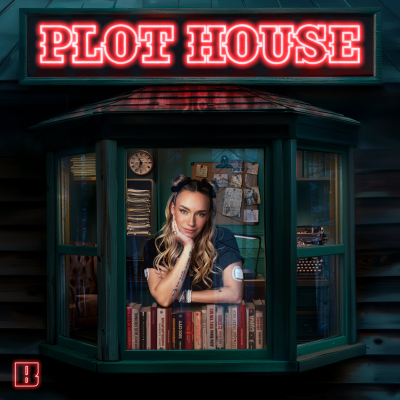NachDenkSeiten – Die kritische Website
Podcast von Redaktion NachDenkSeiten
Nimm diesen Podcast mit
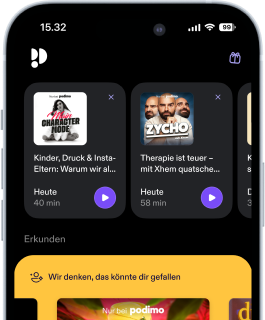
Mehr als 1 Million Hörer*innen
Du wirst Podimo lieben und damit bist du nicht allein
Mit 4,7 Sternen im App Store bewertet
Alle Folgen
4248 FolgenVokabelkritik ist zu Kriegszeiten das Gebot der Stunde. Ich veröffentliche in unregelmäßigen Abständen eine Sammlung teils verharmlosender, teils lügenhafter Wörter oder Formulierungen, deren Sinn und Funktion es ist, unsere Gesellschaft – uns alle – möglichst geräuschlos in Richtung „Kriegstüchtigkeit“ umzukrempeln. Von Leo Ensel. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. nachhaltige Wehrhaftigkeit [https://www.baks.bund.de/de/arbeitspapiere/2025/noch-nicht-krieg-aber-auch-nicht-frieden-drei-impulse-fuer-die-nationale] Passgenauer Jargon für die woke Truppe! „Der gesellschaftliche Zusammenhalt bildet das Fundament nachhaltiger Wehrhaftigkeit.“ Postuliert das uns bereits bekannte Arbeitspapier „Noch nicht Krieg, aber auch nicht Frieden“, das der deutschen Sprache ja bereits die „Diskurstüchtigkeit“ geschenkt hat. – „Diskurs“, „nachhaltig“… Offenbar war hier beim Latte mit Hafermilch ein ins Olivgrün gewendeter Sozialwissenschaftler am Werke! Versuch, das Militärische moralisch zu entgiften, ohne auf den Krieg zu verzichten. Vereint daher das Beste aus zwei Welten – Krieg und Gewissen – zu einem Begriff, der klingt wie Militarismus mit Öko-Siegel, Panzer mit Hybridantrieb, Kasernen mit Solardach. Na denn: Auf zum klimaneutralen Atomkrieg! neutralisieren [https://www.nachdenkseiten.de/?p=134955] „Ziel neutralisiert.“ – Auf Deutsch: unschädlich gemacht, ausgeschaltet – getötet! Und zwar möglichst klinisch-rein via Joystick, falls das noch nötig sein sollte … (vgl. „ausschalten“, „liquidieren“) NGO (Non-Governmental Organization) Das Wort „Nichtregierungsorganisation“ signalisiert auf den ersten Blick stets etwas Positives: zivilgesellschaftliches Engagement nach dem Motto „Alles Gute kommt von unten“. – Weit gefehlt! Diese unschuldigen Zeiten sind lange vorbei. Allein über das vom Bundesfamilienministerium finanzierte Bundesprogramm „Demokratie leben!“ werden im laufenden Jahr rund 580 Projekte mit einer Gesamtsumme von 182 Millionen Euro gefördert [https://www.tagesspiegel.de/politik/staatliche-forderungen-welche-ngos-wie-viel-geld-bekommen-13283785.html]. Heerscharen regierungsfreundlicher „NGOs“ wie die schon vor dem Pflegeheim staatlich gepamperten „Omas gegen Rechts“, BUND und Greenpeace, das Recherche-Netzwerk Correctiv, Campact, Attac, die Amadeu Antonio Stiftung, Peta, Animal Rights Watch, Foodwatch, die Deutsche Umwelthilfe, Agora Agrar, Agora Energiewende, das Netzwerk Recherche, der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen etc. (die Auflistung tendiert ad infinitum) – die zahllosen, sonst arbeitslosen Sozialwissenschaftler-Sternchen-innen, Politolog-Doppelpunkt-innen und Genderforschenden ein auskömmliches Einkommen ermöglichen –, haben sich zu einem grandiosen, kaum noch überschaubaren bunt-diversen Filz ausgewachsen. Dazu treffend die Welt [https://www.deutschlandfunk.de/die-presseschau-aus-deutschen-zeitungen-8114.html?utm_source=chatgpt.com]: „Eine staatlich finanzierte Zivilgesellschaft ist keine Zivilgesellschaft. Die Grünen haben sich in den letzten Jahrzehnten in strategischer Fortführung des Marsches durch die Institutionen in ihrer Rebellionsgeste verbeamten lassen.“ Mit Fug und Recht spricht man daher mittlerweile von „GONGO“ [https://en.wikipedia.org/wiki/Government-organized_non-governmental_organization] (Government-Organized Non-Governmental Organization)! Die seinerzeit von betroffener Seite hysterisch als „zu befürchtender Großangriff auf die emanzipatorische Zivilgesellschaft“ [https://www.spiegel.de/politik/deutschland/union-setzt-mit-551-fragen-gemeinnuetzige-organisationen-unter-druck-linke-und-gruene-ueben-scharfe-kritik-a-b48f89b3-2460-4400-aad4-dac99ede9284] titulierte Parlamentarische Anfrage der Unionsfraktion mit ihren 551 Fragen [https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/union-kleine-anfrage-ngos-faq-100.html] zur staatlichen Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen hatte durchaus ihre Berechtigung. Verlief aber im Sande. – By the way: Nur Initiativen gegen die irrwitzige Aufrüstung, Kriegsgefahr und für das sofortige Ende des wechselseitigen Tötens und Sterbens, für Abrüstung, eine atomwaffenfreie Welt und eine „Pariser Charta 2.0“ fehlen in dieser illustren Runde … (Und das sollte auch so bleiben!) offen, öffentlich und offensiv [https://makroskop.eu/22-2025/notizen-aus-der-provence-peter-sloterdijk-und-die-deutschen-weicheier/] Mit diesem wahren Alliterations-Hattrick beglückte uns der ins Lager der „Kriegstüchtigen“ gewechselte (?) Salonphilosoph fürs elitäre Pack, Peter Sloterdijk, am 15. Juni 2025 in der Frankfurter Allgemeinen am Sonntag: „Wenn wir anfangen, offen und öffentlich und offensiv über die Entsendung von europäischen Bodentruppen in die Ukraine nachzudenken, dann stellen wir die verlorene strategische Ambiguität wieder her.“ Er bemängelte – und da kommt man schon ins Schlottern – die „Abrüstungsmentalität“ der Deutschen und beklagte einen allgemeinen Verlust an männlicher Haltung. Wir hätten nach dem Zweiten Weltkrieg „die Gesellschaft total demobilisiert“ und seien damit „zu weit gegangen“. In Frankreich seien hingegen „heroische Haltungen besser tradiert worden“. Dort habe man „immerhin die Fremdenlegion nicht abgeschafft“ – wir dagegen „haben den berühmten Bürger in Uniform“. (Für den wir uns offenbar schämen müssen.) Und er ergänzte [https://www.koha.net/de/bote/peter-sloterdijk-shumica-e-europianeve-nuk-e-dine-me-qe-urrejtja-ndaj-europes-ne-lindje-ka-filluar-ne-levizjen-pansllaviste]: „Europa erlebt derzeit, historisch gesehen, etwas, das einem Glück gleicht. Wir haben wieder Feinde. Echte Feinde.“ – Ja. Welch ein unverdientes „Glück“! (vgl. „friedlichster Mann der Welt“) preppen „Preppen“, so schreibt [https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/bevoelkerungsschutz-2021/327994/preppen/] die Bundeszentrale für politische Bildung, „ist ein aus den USA kommender Trend, der sich seit etwa 2010 auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit erfreut. Im Zentrum von Preppen, abgeleitet vom Englischen ‚to prepare‘ (vorbereiten), steht die Vorbereitung auf zukünftige Krisenereignisse.“ Wozu natürlich auch Kriege gehören. „Sind Sie bereit für Krieg?“ [https://www.prepper.de/preppern-in-kriegszeiten/] oder „Krieg in Deutschland – Wie Sie sich vorbereiten“ [https://vorsorgeliste.de/ratgeber/krieg-in-deutschland-wie-vorbereiten/] – unter solchen Überschriften liefern einschlägige Websites für den sich ‚zunehmender Beliebtheit erfreuenden‘ Trend die entsprechenden Überlebenstipps. Als da wären: Schutzräume kennen, Notfallrucksack packen, Warnsignale verstehen, Grundvorräte anlegen, Kurbelradio und Erste-Hilfe-Koffer bereithalten, Bargeldreserve einplanen etc. – Wir wünschen fröhliches Preppen für den künftigen Krieg in Deutschland! (vgl. „Bereit sein ist alles“, „Schutzraum“) Produktionskrieg [https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-06/den-haag-nato-gipfel-mark-rutte-appell-umsetzung-zielvorgabe-verteidigungsausgaben] Den konstatierte – zufällig am Vorabend des aktuellen NATO-Gipfels in Den Haag – der Generalsekretär des westlichen Militärbündnisses, Mark Rutte. Der Westen befände sich in „einem neuen Produktionskrieg gegen Russland“. Diesen müsse die NATO gewinnen. Russland produziere aktuell in drei Monaten so viel wie die gesamte NATO in einem Jahr – obwohl ihre Wirtschaft 25-mal kleiner sei, tönte er. (Und das auch noch nach dem siebzehnten EU-Sanktionspaket …) Die überraschende Schlussfolgerung: Die jährlichen „verteidigungsrelevanten Ausgaben“ der Bündnisstaaten müssen auf mindestens – mindestens! – fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht werden. Damit „ruinieren“ wir allerdings nicht Russland, sondern uns selbst! raues geopolitisches Umfeld [https://x.com/bundeskanzler/status/1938362676436210056] Der Tweet des von seinem ersten EU-Rat „mit einem sehr guten Gefühl nach Hause“ zurückkehrenden Kanzlers Merz klingt, als wäre die Konfrontation vom Himmel gefallen. Keine Akteure, keine Geschichte – nur Wetter. Wer so redet, muss sich nicht erklären. Und will auch nichts ändern. Realpolitik Einst Inbegriff der Nüchternheit – heute oft ein Euphemismus für: „Moralische Skrupel sind naiv und aus der Zeit gefallen.“ Wer von Realpolitik spricht, meint oft: „Wir müssen so handeln wie die anderen auch.“ Der Maßstab der anderen wird zur Ausrede. Rechtsextreme, Russlandfreunde und Verschwörungsanhänger [https://www.spiegel.de/panorama/justiz/compact-magazin-bundesverwaltungsgericht-in-leipzig-hebt-verbot-auf-a-9da8ca80-6c22-4325-8ecb-b8a839bc4098] Für diese drei ist laut Spiegel Online das Compact-Magazin des Jürgen Elsässer „eines der führenden Medien“. Die implizite – leicht durchschaubare – bösartige Propaganda dieser Formulierung besteht darin, alle Menschen, die sich um eine Verständigung mit Russland bemühen, buchstäblich in die Mitte von Outcasts wie Rechtsextremen und „Verschwörungsanhängern“ (was auch immer das genau heißen mag) zu rücken. regelbasierte Armee [https://www.zdf.de/play/magazine/zdf-morgenmagazin-104/moma-vor-ort-ingolstadt-bundeswehr-102] Die PR-kompatible Schwester der „wertebasierten Außenpolitik“. „Gerade hier in Deutschland mit einer demokratischen Armee, mit einer regelbasierten Armee sind wir nicht mehr dazu da, fremde Länder zu erobern oder Völker zu unterdrücken, sondern genau das zu verhindern“, verkündete vor Schülern Oberstleutnant „Max“ im Tarnanzug, mit vermummtem Gesicht und Sonnenbrille – „wegen des russischen Geheimdienstes“, denn er bildet in der Ingolstädter Pionierschule auch ukrainische Soldaten aus – am 23. Juni 2025 im „Morgenmagazin“ des ZDF. Auf diese Weise hat „Max“ auch schon einmal (ohne fremde Länder zu erobern) die „regelbasierte Weltordnung“ verteidigt. Im Gefecht in Afghanistan. Resilience Factory [https://www.hartpunkt.de/helsing-baut-6-000-ki-befaehigte-hx-2-kampfdrohnen-fuer-die-ukraine/] Fabriziert – hätten Sie‘s geahnt? – natürlich „Resilienz“. Will sagen, die Kamikazedrohne HX-2 [https://helsing.ai/de/hx-2] für die von Investorengiganten wie Spotify-Mitgründer Daniel Ek unterstützte [https://www.nachdenkseiten.de/?p=134955] Rüstungsfirma Helsing. By the way: Wie der Journalist Ralf Wurzbacher [https://www.nachdenkseiten.de/?p=134738] schreibt, „gehen 70 Prozent der Opfer des Ukrainekriegs auf das Konto von Drohnen“. In einzelnen Schlachten sollen es sogar 80 Prozent sein. Wer das überlebt, ist „resilient“. Indeed! Rüstungswahnsinn Reingefallen, Leser-Sternchen-innen! Dieser längst vergessene, im aktuellen Diskurs aber dringendst benötigte – und zur Abwechselung mal nicht lügenhafte – Begriff wurde hier eingefügt, weil er gerade im Mittelpunkt des kollektiven Wegschauens steht. Was selbst wiederum einer Lüge gleichkommt … ruinieren [https://www.welt.de/politik/ausland/article237145901/Ukraine-Krieg-Baerbock-bestaetigt-EU-Sanktionen-gegen-Putin-und-Lawrow.html] Wollte, die hohe Schule der Diplomatie betreibend, unsere Ex-Außenministerin mit dem Klassensprecherinnen-Habitus Russland bereits am zweiten Tag nach dessen Überfall auf die Ukraine. Hat allerdings nicht so ganz geklappt. (vgl. „immer ein Feind“) schnellstmöglich [https://www.nachdenkseiten.de/?p=134646] Schnellstmöglich hat nun alles mit dem „Erlangen von Kampfkraft“ zu gehen. Vorgestern noch 2030, gestern 2029, nun erleben wir bereits laut Sönke Neitzel den „letzten Friedenssommer“. Unsere medial omnipräsenten „Experten“ können offenbar nicht schnell genug Deutschlands Söhne und Töchter in den angeblich fast unvermeidlichen Krieg gegen Russland schicken! Eine konkrete Bedrohungsanalyse kann man sich bei diesem Tempo sparen. – So tönte man auch vor 111 Jahren im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Das Resultat ist bekannt. (vgl. „viel zu langsam“) sein Leben geben Neulich am 15. Juni, dem ersten bundesdeutschen Veteranentag, in der „Tagesschau“ [https://www.youtube.com/watch?v=KOeWCA9W7zM]: „Stephan K., 35 Jahre alt, Veteran. 2011 geht der Scharfschütze für die Bundeswehr nach Afghanistan, da ist er 20 Jahre alt. Erlebte einen Anschlag, bei dem ein Freund stirbt – Erfahrungen, die er bis heute mit sich rumschleppt.“ Der ehemalige Scharfschütze im O-Ton: „Im ersten Einsatz mit 20 Jahren und dann einen der heftigsten Anschläge auf die Bundeswehr, dass ein ganzer Schützenpanzer Marder zersprengt wird und einer von uns sein Leben gegeben hat, das bleibt im Kopf!“ Und nun wieder die „Tagesschau“: „Das Erlebte verarbeitet er musikalisch. Er rappt über sein Gefühl, von der Gesellschaft vergessen zu sein, vom Staat und von der Bundeswehr.“ Stephan K. wünscht sich, dass die vorübergehenden Leute ihm als Afghanistanveteranen „Danke für deinen Dienst!“ sagen. – Diese Geschichte kann man auch etwas anders erzählen: Die betreffenden Soldaten „gingen“ nicht einfach „für die Bundeswehr nach Afghanistan“, sie waren – zumindest nicht gegen ihren grundsätzlichen Willen – dort Teil einer militärischen Spezialoperation der deutschen Armee. Stephan K. immerhin als Scharfschütze (Sniper) – wird er sein G22 oder G82 nie benutzt haben? –, sein Kollege als Fahrer eines Schützenpanzers [https://de.wikipedia.org/wiki/Marder_(Sch%C3%BCtzenpanzer)] mit einer „zuverlässigen 20-mm-Maschinenkanone“ an Bord. (Die ihm möglicherweise ebenfalls zuverlässige Dienste geleistet hat.) Das passte dort nicht allen Menschen, und einige setzten sich – ebenfalls militärisch – dagegen zur Wehr. Der betreffende Panzerfahrer „gab“ nicht jesusgleich „sein Leben“, es hat ihn einfach erwischt! Das klingt nicht schön, aber genauso war es. Der Sniper bekam das mit – „erlebte“ es – und erwartet dafür nun von der Gesellschaft „Wertschätzung“. By the way: Könnte es sein, dass aufgrund der Aktivitäten des Snipers einige Afghanen ebenfalls ihr Leben „geben“ mussten? Dass er diesen deren Leben also „genommen“ hat? Oder hat er niemals getroffen? (Noch etwas: Man stelle sich kurz die Berichterstattung der „Tagesschau“ vor, hätte es sich hier nicht um einen Deutschen, sondern um einen 20-jährigen russischen Scharfschützen gehandelt, der „für seine Armee“ in die Ukraine „gegangen“ sei und dessen Freund in einem Panzer – „mit einer zuverlässigen Maschinenkanone“ – bei einem ukrainischen Anschlag „sein Leben gegeben“ hätte …) (vgl. „Veteranenkultur“) Sprache Die einzige, die Putin versteht. Ist natürlich nicht Russisch (oder etwa Deutsch), sondern die „Sprache der Stärke“! (wird fortgesetzt) Die ersten sieben Folgen erschienen am 29. Mai [https://www.nachdenkseiten.de/?p=133673], 2. Juni [https://www.nachdenkseiten.de/?p=133905], 22. Juni [https://www.nachdenkseiten.de/?p=134771], 2. Juli [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135442], 6. Juli [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135574], 20. Juli [https://www.nachdenkseiten.de/?p=136184] und am 11. August 2025 [https://www.nachdenkseiten.de/?p=137231]. Dieser Beitrag ist zuerst auf Globalbridge erschienen [https://globalbridge.ch/das-woerterbuch-der-kriegstuechtigkeit-viii-nachhaltige-wehrhaftigkeit-ngos-und-regelbasierte-armee/]. Titelbild: arvitalyaart/shutterstock.com
In seinem neuen Buch „Die fehlenden Worte“ bietet Thorsten Bohnenberger (wenn auch fiktiv) genau das an, worauf viele Betroffenen der Corona-Maßnahmen immer noch vergeblich warten – eine ernst gemeinte Entschuldigung der Verantwortlichen. Eine Rezension von Martin Beck. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Es war Jens Spahn, der im April 2020 sagte: „Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen.“ Ich überlege mir noch heute, was mir Jens Spahn verzeihen könnte. Wahrscheinlich war ich auch gar nicht gemeint. So vertraulich spricht er nicht mit mir, und wofür sollte ich ihm jetzt genau verzeihen? Dieses vieles im Ungewissen lassende Eingeständnis wurde im Deutschen Bundestag ausgesprochen. Es war an Leute seiner Bedeutung, nicht an die Menschen im Lande, wie Helmut Kohl es formulieren würde, adressiert. Diese Aussage kam allerdings in den Medien gut an – so gut, dass Spahn sie als Titel für sein im Jahre 2022 erschienenes Buch wählte. Inhaltlich mehr eine Erzählung, eher eine Rechtfertigung denn eine Entschuldigung. Offensichtlich war dem Politiker selbst nicht ganz klar, wen, wofür und wie er um Verzeihung bitten sollte. In einem Interview mit dem pro-medienmagazin.de im Dezember 2022 fiel Jens Spahn auf die Frage „Wen müssen Sie rückblickend um Verzeihung bitten?“ die Antwort ein: „Wenn ich diese Frage in Gruppen denke, dann auf jeden Fall Familien mit Kindern.“ Also irgendwas mit Familie? Doch es fehlten ihm wohl die Worte, um konkret die Bitte um Verzeihung an diese Gruppe zu formulieren. Vielmehr geriet er gegenüber dem christlichen Medienmagazin sehr ins Schwimmen, fast hätte ich ‚ins Schwurbeln‘ gesagt: „Beim Verzeihen geht es mir besonders um den, der verzeiht. Wichtig ist aus meiner Sicht eine Erbittlichkeit. Das Gegenteil wäre Unerbittlichkeit. Es geht natürlich darum, Fehler aufzuarbeiten und zu besprechen. Aber es geht nicht darum, Fehler wegzuwischen oder schönzureden. Die Bereitschaft des Verzeihens setzt im Übrigen auch das Wissen voraus, dass man selbst Fehler hätte machen können.“ Er scheint sich nicht so ganz im Klaren darüber, ob er nun der Verzeihende oder der um Verzeihung Bittende ist. Nun gut, wenn man „einander verzeiht“, dann macht es vielleicht schon Sinn: Ich verzeihe dir dieses, du verzeihst mir jenes. So ernst kann es keiner der damals Regierenden, Entscheidenden, Beratenden und Medienschaffenden mit Spahns Ankündigung genommen haben. Von daher grenzte es an ein Wunder, wenn er sich jetzt, drei Jahre nach der Veröffentlichung von Spahns Buch und dem offiziell erklärten Ende der Pandemie ohne Wenn und Aber zu seiner Verantwortung bekennt: „Ich habe Angst verbreitet und Menschen unter Druck gesetzt.“ So heißt es in dem Buch von Thorsten Bohnenberger. Um Jens Spahn zu einer solchen Erklärung zu bringen, bedurfte es nicht kritischer Journalisten, nicht hartnäckigen Nachfragens, nicht des Insistierens. Es bedurfte eines Menschen, der tief betroffen war: „Ich selbst stand während der Corona-Zeit auf der Seite der Maßnahmenkritiker. Ich habe erlebt, wie es ist, verachtet, verlacht, gemieden und angefeindet zu werden – nur weil ich Fragen stellte oder eine andere Einschätzung hatte.“ So Thorsten Bohnenberger, studierter und promovierter Informatiker und Wirtschaftswissenschaftler, der es geschafft hat, verantwortliche Politiker, Wissenschaftlerinnen und Medienschaffende zu nachdenklichen, einfühlsamen und reuevollen Erklärungen anzuhalten. Dank der künstlichen Intelligenz, unter interaktiver Mithilfe von ChatGPT. Um es vorwegzunehmen: Das Buch der beiden (Bohnenberger und ChatGPT) erinnert mich an die „Feuerzangenbowle“, den meisten bekannt, weil sie die Verfilmung mit Hans Rühmann in der Hauptrolle im jährlichen Ritual zu Weihnachten oder Silvester im Fernsehen erleben dürfen: Am Ende seiner Erzählung deckt der Autor Heinrich Spoerl auf, dass es weder den Protagonisten noch den Ort der Erzählung noch die Handlung in Wirklichkeit gab. Die Geschichte ist „von A bis Z erlogen. Frei erfunden wie alle Geschichten.“ „Wahr“, schreibt Spoerl, „sind die Erinnerungen, die wir mit uns tragen; die Träume, die wir spinnen, und die Sehnsüchte, die uns treiben.“ Wahr ist am Buch von Thorsten Bohnenberger, dass es geschrieben ist aus der Sehnsucht nach Versöhnung. Mit ChatGPT spinnt er an den Darlegungen und Entschuldigungen der Politiker, er ruft nochmals all die Maßnahmen in Erinnerung, welche oft genug Freiheitsrechte einschränkten, deren Begründungen, die mediale Begleitung, die in bestimmten Phasen zur Hetze wurde. In Bohnenbergers Buch erwachsen den Verantwortlichen und den Entscheidungsträgern Empathie für die andere Seite und Einsicht in die eigenen Fehler. Wahr ist für einen nicht unwesentlichen Teil unserer Bevölkerung, dass sie Verletzungen ertragen hat, sie nicht aussprechen konnte oder wollte. Wahr sind unbegreifliche Maßnahmen wie das Sperren von Kinderspielplätzen und Sitzbänken. Wahr sind die Schuldzuweisungen wegen der Pandemie an sogenannte Ungeimpfte, zu denen man auch mich zählte, obwohl ich doch gegen alles Mögliche geimpft bin, sogar gegen Tollwut, nur nicht mit BioNTech. Wahr ist, dass ich mich als Sozialdemokrat von der Co-Vorsitzenden der SPD Saskia Esken, die ich bei der Urwahl gewählt hatte, als „Covidiot“ beschimpft und diffamiert sah. Nachdem Olaf Scholz entgegen seiner Versprechungen als Bundeskanzler für die Impfpflicht eintrat, trat ich nach 50 Jahren SPD-Mitgliedschaft aus. Wie würde ich mich freuen, wenn Saskia Esken erklärte (im Buch S. 44 ff.): „Während der Corona-Pandemie hatte ich (…) die Möglichkeit, den gesellschaftlichen Dialog zwischen den Menschen zu fördern und zu verhindern, dass sich Gräben in unserer Gesellschaft vertiefen (…). Ich habe früh in der Pandemie den Begriff ‚Covidioten‘ in die öffentliche Debatte eingeführt. Mit dieser abwertenden Bezeichnung habe ich pauschal Menschen herabgewürdigt, die Fragen zu den Corona-Maßnahmen stellten oder die Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen hinterfragten.“ Wie glaubwürdig wäre es, wenn sie erklärte: „Ich entschuldige mich bei den Menschen, die durch den Begriff ‚Covidioten‘ stigmatisiert wurden und das Gefühl hatten, nicht mehr zur Gesellschaft zu gehören. Ich entschuldige mich bei denjenigen, die durch meine Unterstützung für harte Maßnahmen wirtschaftliche oder psychische Schäden erlitten haben.“ Immerhin müsste ich den guten Willen einräumen, die Bereitschaft, auf die „anderen“ zuzugehen. Was alles habe ich schon vergessen und wen, wenn ich von meiner eigenen Betroffenheit absehe? Das Buch der Entschuldigungen ruft zwei harte Jahre bis ins Detail in Erinnerung. Manche Fakten sind bekannt, manche neu. Den Entschuldigungen gehen diese Darlegungen zu den Handlungen der Betroffenen voran. Insgesamt finden sich in diesem Buch auf 288 Seiten 52 ausführliche und begründete Entschuldigungen. Die Texte sind leicht lesbar. Alle folgen einer einheitlichen Gliederung. Die betroffenen Personen oder Gruppen stellen sich vor. Sie benennen ihren Anteil an den Maßnahmen in ihrer jeweiligen Funktion, ob als Berater, Entscheidungsträger, in der Umsetzung oder in der medialen Begleitung. Es wird die Wirkung und die eigene Verantwortung reflektiert, darauf die Entschuldigung formuliert. Ein persönliches Fazit verweist auf Folgerungen für zukünftiges Handeln. Hier seien nur einige Kapitel aufgeführt: Es stehen zu ihrer Verantwortung in der Corona-Zeit neben Jens Spahn auch Angela Merkel „Ich habe Grundrechte eingeschränkt und den Rechtsstaat beschädigt“, Horst Seehofer „Ich habe die Bevölkerung durch Angst manipuliert und unqualifizierte Berater eingesetzt“, Olaf Scholz „Ich habe meine Überzeugungen dem politischen Kalkül untergeordnet“, Winfried Kretschmann „Ich habe die Demokratie durch autoritäres Handeln beschädigt“, Ursula von der Leyen „Ich habe mein Amt für intransparente Entscheidungen missbraucht“. Selbstverständlich erfasst die Fantasie von ChatGPT und Bohnenberger auch die real existierende wissenschaftliche Begleitung und die Beratungsinstanzen der Politik, z.B. Alena Buyx, Lothar Wieler, Christian Drosten. Neben Medienschaffenden wie Tom Buhrow, Patricia Schlesinger und Christine Strobl („Wir haben unsere journalistische Verantwortung verraten“) gestehen mit Sarah Frühauf und Nikolaus Blome weitere Journalistinnen und Journalisten ihre Beiträge während der Pandemie als spaltend oder diffamierend ein. Buchautor Bohnenberger und Co-Autor ChatGPT machen nicht Halt an deutschen Grenzen: Christine Lagarde, Emmanuel Macron, Karl Nehammer, Justin Trudeau, Donald Trump, Joe Biden, Anthony Fauci, Bill Gates haben gute Gründe, um Verzeihung für ihr Handeln während der Pandemie zu bitten. Doch auch ganze Gruppen wie zum Beispiel die Richter, die Polizeiführung, die Kirchenvertreter, Krankenhausdirektoren, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Gewerkschaften und Berufsverbände, Bildungsministerien, Schulleitungen und Lehrer kommen mit Selbstkritik zu Wort. Es ist spannend, zu lesen, was denn fiktiv bereut wird, wie die Verantwortlichen um Verzeihung bitten, die „fehlenden Worte“ finden. Alles bleibt jedoch in der Sphäre der Fiktion. Wahr ist nur, was Thorsten Bohnenberger selbst im Kapitel 52 für die Maßnahmenkritiker formuliert: „Liebe Mitmenschen, die ihr auf der anderen Seite standet, (…) Wir möchten euch sagen: Auch wir haben Fehler gemacht (…). Wir entschuldigen uns dafür, dass wir nicht immer die Ruhe und Geduld hatten (…). Wir entschuldigen uns für unsere scharfen Worte, unsere Verachtung, unsere Wut – auch wenn sie aus tiefem Schmerz kam.“ Letztlich steckt also in dem Illusionisten Thorsten Bohnenberger vielleicht doch ein sozialdemokratischer Kern? Versöhnen statt Spalten? „Am Ende wollen wir nicht Recht behalten. Wir wollen nicht triumphieren. Wir wollen wieder einander in die Augen sehen können.“ Hier will ich nochmals auf Jens Spahn zurückkommen, nicht weil der fiktive Jens Spahn die „Maskenaffäre“ des real existierenden Jens Spahn verschweigt und ich damit sagen möchte, wie ähnlich doch die beiden Spahns sind und wie gut ChatGPT sich in reale Personen eindenken kann; sondern weil Jens Spahn im Vorwort (S. 13) seines schon erwähnten Buches pathetisch übertreibt: „Ich glaube an die Kraft der demokratischen Debatte. Demokratien lernen aus ihren Fehlern und passen ihr Handeln immer wieder der neuen Realität an. Das macht sie stark. Autokratien sind dazu nicht in der Lage.“ All die unkritischen Ehrungen von Verantwortlichen aus der Covid-Zeit lassen doch an der Stärke unserer Demokratie zweifeln. Das Gedankenexperiment „Die fehlenden Worte“ zeigt – vielleicht ungewollt – diese Differenz auf. Thorsten Bohnenberger: Die fehlenden Worte. Ein Gedankenexperiment über Verantwortung, Vergebung und gesellschaftlichen Frieden nach der Corona-Zeit. Berlin 2025, epubli (Selbstverlag) [https://www.epubli.com/shop/die-fehlenden-worte-9783819075315], Taschenbuch, 288 Seiten, ISBN 9783819075315, 14 Euro. Titelbild: PeopleImages.com – Yuri A
Das Festival „Musik statt Krieg“ ist weit mehr als eine musikalische Veranstaltung; es ist ein Zeichen der Friedensbewegung. Ins Leben gerufen von Tino Eisbrenner, einem der bekanntesten Künstler Ostdeutschlands, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen durch die Kraft der Musik zu verbinden. Anstatt mit politischen Reden zu polarisieren, setzt das Festival auf Harmonie, Vielfalt und den Abbau von Vorurteilen. Im Interview spricht Tino Eisbrenner über die Herausforderungen und die Gemeinschaft hinter seinem Festival, die Bedeutung von Kunst in der heutigen politischen Landschaft und seine persönlichen musikalischen Einflüsse aus aller Welt. Mit Tino Eisbrenner hat Éva Péli gesprochen. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Éva Péli: Am Morgen nach der 23. Ausgabe des Festivals „Musik statt Krieg“ blicken wir mit Tino Eisbrenner auf die Veranstaltung zurück. Tino Eisbrenner: Nun, einiges bleibt gleich, wie der immense Aufwand bei der Vorbereitung. Ich habe gelernt, die Dinge in kurzer Zeit zu stemmen. Zwei Wochen vor dem Fest ist bei mir kein Urlaub mehr drin, weil ich mich voll aufs Festival konzentrieren muss: Genehmigungen, Versicherungen, Bestellungen – diese zwei Wochen sind sehr intensiv. Was sich über die Jahre verbessert hat, ist die Zahl der Helfer. Sie sehen die Arbeit als ihre eigene an. Da gibt es zum Beispiel jemanden, der kommt mittwochs und kümmert sich um alle technischen Anschlüsse. Er ist wie ein richtiger „Festival-Hausmeister“, der sogar Arbeiten sieht, von denen ich nichts wusste. Das ist wirklich toll. Viele Dinge sind Routine, der Kraftaufwand ist aber groß. Doch dank der helfenden Menschen werden uns manche Aufgaben abgenommen. So entsteht Gemeinschaft. Meine Partnerin Sofia hat in den letzten Jahren eine Galerie hinzugefügt. Am Anfang waren es nur ihre und die Bilder einer weiteren Person, aber inzwischen haben wir vier oder fünf Künstler, die verschiedene nicht-musikalische Werke ausstellen. Im Vorfeld treffen wir uns auch mit dem Songland-Club [https://www.eisbrenner.de/songlandclub/]. Dieser entstand während der Corona-Zeit, weil ich nicht nur Spenden annehmen, sondern auch etwas zurückgeben wollte. Unsere Internetseite ist wie eine Club-Zeitung, in die ich Videos, Reisegeschichten und unveröffentlichte Aufnahmen hochlade. Die Mitglieder unterstützen mich jährlich mit einer Spende für künstlerische Projekte wie CD-Produktionen oder, wie in diesem Jahr, die Veröffentlichung meines Buches in Russland. All das wird mit der Hilfe des Songland-Clubs eigenfinanziert. Das Geld reicht zwar nicht immer, aber ein Puffer hilft ungemein, solche Projekte zu realisieren. Wie viele Leute helfen Ihnen inzwischen? Ich schätze, es sind etwa 20 Leute, die uns im Vorfeld und während des Festivals unterstützen. Einige kommen direkt am Festivaltag, um am CD-Stand oder am Einlass zu helfen. Unser Stefan reist von weit her an und steht die ganze Zeit vorne auf der Straße, regelt den Camper-Verkehr, obwohl er Eintritt bezahlt hat. Man muss ihn fast dazu prügeln, auch mal reinzukommen und sich etwas anzusehen. Aber sie machen das von Herzen, weil sie das Projekt unterstützen wollen. Man muss sich wirklich darum kümmern, dass sie auch etwas vom Festival mitbekommen. Wie war es inhaltlich, vom Zuspruch des Publikums her, im Vergleich zu den 22 Festivals davor? Der Name sagt es schon: Es war immer ein politisches Festival. Wir hatten immer Künstler und Gäste, die sich politisch einig waren. Wir haben das aber nicht mit Vorträgen in den Vordergrund gestellt, wie es bei anderen Festivals oft gemacht wird. Wir versuchen, über Musik und Kunst einen Ausgleich zu schaffen – ein „Aufatmen“. Alle, die das Jahr über in den politisch „dreckigen Winden“ stehen, können hier in der Gemeinschaft wieder freie Sicht bekommen. Ich habe über die Jahre den deutschen Anteil vergrößert. Am Anfang war alles sehr weltmusikalisch. Wir hatten Leute aus fast allen Kontinenten hier – aus Asien, den USA, Kanada und Lateinamerika, das ist fast immer dabei, genauso wie der europäische und osteuropäische Kontinent. Sogar indische Musiker hatten wir schon. Dadurch hat sich auch die Spreu vom Weizen getrennt. Beim ersten Festival kamen 600 Leute, die Rock ’n’ Roll erwarteten und stattdessen brasilianische Musiker oder Leute aus dem Irak, die Oud spielten, bekamen. Nach den ersten drei Jahren wussten die Leute, was sie erwartet. Gerade in den letzten Jahren, wo die Frage nach Statements von deutschen Künstlern lauter wird, habe ich bewusst versucht, mehr von ihnen zu versammeln und ihnen eine Bühne zu geben. Ich sage immer: „Es gibt ganz viele davon, aber sie dringen manchmal nicht durch.“ Durch meine Teilnahme am Moskauer Festival „Doroga na Jaltu“ bin ich in der Friedensbewegung bekannter geworden. „Da ist einer, der ist nach Moskau gefahren, im Kreml hat er gesungen!“ Das spricht sich schnell herum. Aber viele andere machen auch wertvolle Arbeit, ohne so durchzudringen. Ich bringe sie hier vor unser Publikum, damit sie merken, dass sie nicht allein sind. Dieses Jahr waren zum Beispiel Michael Seidel, ein politisch engagierter Künstler, und Corinna Gehre dabei, die in der Corona-Zeit ihre Stimme im Widerstand gegen die Ausgrenzung von Ungeimpften fand. Auch mein Freund Alejandro Soto Lacoste [https://www.alejandrosotolacoste.com/], mit dem ich seit 20 Jahren spiele, war da. Er moderiert inzwischen auf Deutsch oder spielt auch mal deutsche Stücke mit lateinamerikanischer Note, zum Beispiel ein Lied von Bettina Wegener oder einen Song von mir, die ihn persönlich berühren. Die lateinamerikanische Musik ist ein fester Bestandteil Ihres Repertoires. Bei diesem Auftritt war die Alejandro Soto Lacoste Band mit von der Partie. Ja, genau. Lateinamerikanische Musik hat, zumindest für die Ostgeborenen, immer eine politische Rolle gespielt, besonders seit den 70er-Jahren. Die Chilenen, die damals kamen, brachten musikalische Farbe und Rhythmen in unsere Liedermacher-Szene. Viele Lieder wurden in der DDR nachgedichtet und von Liedermachern oder sogar Rockbands gesungen. Lateinamerikanische Musik gehört also einfach in solch ein Festival. Ich habe mich diesmal auch selbst neu erfunden und bin mit der Dresden Big Band aufgetreten. Das war für mich und das Publikum ein Unterschied zu anderen Festivals. Ich spielte Songs aus meiner Anfangszeit, zum Beispiel von Police und Sting, die ich ins Deutsche übertragen habe, aber auch einen Elton-John-Song aus den 70ern und eigene Stücke aus meiner Jessica-Zeit. Mit Tobias Morgenstern [https://www.tobiasmorgenstern.de/] habe ich ebenfalls eigene Sachen geschrieben, die für die Big Band arrangiert wurden, darunter eine deutsch-russische Romanze, für die ich das erste Mal auf Deutsch und Russisch getextet habe. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man politische Gedanken auf eine lyrische Art einbringt. Sie kommen aus der DDR, wo es das Festival „Rock für den Frieden“ und das „Festival des politischen Liedes“ gab. Was ist der Unterschied zu solchen Festivals früher und dem, was Sie heute machen? Der große Unterschied ist, dass solche Sachen heutzutage nicht staatlich gefördert werden. Die Friedensbewegung in Deutschland wird generell nicht gefördert. Das ist ein riesiger Unterschied zu damals und schafft Probleme, aber auch eine gewisse individuelle Freiheit. Was diese Festivals aber vereint, ist die Internationalität – eine Umarmung der Welt mit Musik. Musik hat viel mit Spontaneität zu tun; es entstehen immer neue Räume. Wenn man zu musizieren beginnt, öffnet jeder Musiker, der dazukommt, einen neuen Raum, weil er seine Seele einbringt. Musik strebt immer nach Harmonie. Wenn eine Note schief ist, halten alle inne, bis die Harmonie wiederhergestellt ist. Daher hat Musik auch einen symbolischen Charakter. Musiker müssten eigentlich die besten Friedensbotschafter sein, weil sie Harmoniebotschafter sind. Deshalb ist es für mich ein großer Widerspruch, wenn Musik für den Krieg missbraucht wird. Musik bewegt Massen, und Menschen, die Massen zu einer schlechten Tat bewegen wollen, wissen das. Für mich ist es ein Missbrauch, Musik zu nutzen, damit Leute losziehen und andere erschlagen. Die ursprüngliche Idee der Musik ist die Herstellung von Harmonie. Musik ist die Weltsprache Nummer eins. Man versteht sich über sie überall auf der Welt. Es ist oft egal, in welcher Sprache gesungen wird. In Kaliningrad haben mein Freund Tobias Thiele und ich ein Programm mit Liedern in fünf Sprachen uraufgeführt. Nach kurzer Eingewöhnung war es dem Publikum egal, in welcher Sprache wir sangen. Das war auch die Ursprungsidee von „Musik statt Krieg“, als ich 2002 loszog, um irakische Musiker zu suchen. Die Medien sprachen von der „Achse des Bösen“. Ich dachte: „Das stimmt nicht“ – und habe sie unserem Publikum hier vorgestellt. Daraus entstand die Idee, das auf dem Hof weiterzumachen. Eine kurze Zwischenfrage zur Künstlerauswahl. Uns ist aufgefallen, dass diesmal nur ostdeutsche Künstler dabei waren. War das Absicht? Abgesehen von Chilenen und Chinesen? Wir hatten auch schon westdeutsche Kollegen hier. Meistens lade ich Leute ein, denen ich vorher irgendwo begegne. Da ich mich mehr im Osten bewege, lerne ich mehr ostdeutsche Musiker kennen. Aber seit ich in der Friedensbewegung bekannter bin, bekomme ich auch öfter Anfragen aus dem Westen. Leute aus Flensburg, Bremen und Hamburg fragen, ob ich nicht auch mal zu ihnen kommen kann. Und ich sage immer Ja. Es gibt von meiner Seite keine Sperre. Wenn die Verbindung da ist und man merkt, man gehört zusammen, ist es egal, ob jemand Ost- oder Westdeutscher ist. Ja, in diesem Jahr war es Zufall, dass nur Ostdeutsche dabei waren. Aber schon nächstes Jahr werden Jens Fischer-Rodrian und Lüül dabei sein, beide „Wessis“. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass Sie mit dem Puschkin-Programm öfter im Westen auftreten. Ja, das ist interessant. Das mag am Namen „Puschkin“ liegen. Im Westen kennt man Eisbrenner wenig, aber Puschkin schon. Oft sind es deutsch-russische Gesellschaften, die uns einladen. Sie haben gerade angedeutet, wie es vor 23 Jahren anfing. Wie geht es weiter? Die 25 Festivals machen wir auf jeden Fall voll. Danach müssen wir mal sehen. Es besteht die Gefahr, dass es uns über den Kopf wächst und der Hof zu klein wird, besonders bei schlechtem Wetter. Jedes Mal kommen mehr Menschen zum Festival. Wir stellen ein bestimmtes Kontingent an Tickets online, aber viele Leute, die es nicht online schaffen, kommen einfach und fragen, ob sie noch reinkönnen. Bisher musste ich noch nie jemanden wegschicken, aber gestern war es schon knapp. Die Scheune war rappelvoll. Sie reisen ja viel. Früher vor allem nach Lateinamerika, jetzt viel in den Osten. Wie beeinflussen diese tiefen Eindrücke Ihre künstlerische Tätigkeit und Ihre Sicht auf die Welt? Zunächst stärken sie mein weltbürgerliches Heimatgefühl. Wenn man an einem Ort länger als nur im Urlaub war, dann wird die Welt um ein Stück Heimat erweitert. Ich war dort, um indianische Kulturen zu erleben, und habe meine künstlerische Arbeit dorthin gebracht. So entstehen neue Freundschaften. Manchmal fühle ich mich in Deutschland heimatloser als irgendwo anders, vor allem aus politischen Gründen. Ich stehe nicht hinter der deutschen Politik und sage: „Das hat mit mir nichts zu tun, nicht in meinem Namen.“ Wenn ich nach Russland oder Georgien reise – Georgien hat mich sehr an Bulgarien erinnert, wo ich meine Kindheit verbrachte –, bin ich in einem fremden Land und fühle mich trotzdem unter Menschen, die genauso denken und fühlen wie ich. Obwohl wir aus vermeintlich „nicht befreundeten Ländern“ stammen, sind wir als Menschen befreundet und ich fühle mich sehr heimisch. Dieses Gefühl von Heimat fließt direkt in die Kunst, die ich mache. Die Wahl der Musiker, die Art der Melodien – all das ist vom Herzen gesteuert. Sie waren im Sommer in Frankreich. Was haben Sie dort beobachtet? Als politisch denkender Künstler beobachtet man sofort, wie andere Völker mit ihrer Politik umgehen. Als ich kürzlich einen Freund in Frankreich besuchte, fragte ich ihn, wie sie mit Macrons Politik umgehen. Er sagte, sie lassen Politik bei Familientreffen völlig weg, weil sie sonst an die Decke gehen. Stattdessen sprechen sie über Musik und Essen, sie suchen die Harmonie. Trotzdem sind die Franzosen, was ihren Protest betrifft, viel explosiver als die Deutschen. Die Deutschen sind geduldig, das hat schon Heinrich Heine beschrieben. Wir machen mit, bis es nicht mehr geht, und lassen uns von der Obrigkeit vorschreiben, wie wir uns zu benehmen haben. Dann kommt der Denunziant ins Spiel, wie wir es in der Corona-Zeit erlebt haben. Die Franzosen hingegen gehen auf die Straße, wenn sie genug haben. Nicht umsonst gab es in Frankreich die bürgerliche Revolution. Sie sind die „Revoluzzer“, das finde ich spannend. Als Künstler denke ich, dass man den Deutschen auch ein Stück dieser Haltung erzählen kann, um sie aufzurütteln. Im Mittelalter waren Barden die heutigen Liedermacher, aber auch Nachrichtenüberbringer. Sie zogen von Dorf zu Dorf, sangen Lieder und erzählten den Leuten, was in der Welt vor sich ging. Für mich sind Kunst und Kultur immer ein Transportmittel für Herzensangelegenheiten und Informationen. Und Informationen können entweder spalten oder verbinden. Als Künstler versuche ich, Informationen zu transportieren, die Menschen verbinden. Das bedeutet, dass die Menschen merken, dass sie nicht isoliert sind, sondern dass es auch andere gibt, die so fühlen wie sie. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach Kunst in einer politisch angespannten Zeit? Meine Reisen nach Russland haben vor allem das bewirkt: den Russen zu zeigen, dass nicht alle Deutschen so denken, wie es die Politik vorgibt. Die Politik mag über die meisten Dinge hinweggehen, aber das wird nicht ewig so bleiben. Irgendwann werden auch die Deutschen genug davon haben. Spätestens, wenn die Menschen Angst bekommen, wird es Veränderungen geben. Bei der Irak-Demo 2002 waren eine halbe Million Menschen in Berlin auf der Straße. Damals habe ich auch gesungen. Die Menschen hatten einfach die Befürchtung, dass Deutschland in diesen Kampf hineingezogen wird und der Terrorismus direkt vor der Tür steht. Heute sind die Leute weniger auf der Straße, weil sie meiner Meinung nach mehr Vertrauen in Putin haben als in Bin Laden damals und denken: „Was will er denn? Unsere Windräder?“ Doch die Leute werden immer misstrauischer, besonders wenn sie Politiker wie Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied des Bundestages) hören, der behauptet, Putin hätte „mehrfach gesagt“, er würde nach der Ukraine so weitermachen. Putin hat so etwas nicht ein einziges Mal gesagt. Ich habe kürzlich ein Konzert in Neustrelitz gespielt. Danach kam eine Frau auf mich zu und fragte, warum ich auch auf Russisch singe. Ich sagte, weil es eine schöne Sprache ist. Sie fragte mich, ob ich „Putins Krieg“ in der Ukraine nicht bedenklich fände. Ich sagte, sie könne die Wahrheit nicht im „heute-journal“ finden. Ich habe ihr Nachdenkseiten.de empfohlen und ihr auch erklärt, dass RT Deutsch abgeschaltet wurde, damit die Deutschen nicht mehr von zwei Seiten informiert werden konnten. „Wir sind doch nicht so jung, dass wir nicht wüssten, wie das in der DDR war, wo wir uns aus zwei Quellen unsere Meinung gebildet haben. Jetzt versucht man, uns nur mit einer Seite zu füttern. Das müssen wir verhindern.“ Die Frau war sehr aufgeschlossen und schrieb sich die Namen der alternativen Medien auf. Das zeigt, dass viele Menschen Zweifel in sich tragen und die Gelegenheit nutzen, Fragen zu stellen. Sie merken, dass Künstler wie ich ihnen mehr zu erzählen haben. Die Zahl der Menschen, die anfangen zu zweifeln, wächst. Das ist der Boden für Veränderung. Künstler können hier unheimlich viel tun, weil die Menschen eher zu einem Konzert gehen als zu einem politischen Vortrag. Ich sehe es als meine Aufgabe. Konrad Wolf hat gesagt: „Kunst ist Waffe.“ Eine Waffe kann man so oder so gebrauchen – manchmal, um eine Grenze zu ziehen, wie der Igel, der seine Stacheln aufstellt, wenn ein Hund kommt. Man kann also durch Musik abschrecken statt durch Waffen. Interessant. Kunst ist ein Teil der menschlichen Bildung. Sie transportiert Informationen, sensibilisiert und verbindet Menschen. Sie schafft Begegnungen und baut Vorurteile ab. Das passiert, wenn in einem Konzertsaal ein Punk, ein Biker und ein Banker stehen, die alle denselben Künstler lieben. Sie sehen, dass ihr Vorurteil dem anderen gegenüber falsch war. Genauso war es für mich in meinem Grundwehrdienst damals, als wir anderthalb Jahre in Uniform waren. Man sah die Menschen, wie sie wirklich waren, nicht nach ihrer Kleidung. Kunst hat die Aufgabe, Zweifel zu formulieren. Brecht hat in vielen Gedichten das „Lob des Zweifels“ thematisiert: Dinge, die für wahr gehalten wurden, werden eines Tages infrage gestellt und aus den Geschichtsbüchern gestrichen, weil neue Erkenntnisse gewonnen wurden. Solche Erkenntnisse entstehen, wenn wir zusammen auf einem Festival stehen und uns begegnen. Das liebe ich als Künstler: wenn ich merke, dass die Leute inhaltlich folgen und sich die Gesichter erhellen. Titelbild: Éva Péli Mehr zum Thema: „Musik statt Krieg“: Ein Festival der Hoffnung auf dem Vier-Winde-Hof [https://www.nachdenkseiten.de/?p=138154] Tino Eisbrenner in Moskau: „Wir haben keine Sekunde für den Frieden zu verlieren“ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=133354] Tino Eisbrenner: „Wir brauchen eine ‚unidad popular‘, eine Volksfront“ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=128387] Letzte Hoffnung UN-Charta – Ein Appell für Frieden und Neutralität [https://www.nachdenkseiten.de/?p=135549] „Liebe ohne Grenzen“ – ein deutsch-russisches „FriedensLiebeslied“ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=132397] [https://vg01.met.vgwort.de/na/b405a0a113674882b1cdf8ffe9318d78]
Am Montag, dem 25. August, hatte die israelische Armee (IDF) mit einem mutmaßlich gezielt ausgeführten Doppelschlag gegen das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen fünf Journalisten (u.a. für Reuters und AP arbeitend) und sowie herbeieilende Rettungssanitäter und mehr als ein Dutzend weitere Zivilisten getötet. Die Bundesregierung forderte einen Tag später eine Untersuchung des Raketenangriffs. Kurz darauf präsentierte die IDF eine Erklärung, laut der der Angriff einer „Hamas-Überwachungskamera im Bereich des Krankenhauses“ gegolten hätte. Der Angriff sei damit legitim gewesen. Vor diesem Hintergrund wollten die NachDenkSeiten wissen, ob die Bundesregierung der Darstellung der IDF Glauben schenkt und ob damit der Forderung des Auswärtigen Amtes nach Aufklärung Genüge getan sei. Von Florian Warweg. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Hintergrund Der erste Angriff erfolgte [https://www.bbc.com/news/articles/c80d2zrdj7vo] am 25. August kurz vor 10 Uhr morgens während einer Live-Übertragung der Nachrichtenagentur Reuters aus dem Nasser-Krankenhaus und tötete Hussam al-Masri, Mitarbeiter von Reuters, der an diesem Tag für die Organisation des Livestreams verantwortlich war. Vier weitere Journalisten, unter anderem von AP und Al Jazeera wurden zehn Minuten später durch den zweiten israelischen Beschuss („double tap“) des vierten Stockwerks des Krankenhauses getötet. > 🚨 [https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f6a8.png]Civil defense teams were targeted by an Israeli airstrike during a live broadcast on Al-Ghad TV, the attack was the second on Nasser Hospital, killing journalist , Reuters photographer Hossam Al-Masry and others. pic.twitter.com/uy8Dk2PEAq [https://t.co/uy8Dk2PEAq] > > — Inés El-Hajj|Stories from Palestine 🇵🇸 [https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f1f5-1f1f8.png] (@InesElhajj) August 25, 2025 [https://twitter.com/InesElhajj/status/1959882270162268174?ref_src=twsrc%5Etfw] „Wir sind erschüttert“ Die betroffenen Nachrichtenagenturen reagierten umgehend. Ein Reuters-Sprecher erklärte: > „Wir sind erschüttert über den Tod des Reuters-Mitarbeiters Hussam al-Masri und die Verletzungen eines weiteren unserer Mitarbeiter, Hatem Khaled.“ Die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) mit Hauptsitz in New York teilte mit, sie sei „schockiert und traurig“ über den Tod ihrer freien Mitarbeiterin Mariam Abu Dagga und anderer Journalisten. Abu Dagga habe sich für ihre Berichterstattung oft in diesem Krankenhaus aufgehalten. Ebenso fielen die Journalisten Mohammed Salama, der für Al Jazeera arbeitete, Moaz Abu Taha, der als freier Mitarbeiter für mehrere ausländische Medien tätig war, sowie Ahmed Abu Aziz, der vor allem für arabische Medien arbeitete, dem IDF-Raketenangriff zum Opfer. Auf einem Screenshot ist der letzte Moment von Moaz Abu Taha, Mariam Abu Dagga und Mohammed Salama zu sehen, kurz vor dem Einschlag der zweiten israelischen Rakete: [https://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/250829-Journalisten-Screen1.jpg]https://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/250829-Journalisten-Screen1.jpg Im Gegensatz zu früheren Fällen von mutmaßlich gezielten Tötungen von Journalisten in Gaza durch die IDF reagierte [https://x.com/AuswaertigesAmt/status/1960005411526058109] diesmal das Auswärtige Amt recht schnell, erklärte sein „Entsetzen“ und forderte eine Aufklärung des Angriffs: [https://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/250829-Journalisten-Screen2.jpg]https://www.nachdenkseiten.de/upload/bilder/250829-Journalisten-Screen2.jpg Die „Aufklärung“ kam dann auch in Form einer Presseerklärung des israelischen Generalstabs: > „Erste Untersuchungen haben ergeben, dass Soldaten der Golani-Brigade, die im Gebiet von Khan Yunis zur Zerschlagung terroristischer Infrastrukturen operierten, eine von der Hamas im Bereich des Nasser-Krankenhauses aufgestellte Kamera entdeckten, die zur Beobachtung der Aktivitäten der israelischen Streitkräfte diente, um terroristische Aktivitäten gegen sie zu lenken. Diese Schlussfolgerung wird unter anderem durch die dokumentierte militärische Nutzung von Krankenhäusern durch Terrororganisationen während des gesamten Krieges sowie durch Geheimdienstinformationen gestützt, die die Nutzung des Nasser-Krankenhauses durch die Hamas seit Kriegsbeginn für terroristische Aktivitäten bestätigen. > > Vor diesem Hintergrund gingen die Truppen vor, um die Bedrohung zu beseitigen, indem sie die Kamera zerstörten und abmontierten. Die Untersuchung ergab, dass die Truppen vorgingen, um die Bedrohung zu beseitigen.“ > An initial inquiry regarding the strike on the observation camera at the Nasser Hospital in Khan Yunis, which occurred yesterday (Monday), August 25th, 2025, was presented to the Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir, by the Commander of the Southern Command, MG Yaniv Asor,… pic.twitter.com/CEf7fmaB2r [https://t.co/CEf7fmaB2r] > > — Israel Defense Forces (@IDF) August 26, 2025 [https://twitter.com/IDF/status/1960364428786057545?ref_src=twsrc%5Etfw] Im Gegensatz zur Darstellung der israelischen Armee handelte es sich nach aktuellem Wissensstand bei der „beseitigten Bedrohung“ allerdings nicht um eine angebliche „Hamas-Kamera zur Beobachtung der Aktivitäten der israelischen Streitkräfte“, sondern um die fest installierte Reuters-Kamera für den Live-Stream aus dem Krankenhaus. Gegenüber dem Nachrichtenportal Middle East Eye erklärten [https://x.com/MiddleEastEye/status/1960606897410850914] mehrere Zeugen, darunter auch Ezzedine al-Masri, der Bruder des getöteten Reuters-Kameramanns Hossam al-Masri, dass die Live-Kamera der Nachrichtenagentur auf dem Dach des Nasser-Krankenhauses seit Beginn des Krieges in Gaza offiziell beim israelischen Militär registriert war, die IDF also von Beginn an über die Existenz dieser Kamera für journalistische Zwecke informiert war. Auszug aus dem Wortprotokoll der Regierungspressekonferenz vom 27. August 2025 Frage Warweg Nach dem gezielten Beschuss des Nasser-Krankenhauses in Gaza am Montag, bei dem fünf Journalisten, drei Rettungssanitäter und mehre als ein Dutzend weitere Zivilisten getötet wurden, hat das Auswärtige Amt explizit Aufklärung gefordert. Jetzt hat die IDF am 27. August erklärt, die erste Untersuchung sei abgeschlossen. Ziel des Vorgehens sei eine Kamera im Bereich des Nasser-Krankenhauses gewesen, die angeblich zur Beobachtung der Aktivitäten der israelischen Streitkräfte gedient habe; das Vorgehen der IDF sei daher gerechtfertigt. Dazu würde mich interessieren: Rechtfertigt die Ausschaltung einer Kamera im Bereich eines Krankenhauses aus der Sicht des Auswärtigen Amtes dieses Vorgehen der IDF, und ist jetzt mit dieser Darstellung des israelischen Generalstabs der Forderung des Auswärtigen Amtes nach Aufklärung Genüge getan? Giese (AA) Wir haben diesen Bericht zur Kenntnis genommen. Ich habe ihn nicht als abschließenden Bericht verstanden, sondern das ist, glaube ich, eine erste Äußerung dazu. Das ist nach unserem Verständnis nicht ausreichend. Die Arbeit ist nicht abgeschlossen. Es ist wichtig, dass es dazu eine umfassende Untersuchung gibt und dass die Verantwortlichen tatsächlich herausgefunden werden. Die israelische Seite hat ja auch selbst eingeräumt, dass dieser Fall ein Unglück ist. Wir fordern weiterhin, dass herausgefunden wird, wie es dazu kommen konnte, dass ein Krankenhaus beschossen worden ist. Die ganzen Umstände dieses Vorfalls werfen sehr, sehr ernsthafte Fragen auf, die geklärt werden müssen. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass sich der Bundeskanzler gestern sehr ausführlich zu diesem Vorfall geäußert hat. Zusatzfrage Warweg Jetzt sind wir laut UN-Angaben seit Oktober 2023 bei über 240 durch die IDF getöteten Journalisten. Sie haben jetzt noch einmal auf die Aussage verwiesen, dass das angeblich ein Missgeschick war. Mich würde interessieren: Inwieweit vertraut die Bundesregierung dieser Darlegung der israelischen Seite, dass es sich bei über 240 getöteten Journalisten permanent um Missgeschicke der israelischen Seite handelt? Giese (AA) Wir haben gesagt, dass diese Fälle aufgeklärt werden müssen. Dieser Fall ist ein Fall in einer ganzen Reihe von Vorfällen, die aufgeklärt werden müssen, die nicht ausreichend aufgeklärt sind. Das ist eine absolut unerträglich hohe Zahl von getöteten Journalistinnen und Journalisten und darüber hinaus natürlich noch von vielen anderen Leuten. Wie gesagt, auch dazu hat sich gestern der Bundeskanzler geäußert, dem sich das Auswärtige Amt natürlich vollkommen anschließt. Als Hinweis: In der vergangenen Woche hat sich die Bundesregierung einem ausführlichen Statement der Media Freedom Coalition angeschlossen, auf das ich Sie verweisen will. Das will ich jetzt nicht im kompletten Wortlaut vortragen, aber eine der Kernaussagen ist, dass Journalisten niemals legitime Ziele von militärischen Aktionen sein dürfen. Vize-Regierungssprecher Meyer Ich würde gerne ergänzen – nicht nur mit Blick auf die Worte des Bundeskanzlers, sondern auch denen von Staatssekretär Kornelius hier am Montag -, dass die Bundesregierung von der israelischen Regierung fordert, den Zugang zu Medienschaffenden in Gaza jederzeit zu gewähren und Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit auch zu schützen. Titelbild: Screenshot NachDenkSeiten, Bundespressekonferenz 27.08.2025 Mehr zum Thema: Bundesregierung instrumentalisiert Russland-Sanktionen, um gegen kritische Gaza-Berichterstattung vorzugehen [https://www.nachdenkseiten.de/?p=133956] Bundesregierung instrumentalisiert Russland-Sanktionen, um gegen kritische Gaza-Berichterstattung vorzugehen [https://www.nachdenkseiten.de/?p=133956] Journalisten-Morde in Gaza – die BILD sollte sich schämen [https://www.nachdenkseiten.de/?p=137301] Bringt Außenminister Wadephul die 225 getöteten Journalisten in Gaza bei Israel-Besuch zur Sprache? [https://www.nachdenkseiten.de/?p=136934] [https://vg04.met.vgwort.de/na/3a505d9a64e4434b868f8f81fa64e8b3]
Als am Mittwoch die neue Artilleriemunitions-Produktionsline des Rheinmetall-Werks im niedersächsischen Unterlüß in Betrieb genommen wurde, war viel Prominenz angereist. Neben dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellten sich auch zwei niedersächsische SPD-Granden dem Blitzlichtgewitter: Parteichef und Vizekanzler Lars Klingbeil und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Niedersachsen steht wie wohl kaum ein anderes Bundesland für die von Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“: Das einstige „Autoland“ soll nun, da es mit den Autos nicht mehr so gut läuft, zum „Rüstungsland“ werden – wenn es das nicht ohnehin schon ist. Diese Strategie ist brandgefährlich, kann sie doch nur aufgehen, wenn Deutschland dauerhaft gigantische Mengen an Rüstungsgütern abnimmt und dabei noch gigantischere Mengen von Steuergeldern in die Rüstungsindustrie fließen. Es ist zu befürchten, dass dies das neue Standortkonzept der SPD ist. Armes Niedersachsen, armes Deutschland. Von Jens Berger. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Dieser Artikel liegt auch als gestaltetes PDF vor [https://www.nachdenkseiten.de/upload/flyer/250829_Ruestungsland_Niedersachsen_Weg_vom_Auto_hin_zum_Panzer_mit_tatkraeftiger_Unterstuetzung_der_SPD_NDS.pdf]. Wenn Sie ihn ausdrucken oder weitergeben wollen, nutzen Sie bitte diese Möglichkeit. Weitere Artikel in dieser Form finden Sie hier [https://www.nachdenkseiten.de/?cat=54]. Für Deutschlands Militaristen war der vergangene Mittwoch zweifelsohne ein guter Tag. Nach Jahren, ja Jahrzehnten der schlechten, teils gehässigen Kommentare über deutsche Rüstungsgüter gab es endlich Superlative zu feiern. Gerade einmal anderthalb Jahre nach dem Spatenstich nahm nun die erste Produktionslinie für Artilleriegranaten im niedersächsischen Unterlüß ihren Betrieb auf. Noch in diesem Jahr will Rheinmetall dort 25.000 Schuss produzieren, bis 2027 sollen es jährlich 350.000 werden. Zusammen mit anderen Werken will Rheinmetall in den nächsten zwei Jahren den Ausstoß an Artilleriegranaten auf sagenhafte 1,5 Millionen Geschosse pro Jahr hochfahren. Die „Tagesschau“ meldet dazu vollkommen unkritisch [https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/rheinmetall-werk-artilleriemunition-100.html], dass Rheinmetall damit „seine Position als stärkster Hersteller von 155-Millimeter-Geschossen in der westlichen Welt festigen“ würde. Und das soll zumindest nach den Vorstellungen von Rheinmetall auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Nun will man in andere Länder expandieren und dort ebenfalls Munitionswerke nach dem Konzept von Unterlüß errichten. Genannt werden dabei Litauen und Großbritannien, wo es bereits konkrete Projekte gebe – aber auch Staaten wie Rumänien, Lettland und die Ukraine, die laut Rheinmetall-Chef Papperger „noch entschlossener in die Lage versetzt werden muss, die dringend benötigten Schutz- und Verteidigungsgüter im eigenen Land zu produzieren“. Wofür allein Deutschland 1,5 Millionen Artilleriegeschosse pro Jahr braucht und was mit den Werken passiert, wenn es – Gott bewahre – in der Ukraine zu einem Waffenstillstand oder gar Frieden kommt, fragt das Schlachtschiff des öffentlich-rechtlichen Journalismus lieber nicht. Das hat System. Deutschland befindet sich im Strukturwandel. Doch leider sprechen wir nicht über den Wandel einer exportgetriebenen Volkswirtschaft, deren Produktportfolio in die Tage gekommen ist, zu einer zukunftsfesten innovativen und nachhaltigen Volkswirtschaft. Statt auf regenerative Energien, KI-Technologie, die Mobilitätswende oder auch nur die bessere Verzahnung von Universitäten, Forschung und Start-ups zu setzen, soll Deutschlands wirtschaftliches Rückgrat ausgerechnet die Rüstungsindustrie werden. Einen ähnlichen Strukturwandel gab es schon in der spätwilhelminischen Zeit und im Dritten Reich, und wir wissen, wohin das geführt hat. In Niedersachsen lässt sich diese Entwicklung wie unter einem Brennglas betrachten. Niedersachsens rüstungsindustrielles Ökosystem In Niedersachsen gibt es die „Großen“, wie Airbus mit zwei Standorten oder halt Rheinmetall mit dem größten Rüstungsstandort Deutschlands in der sonst beschaulichen Lüneburger Heide. Dann gibt es noch die „Hidden Champions“, Firmen wie die Werft Abeking & Rasmussen in Lemwerder, die neben Luxusyachten auch als Weltmarktführer Minensuchboote herstellt. Schon heute gibt es in Niedersachsen aber auch ein komplettes Ökosystem mit militärischen Zulieferern wie beispielsweise das Unternehmen Vincorion aus Wedel, das Energiesysteme für Panzer herstellt. Ähnlich wie bei der Autoindustrie ist die Produktion von militärischen Großgeräten heute ein Projekt, das zu großen Teilen auf unzählige Zulieferbetriebe ausgegliedert wurde. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass am Bau eines Panzers mindestens 150 mittelständige Unternehmen beteiligt sind [https://www.ndr.de/nachrichten/info/ruestungsindustrie-von-rheinmetall-bis-tkms-wer-profitiert-im-norden,ruestungsindustrie-110.html]. So stammen die Getriebe der meisten von Rheinmetall hergestellten Panzer vom Augsburger Unternehmen Renk AG, die sie jedoch in ihrem Werk in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover fertigen lässt. Früher gehörte Renk übrigens zu MAN und war bis 2020 im Besitz der Volkswagen AG. Aber das war ja vor der Zeitenwende, als man meinte, mit Autos mehr Geld als mit Panzern verdienen zu können. Volkswagen nahm damals 530 Millionen Euro mit dem Verkauf von Renk ein, heute weist das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mehr als sechs Milliarden Euro auf – die Zeitenwende hat sich für Renk und seine neuen Besitzer gelohnt; dazu zählt übrigens vor allem das schwedische Private-Equity-Unternehmen Triton, an dem unter anderem die Familie des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad beteiligt ist. So fließt mit jedem niedersächsischen Panzer Geld in die Kassen schwedischer Multimilliardäre, die ihr Geld steueroptimiert in einer niederländischen Stiftung verwalten lassen. Für Niedersachsen springen immerhin einige wenige Jobs heraus. Wie viel Prozent der Steuergelder, die für derartige Rüstungsgüter ausgegeben werden, nun an die Arbeitnehmer vor Ort und wie viel an milliardenschwere Investoren im Ausland gehen, ist nicht seriös zu schätzen, Zahlen dazu sind Verschlusssache. Man kann aber durchaus vermuten, dass es sich bei den Löhnen eher um die Krumen vom Tisch der Reichen handelt und der große Verlierer am Ende einmal mehr der Steuerzahler ist. Rheinmetall – Rüstungschampion seit Kaisers Zeiten Ein großer Gewinner der Zeitenwende ist zweifelsohne das Unternehmen Rheinmetall, der größte Rüstungskonzern Deutschlands. Heute weist der Konzern eine Marktkapitalisierung in Höhe von 75 Milliarden Euro auf – mehr als 50 Prozent so viel wie der Volkswagen-Konzerns, der zweitgrößte Automobilbauer der Welt. Vor Olaf Scholz’ Zeitenwende-Rede war Rheinmetall übrigens nur vier Milliarden Euro wert. Auf Kosten des Steuerzahlers hat sich der Wert des Unternehmens somit fast verzwanzigfacht. Aber wen wundert das? Es gibt wohl keinen Konzern, der ein so umfangreiches Polit-Lobbying betreibt [https://www.nachdenkseiten.de/?p=122927] wie Rheinmetall. Konzernchef Papperger ist ein Duz-Freund von Boris Pistorius und auch mit dem Ex-Kanzler Olaf Scholz ist er auf freundschaftlicher Ebene verbunden. Wenn es um Rheinmetall geht, lässt auch die Bundespolitik gerne mal „Viere gerade sein“ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=130281] und nimmt es mit den eigenen Vergaberichtlinien nicht so genau. In Unterlüß in der Lüneburger Heide wird von Rheinmetall unter anderem die Großkalibermunition für nahezu alle Panzer und Artilleriesysteme produziert, die in Deutschland im Einsatz sind. Hier arbeiten 2.800 Menschen, 600 wurden erst nach der Zeitenwende eingestellt, und aktuell suchen die Rüstungsbauer mindestens 200 weitere Mitarbeiter, Tendenz stark steigend. Einige Waffensysteme fertigt Rheinmetall in Eigenregie, andere in Kooperation – so werden in Unterlüß beispielsweise in einem Joint-Venture mit der VW-Tochter MAN die LKW der Bundeswehr produziert. MAN liefert die zivilen, Rheinmetall die militärischen Komponenten. Wenn Medien wie der NDR über Rheinmetall berichten, so sucht man Kritik meist vergebens. Selbst die „125-jährige Firmengeschichte“ wird in Beiträgen des NDR wie von magischer Hand durch Weglassen der „düsteren Perioden“ geschönt [https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/rheinmetall-in-unterluess-es-geht-um-mehr-als-eine-munitionsfabrik,rheinmetall-238.html]. Bereits im Ersten Weltkrieg lieferte die „Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft“ von Unterlüß aus – auch mit französischen Zwangsarbeitern – die Munition, mit der die kaiserlichen Truppen ihr tödliches Handwerk verrichten konnten. In der Nazizeit wurde das Werk dann verstaatlicht und vom fusionierten Staatsbetrieb Rheinmetall-Borsig betrieben, der später in die Reichswerke Hermann Göring eingegliedert wurde. Ab 1939 wurden dort polnische, ab 1942 russische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt, die in mehreren dafür gebauten Lagern in der Nähe des Werkes untergebracht wurden. 1944 folgte schließlich noch ein Außenlager des KZs Bergen-Belsen [https://de.wikipedia.org/wiki/KZ-Au%C3%9Fenlager_Unterl%C3%BC%C3%9F], in dem vornehmlich ungarische Jüdinnen, die aus Auschwitz überstellt wurden, unter kaum vorstellbaren Bedingungen arbeiteten. 1945 wurden das Werk Unterlüß und seine zu diesem Zeitpunkt 5.000 Zwangsarbeiter schließlich von den Briten befreit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Rheinmetall-Borsig wieder reprivatisiert und produzierte in Unterlüß zunächst Textilmaschinen. Als die Briten dann jedoch abzogen und die junge Bundesrepublik ihre Bundeswehr gründete, brauchte man auch wieder Waffen und Munition aus Unterlüß. 1955 war das unfreiwillige zehnjährige Intermezzo vorbei, und der Standort Unterlüß wurde wieder zur Waffen- und Munitionsschmiede der Republik. All dies scheint der NDR zu vergessen, wenn er stolz vom „125-jährigen Standortjubiläum“ schreibt [https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/rheinmetall-in-unterluess-es-geht-um-mehr-als-eine-munitionsfabrik,rheinmetall-238.html] – aber ja, der NDR gehört ja auch zum niedersächsischen Komplex, und auch das zum NDR-Reich gehörende Schleswig-Holstein gehört vor allem mit dem Marine- und Werftenstützpunkt Kiel zu den großen „Gewinnern“ der Rüstungsprogramme. Da erwähnt man lieber, wie viel Geld Rheinmetall doch der Gemeinde an Gewerbesteuern einbringt und dass der Steuergeldregen durch die Munitionsfabrik nun der Gemeinde ermögliche, das Schwimmbad und das Bürgerhaus zu sanieren und anzubauen. „Rheinmetall braucht Unterlüß und Unterlüß braucht Rheinmetall“, so der NDR ganz nonchalant. Und auch hier mache sich die Zeitenwende bemerkbar, schließlich habe Rheinmetall zahlreichen ehemaligen Mitarbeitern des Automobilzulieferers Continental eine neue, zukunftssichere Arbeit gegeben. Die Zeitenwende hat Rheinmetall zum „weißen Ritter“ einer sterbenden Region gemacht. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Rüstungskonzern nun im nahen Braunschweig auch die Betriebsstätte des schwer angeschlagenen Luftfahrt-Start-ups Leichtwerk übernommen hat [https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/rheinmetall-uebernimmt-betriebsstaette-militaer-drohnen-bald-aus-braunschweig,leichtwerk-100.html]. Wo früher zivile Leichtflugzeuge entworfen und hergestellt wurden, werden künftig militärische Drohnen gebaut. Protest? Bedenken? Immerhin „rettet“ Rheinmetall damit 40 hochqualifizierte Arbeitsplätze, das gefällt der lokalen Politik. Panzer statt Autos – Das VW-Werk in Osnabrück Der Strukturwandel, der sich derzeit in Niedersachsen vollzieht, ist vor allem in der Automobilbranche zu bemerken. Über Jahrzehnte hinweg war Niedersachsen – im Verhältnis zu anderen Wirtschaftszweigen – das Autoland schlechthin. Rund um die Werke des VW-Konzerns hat sich ein sehr umfangreiches System von Zulieferern aus dem „Automotive-Bereich“ in Niedersachsen niedergelassen. Doch mit Autos made in Germany läuft es bekanntlich seit einigen Jahren nicht mehr so gut. Es heißt, man habe am Markt vorbei entwickelt, die Zeichen der Zeit verschlafen. Wie dem auch sei, in der Branche und in der Landes- und Regionalpolitik herrscht jedenfalls Katerstimmung. So mancher denkt nun bereits offen darüber nach, „Panzer statt Autos“ zu produzieren. Auch hier nimmt die Rüstungsindustrie in ihrer Öffentlichkeitsarbeit die Rolle des „weißen Ritters“ ein und die Politik spielt dieses Spiel oft nur allzu gerne mit. Das jüngste Beispiel dafür ist das VW-Werk in Osnabrück. Dieses Werk kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1901 begann hier der Kutschenbauer Wilhelm Karmann, die ersten Karosserien für Autos zu bauen. Später wurden in Osnabrück zunächst in Eigenregie und später in Auftragsfertigung Cabrios gebaut. 2011 übernahm dann VW das Werk, doch die Auftragslage ist bescheiden und 2027 laufen die letzten Baureihen von Porsche und VW in Osnabrück aus. Vor Ort will man eine Werksschließung verhindern. Doch wie? Einmal mehr tauchte Rheinmetall als angeblicher Retter in der Not auf [https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Rheinmetall-Chef-VW-Werk-in-Osnabrueck-geeignet-fuer-Ruestung,rheinmetall348.html]. Man könne sich gut vorstellen, in Osnabrück künftig zusammen mit VW Militärfahrzeuge zu produzieren, und damit den Fortbestand des Standortes sichern, verlautbarte Rheinmetall im März. Schnell wurde seitens Politik und VW zumindest öffentlich zurückgerudert. An den Spekulationen sei nichts dran [https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Panzer-und-Waffen-von-VW-Osnabrueck-Rheinmetall-Vorstoss-nur-Geruecht,vw6550.html], so hieß es. Glaubhaft waren diese Dementis aber nie. Schon länger gibt es eine Kooperation zwischen der VW-Nutzfahrzeugsparte MAN und Rheinmetall bei Militärfahrzeugen. Und hinter den Kulissen sind sich Rheinmetall und VW auf der Chefetage wohl auch schon einig [https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Rheinmetall-Chef-VW-Werk-in-Osnabrueck-geeignet-fuer-Ruestung,rheinmetall348.html]. Man müsse aber eine sichere Auftragslage durch den Bund haben und brauche dafür einen Rahmenvertrag über zehn Jahre. Nach anfänglicher Kritik hat sich nun auch die IG Metall für die militärische Lösung geöffnet. Anfang dieser Woche sagte Thorsten Gröger von der IG Metall, er ließe sich diese Option offen [https://www.antenne.com/nachrichten/Niedersachsen/IG-Metall-Andere-Nutzung-w%C3%A4re-keine-Schlie%C3%9Fung-von-VW-Werk-id1454543.html]: „Wenn ein Werk morgen etwas anderes produziert als heute, ist das keine Schließung. Entscheidend ist: Von guter in gute Arbeit ist immer besser als in Arbeitslosigkeit.“ Die Rolle der IG Metall ist bei dieser Entscheidung wichtig. Durch das VW-Gesetz haben die Belegschaft und das Land Niedersachsen eine Mehrheit im Aufsichtsrat. Für Rheinmetall ist dies eine Win-Win-Situation – das Land Niedersachsen sorgt im Aufsichtsrat für einen positiven Beschluss und lässt via SPD seinen Einfluss spielen, dass es den nötigen Rahmenvertrag gibt, der das Geschäft für Rheinmetall vergoldet. Dabei gäbe es für das VW-Werk in Osnabrück durchaus denkbare Alternativen, wie es der Brancheninsider Stephan Krull in einem lesenswerten Artikel zum Thema analysiert [https://stephankrull.info/2025/08/10/vw-werk-osnabrueck-vor-der-entscheidung-panzer-oder-kleinbus/]. Das Problem: Politik und Medien stellen den Strukturwandel hin zur Rüstungsindustrie heute genauso als alternativlos dar, wie sie es vor wenigen Jahren noch mit der Energiewende oder der Mobilitätswende getan haben. Rüstung liegt voll im Zeitgeist und die Weichen scheinen bereits gestellt zu sein. So wird es niemanden ernsthaft wundern, wenn demnächst in der „Friedensstadt“ Osnabrück Militärfahrzeuge vom Band laufen. Ein Land im Strukturwandel Hätte es das Dritte Reich nicht gegeben, sähe Niedersachen heute auch wirtschaftlich anders aus. Das ist keine steile These, sondern ein simpler, in Niedersachsen nicht gerne gehörter Fakt. Die heutigen Wirtschaftszentren, die vor allem den Süden des Bundeslandes dominieren, sind die Auto- und die Stahl- bzw. metallverarbeitende Industrie. Wo 1938 noch plattes Weideland rund um das Dorf Fallersleben war, steht heute die Großstadt Wolfsburg mit ihrem Stammwerk der VW AG, das rund 62.000 Menschen direkt und Hunderttausende Menschen in der Region indirekt beschäftigt und bis vor Kurzem auch flächenmäßig die größte Fabrikanlage der Welt war. Wenige Kilometer südlich findet sich die Stadt Salzgitter mit ihrem riesigen Stahlwerk der Salzgitter AG – gegründet 1937 als Reichswerke Hermann Göring; wie das damalige KdF-Werk in Wolfsburg eine Reißbrettplanung mitten im Nirgendwo. Heute ist Salzgitter – wenn auch nur durch Eingemeindungen – eine Großstadt. In den 1930ern war Salzgitter-Bad noch ein 3.000-Seelen-Dorf im Landkreis Goslar. Stahl und Autos – die Produkte, die die Region über Jahrzehnte hinweg wohlgenährt haben und unzählige Zuliefererbetriebe angezogen haben, sind heute Auslaufmodelle. Die Salzgitter AG schreibt seit Jahren tiefrote Zahlen, die Energiekosten und Umweltauflagen haben die Stahlherstellung in Deutschland international abgehängt. Wofür braucht man auch Stahl? Gebaut wird kaum noch, deutsche Autos verkaufen sich schlecht. Etwas Hoffnung brachte die erzwungene Umstellung der Gasversorgung. Erst verdiente man gut am Bau der Nord-Stream-Pipelines, dann verdiente man gut am Bau der neuen Gasleitungen, die nötig sind, um die LNG-Terminals ans Verteilnetz zu nehmen. Aber auch das ist irgendwann geschehen, und ohne das preiswerte Nord-Stream-Gas zerfiel auch das Zukunftsmodell der Salzgitter Stahl, in Deutschland grünen Stahl zu produzieren, in sich selbst. Nun setzt man auf grünen Stahl aus Wasserstoff-Strom – nur dass der ohne gigantische Subventionen so teuer ist, dass er in der Privatwirtschaft keine Kunden finden würde – außer in der staatlich subventionierten Rüstungswirtschaft, bei der die Controller nicht so genau auf die Zahlen schauen. So sieht die Salzgitter Stahl AG nun auch ihre wirtschaftliche Zukunft als Zulieferer der Rüstungsindustrie [https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Salzgitter-AG-will-verstaerkt-an-Ruestungsindustrie-liefern,salzgitter1280.html]. Unternehmensintern hat man nun eine „Task Force Verteidigung“ gegründet. Ein guter Freund von mir, der bei dem Unternehmen tätig war, reichte an diesem Tag die Kündigung ein. Aber nicht jeder hat den Luxus, in dieser wirtschaftlich angespannten Zeit einen neuen Job zu finden. So kommt es, dass das von den Nazis zur Rüstungsproduktion gegründete Stahlwerk bald wieder für die Rüstungsproduktion arbeitet – welch bittere Pointe. Ähnlich dürfte es den Mitarbeitern der Meyer Werft in Papenburg gehen. Dort wurden bis vor Kurzem Kreuzfahrtschiffe gebaut, doch die Coronazeit brachte die Branche in Schieflage, Aufträge wurden storniert oder verschoben, das Land Niedersachsen stieg mit 80 Prozent bei der Werft ein. Die Begründung dafür [https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/papenburger-meyer-werft-was-russische-raketen-mit-ihrer-rettung-zu-tun-haben-48033503] muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – Papenburg liegt außerhalb der Reichweite russischer Kurzstreckenraketen aus dem Oblast Kaliningrad und sei daher von hoher strategischer Bedeutung, „um im Falle zunehmender sicherheitspolitischer Spannungen Marineschiffe bauen zu können“. Genau das soll jetzt auch geschehen. Laut einem Restrukturierungsplan [https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/meyer-werft-wir-koennten-fregatten-in-serie-bauen/100127846.html] sollen künftig nicht mehr Kreuzfahrtschiffe, sondern Fregatten in Papenburg vom Stapel laufen. Natürlich – mit dem Land Niedersachsen als Mehrheitseigner ist man ein politisches Unternehmen, und staatliche Aufträge wird es dank der Zeitenwende schon ausreichend geben. Niedersachsen und die SPD – ein ideales Umfeld für die Rüstungsindustrie Die niedersächsische SPD stand schon immer der Rüstungsindustrie und ihrer Lobby sehr nahe, und seit vielen Jahren haben die Niedersachsen in der SPD die Deutungshoheit gewonnen. Der heutige Parteichef und Vizekanzler Lars Klingbeil wuchs als Sohn eines Soldaten in der Bundeswehrstadt Munster auf und gehörte seit 2017 den Präsidien der Lobbyvereine [https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/lobbyismus/nebenjobs-in-lobbyvereinen-wie-die-ruestungsindustrie-politiker-umgarnt] Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik und Förderkreis Deutsches Heer an. Politisch machte er sich schon lange vor der Zeitenwende für eine massive Erhöhung der Rüstungsausgaben stark. Ob aus Überzeugung oder aus Opportunismus, ist nicht bekannt – sein Wahlkreis grenzt jedenfalls an den Rheinmetall-Standort Unterlüß. Fest an seiner Seite steht dabei Boris Pistorius, seines Zeichens Verteidigungsminister, der zum „Kanzler der Herzen“ hochgeschrieben wurde. Auch Pistorius ist Niedersachse, und für einen SPD-Politiker ist seine Karriere wohl auch nur in Niedersachsen so denkbar. Protegiert wurde er über Jahre hinweg von Sigmar Gabriel, Goslarer, Niedersachse und Freund der Rüstungsindustrie, und Stephan Weil, Hannoveraner, Niedersachse und ebenfalls Freund der Rüstungsindustrie, der kurz vor seinem Abtritt als niedersächsischer Ministerpräsident noch verkündete [https://www.volksstimme.de/panorama/weil-offen-fur-mehr-rustungsindustrie-in-niedersachsen-4034277], er wolle die Rüstungsindustrie in Niedersachsen noch weiter stärken, da diese ein „absoluter Wachstumsbereich“ sei. Dass sein Amtsnachfolger Olaf Lies, der den rüstungsindustriefördernden Kurs Weils in zwei Kabinetten als Wirtschaftsminister exekutiert hat, das anders sieht, ist auszuschließen. Es war der SPD-Kanzler Olaf Scholz, zwar in Niedersachsen geboren, aber politisch ein Hamburger, der die Zeitenwende ausrief und die ersten 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung bereitgestellt hat. Boris Pistorius war später der größte Lobbyist für die Fünf-Prozent-Regelung bei den Rüstungsausgaben, die dann sein Parteichef Lars Klingbeil als Finanzminister auch umgesetzt hat. Sie haben den Rahmen geschaffen, aber nicht nur das. Immer dann, wenn es um die Ansiedlung und Stärkung der Rüstungsindustrie, insbesondere durch Konzerne wie Rheinmetall, ging, hat in Niedersachsen die SPD dabei eine signifikante Rolle gespielt. Scholz, Pistorius und Weil haben den Bau der neuen Munitionsfabrik von Rheinmetall in Unterlüß aktiv unterstützt. Auch bezüglich des Einflusses auf die Bundes-SPD und Lobbying in der Bundespolitik gibt es klare Verbindungen: Die niedersächsische SPD nutzt ihre Position, um bundespolitische Entscheidungen zu beeinflussen, etwa durch die Förderung von Aufrüstungsprogrammen wie dem 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr. Stephan Weil hat sich öffentlich für mehr Rüstungsinvestitionen eingesetzt und Kritik an Abrüstung geäußert, was mit der Linie der SPD-Bundesführung um Scholz und Pistorius übereinstimmt. Diese Strategie führt entweder in eine Sackgasse oder in den Krieg Über die makroökonomische Sinnlosigkeit der Aufrüstung hatte ich bereits im Artikel „Vom „Green New Deal“ zum „olivgrünen Wirtschaftswunder“ – der Irrsinn regiert“ [https://www.nachdenkseiten.de/?p=130790] ausführlich geschrieben. Schauen wir uns heute zunächst einmal die betriebswirtschaftliche Perspektive an. Um es klar zu sagen: Kurzfristig mag es für ein Unternehmen durchaus sinnvoll erscheinen, militärische anstatt ziviler Güter zu produzieren. Spätestens seit der Ära „Lopez“ [https://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ignacio_L%C3%B3pez_de_Arriort%C3%BAa] stehen die Zulieferer der Automobilindustrie unter einem riesigen Kostendruck. Einkäufer und Controller der Automobilhersteller sind gnadenlos und will man überhaupt im Geschäft bestehen, muss man schon mit einem sehr spitzen Bleistift kalkulieren. Das ist in der Rüstungsindustrie gänzlich anders. Hier hat der Staat ein Nachfrageoligopol und das Beschaffungssystem der Bundeswehr ist ja bekannt für seine Nachlässigkeit. Das ist gut für die Margen. Problematisch für die Anbieter ist dabei jedoch, dass die Nachfrage – anders als bei zivilen Gütern – politisch reguliert ist. Zugespitzt könnte man sagen: Wenn der Frieden ausbricht, sind die positiven Geschäftsaussichten der Rüstungsindustrie samt ihrer Zulieferer dahin. Irgendwann sind die Arsenale voll und in Manövern kann auch die Bundeswehr nicht Millionen und Abermillionen Artilleriegeschosse pro Jahr verschießen. Zwar mag es in bestimmten High-Tech-Bereichen auch hier „Innovationszyklen“ geben, sodass z.B. veraltete Drohnen durch neue Modelle ersetzt werden, aber für die große Masse militärischer Produkte gibt es nun mal eine natürliche Obergrenze. Das lässt zwei Alternativen offen: Man fährt die Beschaffungsausgaben runter, wenn die Arsenale voll sind oder man sorgt dafür, dass die militärischen Güter verbraucht werden; vulgo, man führt einen Krieg. Ersteres wäre aus rein ökonomischer Perspektive schlecht für den Wirtschaftsstandort; dann müssten die nun gebauten Werke wieder geschlossen werden. Letzteres wäre aus allen denkbaren Perspektiven katastrophal. Aber eine andere Alternative gibt es für dieses Szenario nicht. Tertium non datur. Man kann nur hoffen, dass sich diese simple Wahrheit auch irgendwann bei der Politik und in den Medien herumspricht; nicht nur in Niedersachsen. Titelbild: Screenshot NDR[http://vg04.met.vgwort.de/na/5df91a26234d4a2eb1d5294d61ef1521]