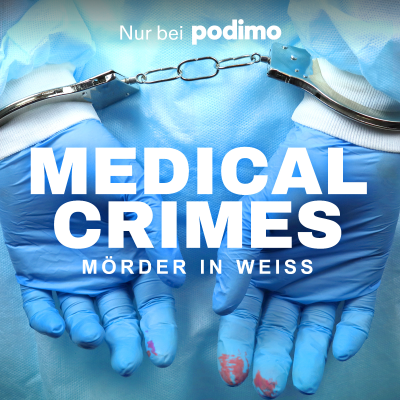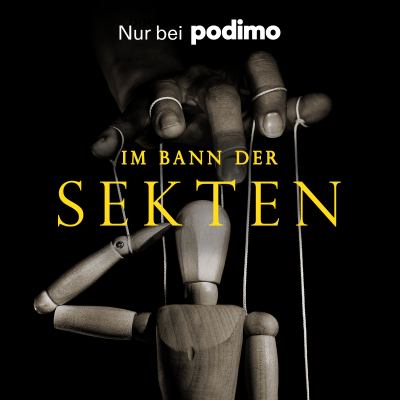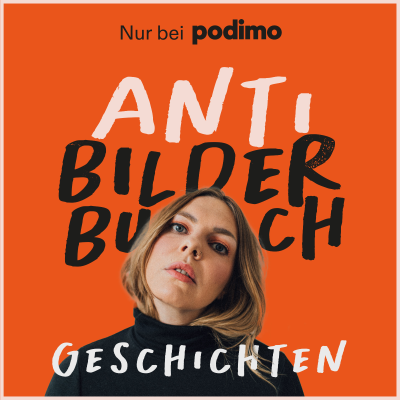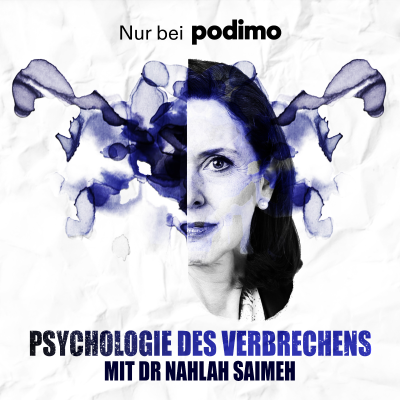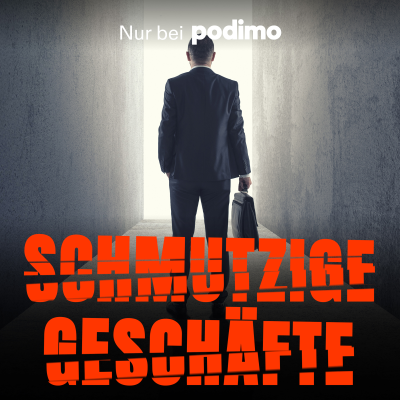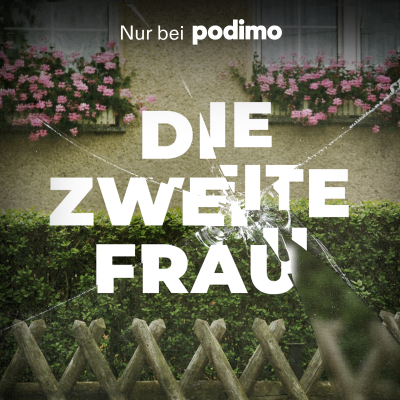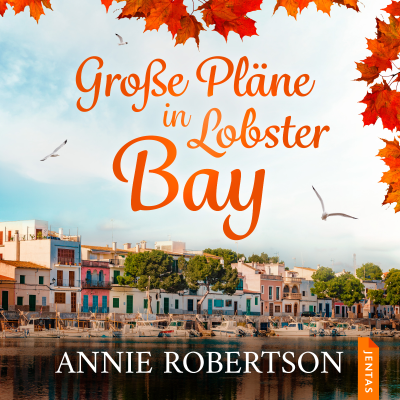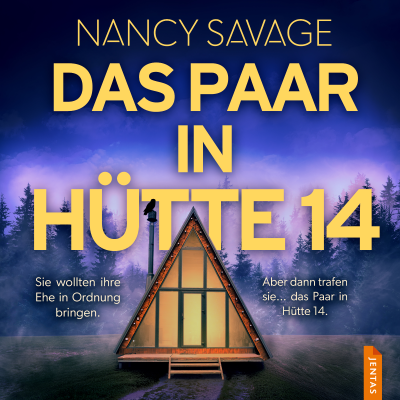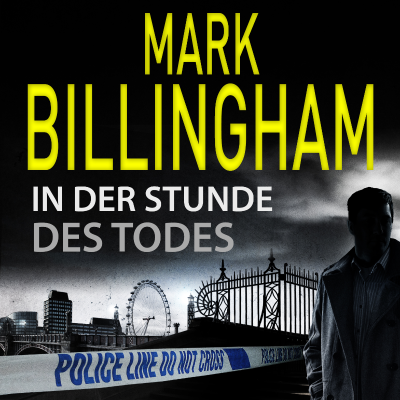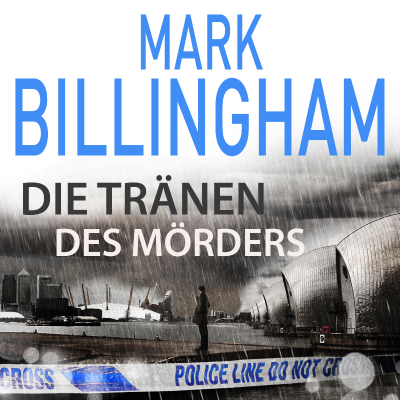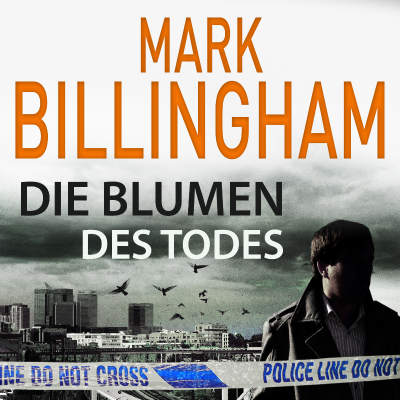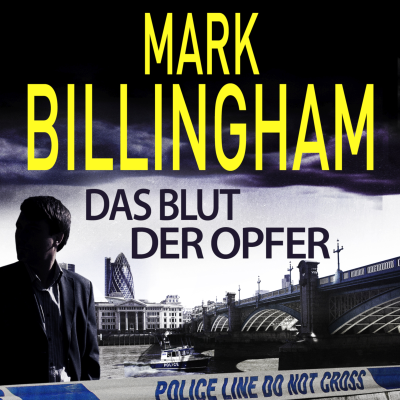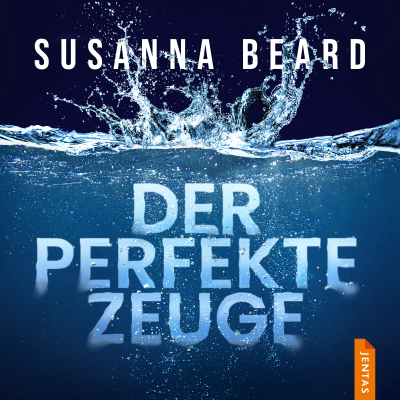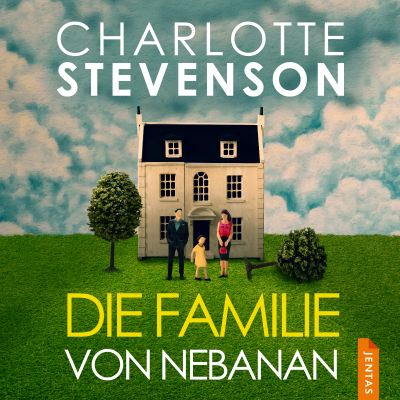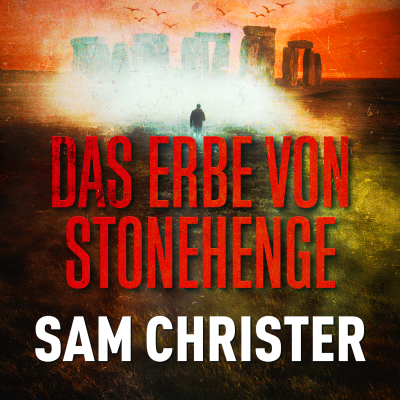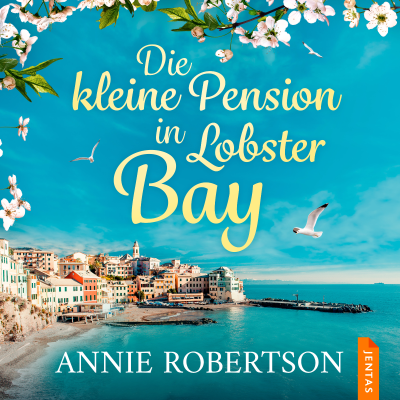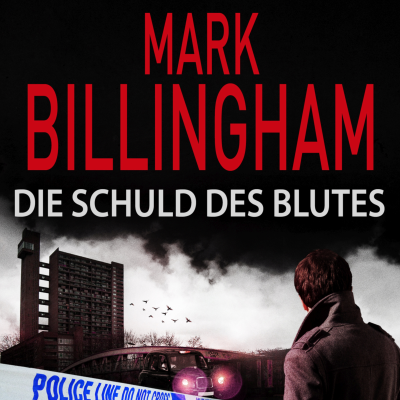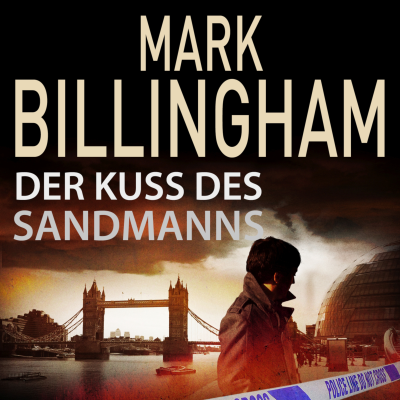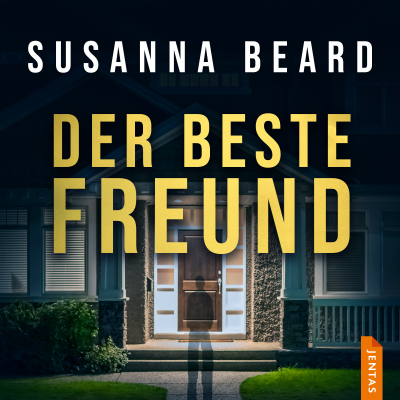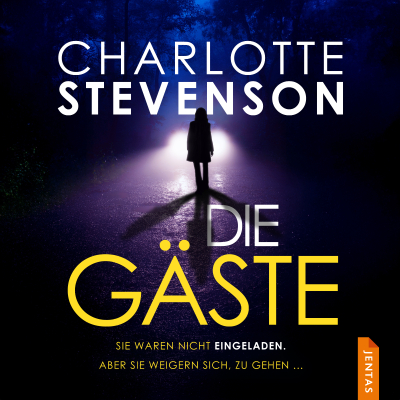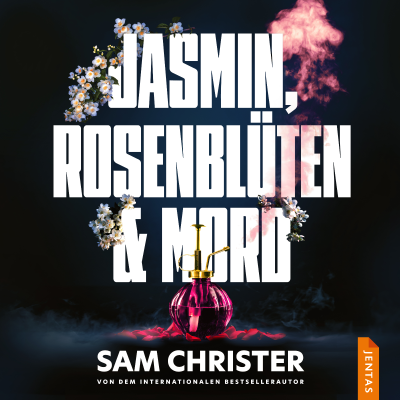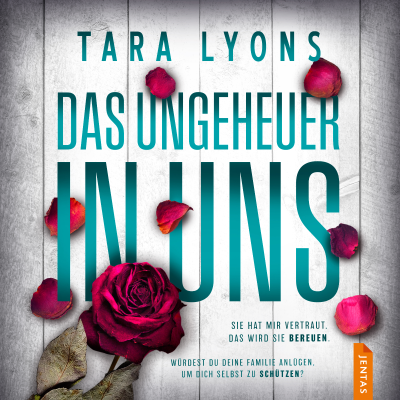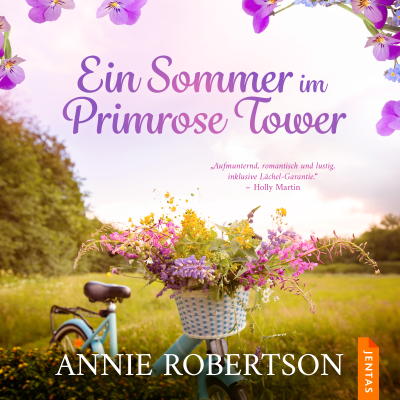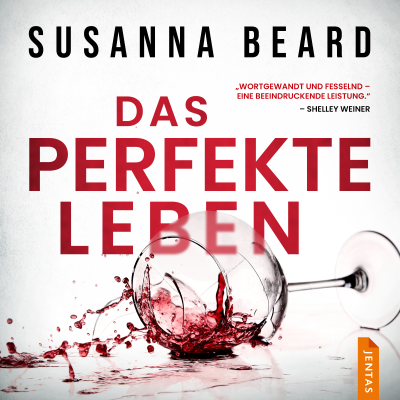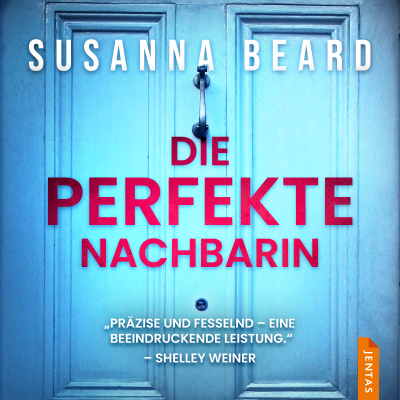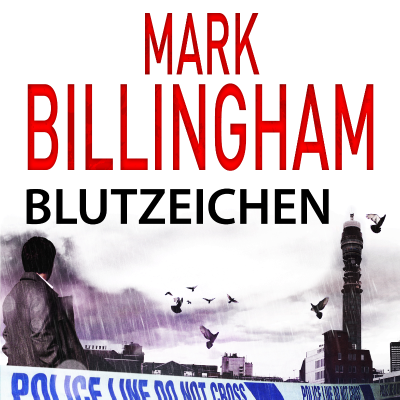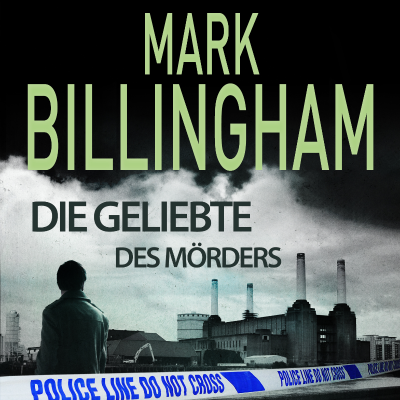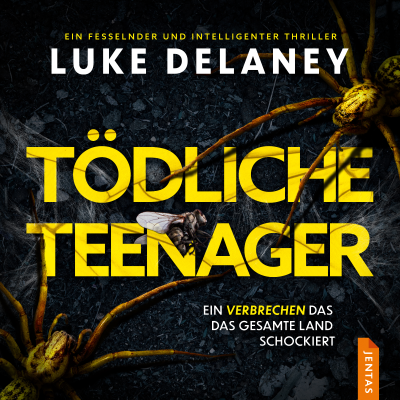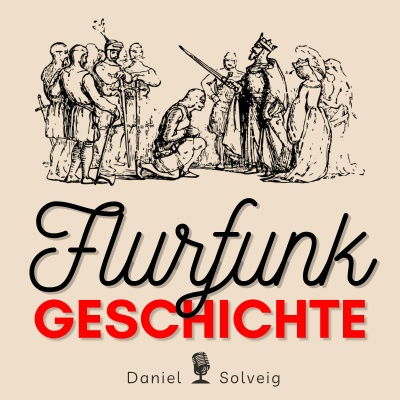
Flurfunk Geschichte
Deutsch
Kostenlos bei Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr Flurfunk Geschichte
Wir sind Daniel und Solveig und begeistern uns für Geschichte. Wir haben lange zusammen im Museum gearbeitet und Führungen gemacht. Im Mittelpunkt unserer Folgen stehen Menschen, ihre Lebenswelt und die Frage, warum sich unsere Sicht auf frühere Epochen immer wieder verändert. Jeden Monat erzählen wir Euch eine unserer Lieblingsgeschichten. Dir gefällt Flurfunk Geschichte? Wir freuen uns über eine nette Bewertung oder eine Nachricht von dir. Du kannst uns auch über ko-fi unterstützen: https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte Oder auch regelmäßig durch eine Mitgliedschaft auf Steady: https://steadyhq.com/de/flurfunk-geschichte/ Für deine regelmäßige Unterstützung bedanken wir uns mit einer Bonus-Folge "Nachklapp" zum Thema der aktuellen Folge. Links: https://flurfunk-geschichte.de/ https://www.instagram.com/flurfunk_geschichte/ https://www.facebook.com/flurfunkgeschichte/ https://twitter.com/flurgeschichte https://www.threads.net/@flurfunk_geschichte Email: kontakt@flurfunk-geschichte.de
Alle Folgen
65 FolgenFG064 - Irgendwas mit Bismarck | Planlos zur Einheit
In der Fortsetzung unserer Bismarck-Reihe konzentrieren wir uns auf das Entscheidungsjahr 1866. Wir fragen nach der Herkunft des Mythos vom „Reichsschmied“ und wie planvoll der Weg zum deutschen Nationalstaat war. Wir blicken auf verschiedene Akteure. analysieren die technischen Innovationen auf dem Schlachtfeld und diskutieren mögliche alternative Geschichtsverläufe. Attentat und Kriegsbeginn Kurz bevor der Konflikt mit Österreich im Mai 1866 eskalierte, hätte es auch schon wieder vorbei sein können: Ein junger Mann namens Ferdinand Cohen-Blind feuerte in Berlin fünf Schüsse auf Bismarck ab. Bismarck überwältigte seinen Attentäter höchstpersönlich, doch die öffentliche Reaktion war überraschend unterkühlt. Liberale Blätter sahen in Cohen-Blind [https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Cohen-Blind] fast schon einen Patrioten, der das Land von einem „Unhold“ befreien wollte. Wir besprechen, wie Bismarck diesen Moment für seinen Heldenmythos nutzte und wie schließlich ein Streit um Zuständigkeiten in Schleswig-Holstein den offiziellen Kriegsgrund gegen Österreich lieferte. Mit der Bahn nach Böhmen Bei Ausbruch des Deutschen Krieges standen die meisten Wetten wahrscheinlich gegen Preußen. Nicht nur Friedrich Engels sah die Preußen noch als unerfahrene „Friedensarmee“ und gegen Dänemark hatten die Österreich deutlich mehr Beachtung bekommen. Der preußische Generalstabschef Helmuth von Moltke [https://de.wikipedia.org/wiki/Helmuth_von_Moltke_(Generalfeldmarschall)] setzte auf Schnelligkeit und Risiko. Für einen schnellen Aufmarsch nutzte er das wachsende Eisenbahnnetz und brachte die österreichische Nordarmee unter General von Benedek [https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Benedek] schnell in Bedrängnis. Preußen und sein neuer Bund Nach dem Sieg wurden die Karten in Deutschland neu gemischt. Wir beleuchten die Gründung des Norddeutschen Bundes und das Schicksal vieler kleinerer deutscher Staaten. Während Staaten wie Hannover von der Landkarte verschwanden, musste die freie Stadt Frankfurt die preußische Härte schmerzhaft spüren. Wir erzählen die tragische Geschichte des Frankfurter Bürgermeisters Karl Fellner [https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Konstanz_Viktor_Fellner], der sich angesichts der preußischen Geldforderungen und Kanonendrohungen das Leben nahm. Gleichzeitig entsteht mit der neuen Bundesverfassung der erste deutsche Bundesstaat. Erweitert um die süddeutschen Staaten entsteht daraus noch im Krieg gegen Frankreich 1871 das deutsche Kaiserreich. Die „Englische Alternative“ und liberale Träume Zum Ende werfen wir einen Blick auf einen hypothetischen Wendepunkt der Geschichte. Was hätte es bedeutet, wenn der Kronprinz (später Friedrich III.) früher an die Macht gekommen wäre? Wir diskutieren die sogenannte „Englische Alternative“: Friedrich war mit Victoria, der Tochter von Queen Victoria, verheiratet und galt als Hoffnungsträger für einen britisch geprägten Liberalismus in Preußen. Hätte ein starkes Parlament den "preußischen Militarismus" frühzeitig einhegen können? Wir klären, warum diese Idee falschen Vorstellungen folgt und welche fortschrittlichen Ideen letztlich durch die konservative Führung umgesetzt wurden. Kontakt und Unterstützung Dir gefällt Flurfunk Geschichte? Wir freuen uns über eine nette Bewertung oder eine Nachricht von dir. Du kannst uns über ko-fi [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] unterstützen: https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] Oder auch regelmäßig durch eine Mitgliedschaft auf Steady: https://steady.page/de/flurfunk-geschichte [https://steadyhq.com/de/flurfunk-geschichte/] Für deine regelmäßige Unterstützung bedanken wir uns mit einer Bonus-Folge "Nachklapp" zum Thema der aktuellen Folge. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen an kontakt@flurfunk-geschichte.de [kontakt@flurfunk-geschichte.de] Flurfunk Geschichte liefert Euch weitere Hintergrundinfos bei Facebook [https://www.facebook.com/flurfunkgeschichte], Instagram [https://www.instagram.com/flurfunk_geschichte/], twitter [https://twitter.com/flurgeschichte] und threads [https://www.threads.net/@flurfunk_geschichte]. Weiterer Podcast Willst du noch mehr von uns hören? Dann folge den Ereignissen und Debatten in der ersten deutschen Nationalversammlung bei Flurfunk Paulskirche [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm/]: https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm]
FG063 - Irgendwas mit Bismarck | Eisen und Blut
Wir starten das neue Jahr mit einem echten Titanen der deutschen Geschichte. In dieser Folge widmen wir uns einer Figur, die bis heute polarisiert wie kaum eine andere: Otto von Bismarck. Ob als „Schmied des Reiches“ verehrt oder als „Brecher des Friedens“ verdammt – wir schauen uns an, wie preußische Machtpolitik schließlich einen kleindeutschen Nationalstaat schuf. Projektionsfläche und Politikum Wir steigen ein mit der Frage, warum Bismarck eigentlich heute noch so präsent ist. Während er für manche noch immer (oder wieder) eine Ikone ist, die jedes Denkmal verdient, sehen andere in ihm die „Ursünde“ der deutschen Nationalstaatsgründung durch Blut und Eisen und den Beginn eines Weges über Kolonialismus zu Hitler und Völkermord. Der Wendepunkt: 1866 statt 1871 In dieser Folge lenken wir den Blick weg vom Gründungsjahr des Kaiserreiches 1871 und fokussieren uns stattdessen auf das eigentliche Schicksalsjahr: 1866. Spätestens im zweiten Teil werden wir diskutieren, warum dieses Jahr als der wahre Wendepunkt gelten muss, an dem die Weichen für ein kleindeutsches Reich unter preußischer Führung gestellt wurden. Es ist die Geschichte einer angeblichen Vision Bismarcks, der über drei Etappen – die sogenannten Einigungskriege – führte. Verfassungskonflikt und die Rolle des Königs Ein zentrales Thema ist der Preußische Verfassungskonflikt. König Wilhelm I. wollte sein Heer reformieren, das liberale Parlament verweigerte das Geld. In dieser verfahrenen Situation holte Wilhelm den „letzten Bolzen der Reaktion“ – Bismarck – als Ministerpräsidenten, der bereit war, den Willen des Königs auch ohne genehmigten Haushalt durchzusetzen. In diesem Zusammenhang hält Bismarck die berühmte "Eisen-und-Blut"-Rede vor dem Budgetausschuss des Parlaments. Strategische Allianzen und diplomatisches Kalkül Wir beleuchten auch das geschickte (und skrupellose) Spiel auf dem diplomatischen Parkett. Ob es die „gütliche Einigung“ mit Österreich über die Verwaltung der Elbherzogtümer war oder das geheime Militärbündnis mit dem jungen Königreich Italien, um Österreich in einen Zweifrontenkrieg zu zwingen – Bismarck nutzte jede Gelegenheit, um Preußens Macht auszubauen. Hast du Lust, mit uns am 15. März in die Ausstellung „Roads Not Taken“ im Deutschen Historischen Museum zu gehen? Dann melde dich jetzt per Email an: Kontakt und Unterstützung Dir gefällt Flurfunk Geschichte? Wir freuen uns über eine nette Bewertung oder eine Nachricht von dir. Du kannst uns über ko-fi [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] unterstützen: https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] Oder auch regelmäßig durch eine Mitgliedschaft auf Steady: https://steady.page/de/flurfunk-geschichte [https://steadyhq.com/de/flurfunk-geschichte/] Für deine regelmäßige Unterstützung bedanken wir uns mit einer Bonus-Folge "Nachklapp" zum Thema der aktuellen Folge. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen an kontakt@flurfunk-geschichte.de [kontakt@flurfunk-geschichte.de] Flurfunk Geschichte liefert Euch weitere Hintergrundinfos bei Facebook [https://www.facebook.com/flurfunkgeschichte], Insta [https://www.instagram.com/flurfunk_geschichte/] Kontakt und Unterstützung Dir gefällt Flurfunk Geschichte? Wir freuen uns über eine nette Bewertung oder eine Nachricht von dir. Du kannst uns über ko-fi [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] unterstützen: https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] Oder auch regelmäßig durch eine Mitgliedschaft auf Steady: https://steady.page/de/flurfunk-geschichte [https://steadyhq.com/de/flurfunk-geschichte/] Für deine regelmäßige Unterstützung bedanken wir uns mit einer Bonus-Folge "Nachklapp" zum Thema der aktuellen Folge. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen an kontakt@flurfunk-geschichte.de [kontakt@flurfunk-geschichte.de] Flurfunk Geschichte liefert Euch weitere Hintergrundinfos bei Facebook [https://www.facebook.com/flurfunkgeschichte], Instagram [https://www.instagram.com/flurfunk_geschichte/], twitter [https://twitter.com/flurgeschichte] und threads [https://www.threads.net/@flurfunk_geschichte]. Weiterer Podcast Willst du noch mehr von uns hören? Dann folge den Ereignissen und Debatten in der ersten deutschen Nationalversammlung bei Flurfunk Paulskirche [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm/]: https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm]
FG062 - Kulturkampf um den Heiligen Rock
Wir beschließen unser halbwegs heiliges Jahr mit einer Wallfahrt zum Heiligen Rock nach Trier. Wir erzählen, wie sich Trier als besonders „heilige Stadt“ inszenierte und warum gerade diese Reliquie zum identitätsstiftenden Symbol wurde. Dabei ordnen wir den Heiligen Rock in die Tradition der Reliquienverehrung ein: von Kreuzsplittern über Nägel bis zu Kleidungsstücken, die Jesus zugeschrieben werden. Wir sprechen darüber, wie Städte mit ihren Heiligtümern Pilger, Prestige und Geld anziehen und sich damit ein regelrechter religiöser Wettbewerb entwickelt. Gleichzeitig wird der Rock zum Politikum: Wie wurde die Wallfahrt im Jahre 1844 zum Auslöser für Streit, Spott und Kulturkampf? Kreuzfund der heiligen Helena und die Frage der Echtheit Zunächst schauen wir auf die Legende von der heiligen Helena [https://de.wikipedia.org/wiki/Helena_(Mutter_Konstantins_des_Gro%C3%9Fen)], der Mutter von Konstantin dem Großen [https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe]. Wir erzählen, wie sie der Tradition nach nach Jerusalem [https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem] reist, das Kreuz Jesu und weitere Passionsreliquien findet und nach Rom bringen lässt – in Varianten von der knappen Notiz bis zur farbig ausgeschmückten Legenda Aurea [https://de.wikipedia.org/wiki/Legenda_aurea]. Wir greifen die Figur des Judas/Kyriakus auf, der der Legende nach bei der Suche hilft, und zeigen, wie solche Geschichten den Glauben stärken sollen, dass auch Kleidungsstücke Jesu überliefert sein könnten. Zugleich diskutieren wir nüchtern die Frage der historischen Plausibilität: Was berichten antike Autoren wie Flavius Josephus [https://de.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus], was bedeuten Zerstörung Jerusalems, römische Politik unter Titus [https://de.wikipedia.org/wiki/Titus] und Hadrian [https://de.wikipedia.org/wiki/Hadrian_(Kaiser)] oder der Bar-Kochba-Aufstand [https://de.wikipedia.org/wiki/Bar-Kochba-Aufstand] für die Überlieferungschancen eines Kreuzes? Danach hält es Solveig durchaus für denkbar, das Helena tatsächlich ein Kreuz fand, das frühe christliche Pilger als das Kreuz Christi verehrten. Vom mittelalterlichen Pilgermagnet zum Politikum im Rheinland Dann wenden wir uns der konkreten Geschichte des Heiligen Rocks in Trier zu. Wir erklären, wie die Stadt im Mittelalter eine ungeteilte Tunika Jesu, das „Gewand ohne Naht“, beansprucht und damit ihren Rang als Pilgerzentrum aufwertet – nicht zuletzt im Wettbewerb mit anderen Heiligtümern wie der Aachener Heiligtumsfahrt [https://de.wikipedia.org/wiki/Aachener_Heiligtumsfahrt] oder Kreuzreliquien in Prüm. Wir erzählen, wie der Rock bei großen Anlässen „erhoben“ und öffentlich gezeigt wird, mit aufwendiger Inszenierung, Gerüsten, Baldachinen und liturgischen Texten. Später kommen regelmäßige Wallfahrten hinzu, Ablässe – etwa durch Papst Leo X. – und gewaltige Pilgerströme, die der Region ökonomisch nutzen, aber auch heftige Kritik provozieren. Begriffe wie „Bescheißerei von Trier“ stehen für den Verdacht, dass hier mit Glauben Geschäfte gemacht werden. Nach Kriegen und Revolutionen wird der Rock mehrfach ausgelagert, unter anderem nach Ehrenbreitstein, Böhmen und Augsburg, bevor er wieder nach Trier zurückkehrt – in eine Region, die nach dem Wiener Kongress [https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kongress] nun zum überwiegend protestantischen Preußen gehört. Genau hier beginnt die Geschichte des Heiligen Rocks als politisches Symbol im katholisch geprägten Rheinland. Kölner und Trierer Wirren: Mischehenstreit und die Wallfahrt 1844 In einem großen Block schlagen wir die Brücke von der Reliquienverehrung zu den Kirchenkonflikten des 19. Jahrhunderts. Zunächst erklären wir die Kölner Wirren [https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lner_Wirren]: den Streit um Mischehen zwischen Katholiken und Protestanten im Königreich Preußen, die Rolle des Theologen Georg Hermes [https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Hermes_(Theologe)] und des Erzbischofs Clemens August Droste zu Vischering [https://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_Droste_zu_Vischering], der verhaftet wird. Wir zeigen, wie sich hier das Ringen zwischen Rom und dem preußischen Staat zuspitzt – ein Vorspiel zum späteren Kulturkampf [https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf]. Danach wechseln wir nach Trier zu den „Trierer Wirren“ um Bischof Wilhelm Arnoldi [https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Arnoldi_(Bischof)], der 1844 die große Heilig-Rock-Wallfahrt organisiert. Wir erzählen, wie Hunderttausende nach Trier pilgern, wie Predigten von Heilungen und Wundern berichten und wie die Wallfahrt zu einem Medienereignis wird. Gleichzeitig formiert sich Widerstand: Liberale Katholiken und Protestanten sehen Täuschung, Aberglauben oder politisch motivierte Frömmigkeit, während konservative Kreise das Ganze als geistliches Großereignis feiern. So wird Trier zum Schauplatz eines Kulturkampfs im Kleinen – mitten im Vormärz. Johannes Ronge und der Deutschkatholizismus An diesem Punkt tritt Johannes Ronge [https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Ronge] auf den Plan. Wir schildern, wie der schlesische Priester in einem offenen Brief an Bischof Arnoldi die Heilig-Rock-Wallfahrt als „Götzendienst“ und bewusste Irreführung armer Gläubiger angreift. Wir verfolgen, wie dieser Brief erst regional, dann reichsweit verbreitet wird, wie er in Leipzig gedruckt und von Akteuren wie Robert Blum [https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Blum] unterstützt wird und zu einem publizistischen Paukenschlag wird. Ronge wird exkommuniziert, doch um ihn herum bilden sich Gemeinden, die sich von Rom lösen – der Beginn des Deutschkatholizismus [https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschkatholizismus]. Wir erklären, wie diese Bewegung Heiligenkult, Papsttum und Beichte kritisiert und eine nationale, „vernünftige“ Form des Christentums propagiert, eng verbunden mit liberalen und demokratischen Kreisen im Vormärz. Wir greifen auch Figuren wie Hans Blum [https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Blum_(Autor)] auf und zeigen, wie die Debatten um den Heiligen Rock direkt in die politische Dynamik der Revolution von 1848 hineinreichen – bis hin zu späteren Auseinandersetzungen, in denen dann Otto von Bismarck [https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck] eine zentrale Rolle spielt. Spätere Wallfahrten mit und ohne Ablass Zum Schluss schauen wir in einem Bogen über das 19. und 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Wir erzählen von späteren Heilig-Rock-Wallfahrten 1891, 1933, 1959, 1996 und 2012, von wechselnden politischen Kontexten – Kaiserreich, Nationalsozialismus, Bundesrepublik – und von der Frage, wie viele Menschen jeweils nach Trier kommen. Zuletzt sogar evangelische Christen, denen der Verzicht auf den sonst üblichen Ablass die Hemmungen nehmen sollte. Kontakt und Unterstützung Dir gefällt Flurfunk Geschichte? Wir freuen uns über eine nette Bewertung oder eine Nachricht von dir. Du kannst uns über ko-fi [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] unterstützen: https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] Oder auch regelmäßig durch eine Mitgliedschaft auf Steady: https://steady.page/de/flurfunk-geschichte [https://steadyhq.com/de/flurfunk-geschichte/] Für deine regelmäßige Unterstützung bedanken wir uns mit einer Bonus-Folge "Nachklapp" zum Thema der aktuellen Folge. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen an kontakt@flurfunk-geschichte.de [kontakt@flurfunk-geschichte.de] Flurfunk Geschichte liefert Euch weitere Hintergrundinfos bei Facebook [https://www.facebook.com/flurfunkgeschichte], Instagram [https://www.instagram.com/flurfunk_geschichte/], twitter [https://twitter.com/flurgeschichte] und threads [https://www.threads.net/@flurfunk_geschichte]. Weiterer Podcast Willst du noch mehr von uns hören? Dann folge den Ereignissen und Debatten in der ersten deutschen Nationalversammlung bei Flurfunk Paulskirche [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm/]: https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm]
FG061 - Besessenheit und Exorzismus
In dieser Folge setzen wir unser Gespräch über das Böse fort und wenden uns Vorstellungen von Besessenheit und Exorzismus in Bibel, Kirchengeschichte und Gegenwart zu. Ausgangspunkt ist ein Gebet zum heiligen Erzengel Michael [https://de.wikipedia.org/wiki/Erzengel_Michael], mit dem wir uns symbolisch „rüsten“, bevor wir an unsere vorige Folge über Hölle und Teufel mit Dante Alighieri [https://de.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri] anschließen. Biblische Dämonenerzählungen und frühe Taufexorzismen Anhand verschiedener neutestamentlicher Erzählungen über Jesus und „Dämonen“ sprechen wir darüber, wie eng damals Krankheit, gesellschaftliche Ausgrenzung und Besessenheitsvorstellungen miteinander verknüpft sind. Wir erinnern an Geschichten, in denen Dämonen Jesus ansprechen, beim Namen genannt werden und in eine Schweineherde fahren, und überlegen gemeinsam, wie diese Texte funktionieren, ohne sie vorschnell medizinisch oder nur symbolisch „aufzulösen“. Von dort aus schlagen wir eine Linie in die frühe Kirche: Wir greifen auf Tertullian [https://de.wikipedia.org/wiki/Tertullian] zurück, der heidnische Götter als Dämonen versteht, und auf Origenes [https://de.wikipedia.org/wiki/Origenes], der die Anrufung des Namens Jesu betont. In den Erzählungen über Antonius den Großen [https://de.wikipedia.org/wiki/Antonius_der_Gro%C3%9Fe] bei Athanasius von Alexandrien werden Kämpfe mit Dämonen Teil eines asketischen Ideals; wir kontrastieren das kurz mit anderen Heiligenbildern. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Taufexorzismus: Wir lesen Stellen bei Augustinus von Hippo [https://de.wikipedia.org/wiki/Augustinus_von_Hippo] und anderen Quellen, in denen beschrieben wird, wie Taufbewerber:innen durch Gebet, Anhauchen und Ausblasen „gereinigt“ werden, bevor sie getauft werden. Wir zeigen, wie sich diese Praktiken in fränkischen Riten fortsetzen, in denen Wasser, Salz und Öl exorziert werden und ganze Gemeinden in der Fastenzeit in kollektive Exorzismen einbezogen sind. Der große Exorzismus und das Rituale Romanum Im nächsten Schritt klären wir, was die Kirche überhaupt unter Exorzismus versteht. Ausgehend vom Codex Iuris Canonici [https://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Iuris_Canonici] unterscheiden wir zwischen „kleinen" Taufexorzismen und dem „großen Exorzismus“ über Einzelpersonen, der nur mit bischöflicher Erlaubnis von eigens beauftragten Priestern durchgeführt werden darf. Wir sprechen darüber, dass Exorzismus als sakramentale Handlung verstanden wird, in der die Kirche im Namen Jesu um Befreiung von der Macht des Bösen bittet. Daran anschließend nehmen wir das Rituale Romanum [https://de.wikipedia.org/wiki/Rituale_Romanum] in den Blick, in dem seit 1614 die maßgeblichen Exorzismusformeln gesammelt sind. Wir lesen längere Ausschnitte aus dem großen Exorzismus und klären den Unterschied zwischen depräkativer Bitte um Gottes Beistand und der imprekativen diekten Ansprache des Dämons. Dabei wird für uns spürbar, wie belastend der Text ist – und gleichzeitig, wie sehr er davon ausgeht, dass die Kirche dem Teufel im Kampf gegenübersteht. Glaube, Wunder und Aufklärung: Johann Joseph Gaßner Ausgerechnet im Zeitalter der Aufklärung zieht der Pfarrer Johann Joseph Gaßner [https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Joseph_Ga%C3%9Fner] als Exorzist und Wunderheiler viel Aufmerksamkeit bekam. Er sah in den meisten Krankheiten Dämonen am Werk und heilte Gläubige durch seinen Segen.. Seine Praxis wird zum Streitfall zwischen Aufklärung, medizinischer Deutung, kirchlicher Kontrolle und volkstümlicher Frömmigkeit – inklusive Konflikten mit Bischöfen und weltlichen Herrschern. Leoninische Gebete, Konzilsreformen und der Fall Anneliese Michel Dann wenden wir uns den sogenannten „Leoninischen Gebeten“ nach der Messe zu und der Legende, Papst Leo XIII. [https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_XIII.] habe nach einer Vision das Gebet zum Erzengel Michael formuliert. Wir erzählen, wie diese Gebete im 19. und 20. Jahrhundert im Kontext des politischen Ringens um den Kirchenstaat unter Pius IX. [https://de.wikipedia.org/wiki/Pius_IX.] und später neu gedeutet unter Pius XI. [https://de.wikipedia.org/wiki/Pius_XI.] stehen – bis hin zu Bezügen zu Russland und Marienerscheinungen. Im Anschluss sprechen wir über die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils [https://de.wikipedia.org/wiki/Zweites_Vatikanisches_Konzil]: neue Messordnung, Landessprache, veränderte Kommunionpraxis und die Spannungen zwischen denen, die darin eine Erneuerung sehen, und jenen, die einen Bruch mit der Tradition wahrnehmen. Diese Auseinandersetzungen bilden den Hintergrund im Fall Anneliese Michel [https://de.wikipedia.org/wiki/Anneliese_Michel]. Wir erzählen ihre Biografie in groben Linien, sprechen über ihre gesundheitlichen Probleme und ihre intensive Frömmigkeit, über Wallfahrten und vermeintliche Erscheinungen. Wir greifen die Rolle des Jesuiten Adolf Rodewick und des Exorzisten Arnold Renz auf, der den großen Exorzismus nach dem Rituale Romanum durchführte, und schildern die langen Reihen von Exorzismussitzungen. Anneliese Michel starb schließlich infolge extremer Unterernährung, die Exhumierung, die Gerichtsprozesse und die Fragen nach Verantwortung, Seelsorge und Krankheit, die uns dabei nicht loslassen. Reformen des Exorzismus und mediale Bilder des Bösen Im Anschluss schauen wir auf kirchliche und theologische Reaktionen: auf Kommissionen, in denen Bischöfe, Theologen, Ärzt:innen und Psycholog:innen über Kriterien für Exorzismen beraten, und auf die Überarbeitung des Exorzismusritus, die 1999 in einem neuen Buch mündete. Wir erklären, dass darin deprekative Gebete stärker betont werden und die direkte Anrede des Dämons vorsichtiger gehandhabt wird, ohne dass der alte Ritus vollständig verschwindet – ein Spannungsfeld, das innerkirchliche Konflikte auslöst. Ein großer Befürworter des alten Rituale war Gabriele Amorth [https://de.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Amorth]. Als Exorzist des Bistums Rom war er Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der Internationalen Vereinigung der Exorzisten [https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Vereinigung_der_Exorzisten]. Zum Schluss dieses Blocks geht es um die mediale Verarbeitung: um den Horrorfilm „Der Exorzist“ und den Film „Exorzist des Papstes“ [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Pope%E2%80%99s_Exorcist] mit Russell Crowe [https://de.wikipedia.org/wiki/Russell_Crowe], die auf Amorth Bezug nehmen – und um die Frage, wie sehr solche Bilder unsere Vorstellungen von Teufel und Besessenheit prägen. Gegenwart, Freikirchen und Luthers Rat Zum Schluss schlagen wir einen Bogen in die Gegenwart. Wir sprechen darüber, dass Exorzismen nicht nur ein katholisches Thema sind, sondern auch in evangelikalen und pfingstlichen Milieus vorkommen, und erzählen von Freikirchen, die auf TikTok und YouTube Live-Exorzismen zeigen. Luther dagegen befand, dass man den Teufel am besten verspottet und auslacht, weil er Verachtung nicht ertragen kann. Die Goldene Schindel Wir sind beim Podcaster-Quiz „Die Goldene Schindel“ dabei! Das ist ein Wettbewerb von unabhängigen Geschichtspodcasts im DACH-Raum. Die ersten vier Folgen sind bereits online.Die fünfte Runde ist am 27. November mit Solveig. Übertragen wird das Ganze live auf Twitch, auf dem Kanal von Historia Universalis [https://www.twitch.tv/historiauniversalis?lang=de] Kontakt und Unterstützung Dir gefällt Flurfunk Geschichte? Wir freuen uns über eine nette Bewertung oder eine Nachricht von dir. Du kannst uns über ko-fi [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] unterstützen: https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] Oder auch regelmäßig durch eine Mitgliedschaft auf Steady: https://steady.page/de/flurfunk-geschichte [https://steadyhq.com/de/flurfunk-geschichte/] Für deine regelmäßige Unterstützung bedanken wir uns mit einer Bonus-Folge "Nachklapp" zum Thema der aktuellen Folge. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen an kontakt@flurfunk-geschichte.de [kontakt@flurfunk-geschichte.de] Flurfunk Geschichte liefert Euch weitere Hintergrundinfos bei Facebook [https://www.facebook.com/flurfunkgeschichte], Instagram [https://www.instagram.com/flurfunk_geschichte/], twitter [https://twitter.com/flurgeschichte] und threads [https://www.threads.net/@flurfunk_geschichte]. Weiterer Podcast Willst du noch mehr von uns hören? Dann folge den Ereignissen und Debatten in der ersten deutschen Nationalversammlung bei Flurfunk Paulskirche [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm/]: https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm]
FG060 - Teufel und Dämonen
In dieser Folge sprechen wir darüber, wie das Böse gedacht und erklärt wurde – und welche Rolle Dämonen und der Teufel darin spielen. Wir verfolgen, wie sich die Vorstellung von Dämonen und Teufel von der Antike über das frühe Christentum bis in die Neuzeit verändert hat. Vom antiken Dämon zum christlichen Teufel Wir beginnen mit dem alten Begriff „Dämon“ [https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mon], der in der Antike noch nichts Böses meinte. In der griechischen Welt waren Dämonen Mittlerwesen zwischen Göttern und Menschen – nicht gut oder schlecht, sondern Teil einer durchlässigen spirituellen Ordnung. Im Christentum verändert sich dieses Bild grundlegend. Dämonen werden nun als feindliche Mächte verstanden, als Kräfte des Bösen, die den Menschen in Versuchung führen oder ins Unglück stürzen. Wir sprechen darüber, wie aus der neutralen Bezeichnung ein Synonym für das Böse wurde – und wie eng diese Entwicklung mit dem Glauben an Krankheit, Besessenheit und Sünde verknüpft war. Dämonen im Neuen Testament Wir betrachten die Evangelien, in denen Dämonen in vielen Erzählungen auftauchen. Jesus treibt Dämonen aus, heilt Menschen und konfrontiert das Böse direkt. Dabei wird deutlich, dass die Vorstellungen von Besessenheit und Heilung Teil des damaligen Weltbildes sind. Wir fragen, wie diese Texte zu verstehen sind: als Symbolik, als Ausdruck antiker Vorstellungen oder als Berichte realer Erfahrungen. Im Gespräch wird klar, wie tief der Glaube an dämonische Mächte das Denken der frühen Christen geprägt hat. Vom heidnischen Gott zum Dämon Ein wichtiger Wendepunkt: die Auseinandersetzung mit den Religionen der Antike. Die frühen Christen sahen in den heidnischen Göttern keine neutralen Wesen, sondern dämonische Gegner. Was zuvor als göttlich galt, wurde zu einer Bedrohung. Wir sprechen darüber, wie dieser Perspektivwechsel half, die eigene Glaubenswelt abzugrenzen – und wie heidnische Kulte dadurch zu einem Teil der Dämonologie wurden. Satan, Luzifer und die gefallenen Engel Im Zentrum steht der Teufel selbst: seine Gestalt, seine Herkunft, seine Entwicklung. Im Alten Testament erscheint Satan [https://de.wikipedia.org/wiki/Satan] zunächst als Ankläger im göttlichen Hofstaat; erst später wird er zum Gegenspieler Gottes. Die Vorstellung vom Sturz der Engel führt uns zur Idee der gefallenen Wesen, die durch ihren Ungehorsam zu Dämonen werden. Luzifer – der Lichtträger [https://de.wikipedia.org/wiki/Luzifer], der sich gegen Gott erhebt – steht sinnbildlich für diesen Umbruch. Aus dem Engel wird der Herrscher der Finsternis. Wir sprechen darüber, wie diese Bilder die Vorstellung vom Bösen prägten – und wie sie bis heute nachwirken. Der Teufel in Literatur und Theologie Ein großer Teil der Folge widmet sich den literarischen Bildern des Teufels. Dante Alighieri [https://de.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri]entwirft in seiner Göttlichen Komödie [https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttliche_Kom%C3%B6die] die neun Höllenkreise – eine Ordnung des Bösen, in der jede Sünde ihren Platz hat. Der Teufel wird hier zu einer festgelegten Figur, gefangen im Eis, fern von der göttlichen Wärme. Die Vorstellung des Limbus – des Ortes zwischen Himmel und Hölle – wird wird auch in der Kirche lange tradiert und schließlich verworfen. Die Goldene Schindel Wir sind beim Podcaster-Quiz „Die Goldene Schindel“ dabei! Das ist ein Wettbewerb von unabhängigen Geschichtspodcasts im DACH-Raum. Die erste Folge ist bereits online; die weiteren Termine sind: am 17., 18., 19. sowie am 27. November. Wir sind dabei – am 19. mit Daniel, und am 27. November übernimmt Solveig. Übertragen wird das Ganze live auf Twitch, auf dem Kanal von Historia Universalis [https://www.twitch.tv/historiauniversalis?lang=de] Zum Ausblick: In zwei Wochen bleiben wir beim Thema und sprechen über den Exorzismus. Bis dahin hört doch (nochmal) die Folge "Hexen & Antike Magie" [https://rss.com/podcasts/allezeitderwelt/1362672/] an: Wir waren zu Gast bei "Alle Zeit der Welt" [https://rss.com/podcasts/allezeitderwelt/]. Kontakt und Unterstützung Dir gefällt Flurfunk Geschichte? Wir freuen uns über eine nette Bewertung oder eine Nachricht von dir. Du kannst uns über ko-fi [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] unterstützen: https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte [https://ko-fi.com/flurfunkgeschichte] Oder auch regelmäßig durch eine Mitgliedschaft auf Steady: https://steady.page/de/flurfunk-geschichte [https://steadyhq.com/de/flurfunk-geschichte/] Für deine regelmäßige Unterstützung bedanken wir uns mit einer Bonus-Folge "Nachklapp" zum Thema der aktuellen Folge. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen an kontakt@flurfunk-geschichte.de [kontakt@flurfunk-geschichte.de] Flurfunk Geschichte liefert Euch weitere Hintergrundinfos bei Facebook [https://www.facebook.com/flurfunkgeschichte], Instagram [https://www.instagram.com/flurfunk_geschichte/], twitter [https://twitter.com/flurgeschichte] und threads [https://www.threads.net/@flurfunk_geschichte]. Weiterer Podcast Willst du noch mehr von uns hören? Dann folge den Ereignissen und Debatten in der ersten deutschen Nationalversammlung bei Flurfunk Paulskirche [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm/]: https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm [https://flurfunk-paulskirche.letscast.fm]