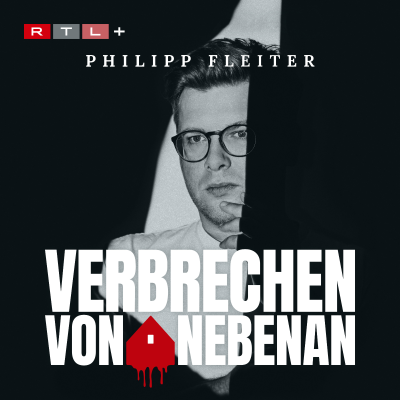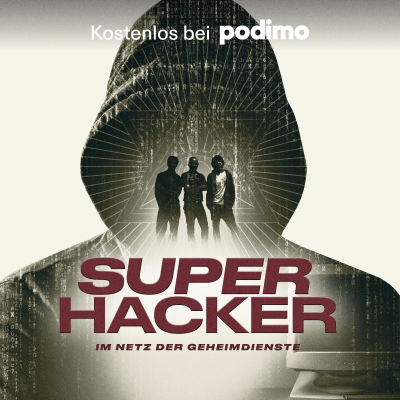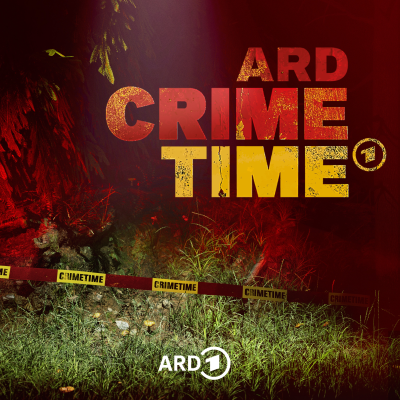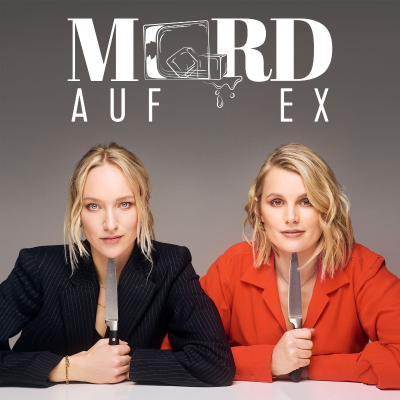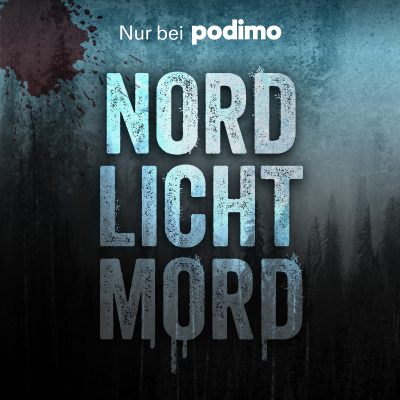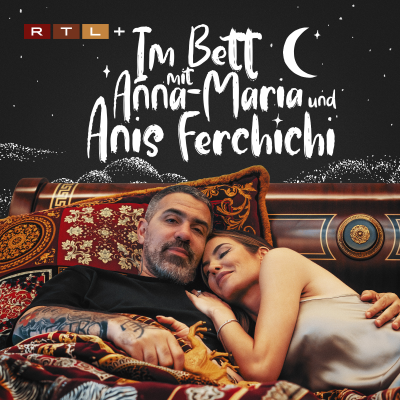Wissen in Bewegung.
Podcast von Pat Preilowski
Nimm diesen Podcast mit
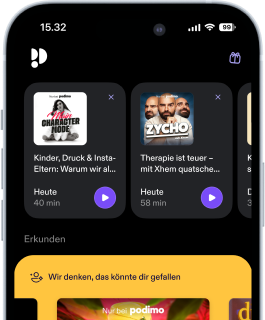
Mehr als 1 Million Hörer*innen
Du wirst Podimo lieben und damit bist du nicht allein
Mit 4,7 Sternen im App Store bewertet
Alle Folgen
52 FolgenIn dieser Folge geht es um den Constraint-Led Approach (CLA), eine Coaching-Methodik, die sich von traditionellen Ansätzen dadurch unterscheidet, dass sie Athleten dazu anregt, eigene Bewegungslösungen zu finden, statt ihnen diese vorzuschreiben. Es werden die theoretischen Grundlagen des CLA erläutert, einschließlich der Rolle von Einschränkungen und der Selbstorganisation. Anhand von Beispielen aus Baseball, Golf und Fußball wird detailliert beschrieben, wie verschiedene Arten von Einschränkungen (wie Ausrüstung, Regeln oder Aufgabenstellungen) angewendet werden können, um die sportliche Leistung zu verbessern. Der Text untersucht auch die Bedeutung von Feedback und die Rolle der Selbstregulation im Lernprozess. Dabei werden Missverständnisse über den CLA aufgeklärt und dessen iterative Natur hervorgehoben. Abschließend werden Studienergebnisse vorgestellt, die die Wirksamkeit des CLA bei der Förderung von Bewegungsvielfalt und Leistung belegen.
Heute geht es um die Kluft zwischen Sportwissenschaft und Coaching-Praxis und die Feststellung, dass Trainer oft Prinzipien widersprechen, die durch zeitgemäße Studien zur Fertigkeitsentwicklung belegt sind. Wir argumentieren, dass traditionelle Coaching-Ansätze zu viel Zeit mit "Trainingsform-Aktivitäten" verbringen, übermäßige verbale Anweisungen geben und nur wenige sinnvolle Progressionen aufweisen. Das Problem der Übertragbarkeit von Laborexperimenten auf komplexe sportliche Aufgaben wird hervorgehoben, da Erkenntnisse aus einfachen Aufgaben oft nicht auf reale Sportszenarien zutreffen, insbesondere im Hinblick auf zufälliges Training und die Häufigkeit von Feedback.
Heute behandeln wir zwei unterschiedliche Arten von Wissen: Wissen über (konzeptuelles, verbalisierbares Verständnis) und Wissen von (praktische, aktionsbasierte Fähigkeit). Wir nutzen das Beispiel des Fahrradfahrens, um zu illustrieren, dass man eine Handlung erfolgreich ausführen kann (Wissen von), auch wenn das bewusste Verständnis davon fehlerhaft ist (Wissen über). Diese Unterscheidung wird durch neurologische Beweise, wie das Zwei-Ströme-Modell des Gehirns und Fälle von Hirnschäden, weiter gestützt. Abschließend kritisieren wir, dass sich die meisten Trainerentwicklungsprogramme auf die Vermittlung von Wissen über konzentrieren, was zu Pfadabhängigkeit und einer mangelnden Anpassungsfähigkeit bei Trainern führt, anstatt die praktische, situationsbezogene Kompetenz zu fördern.
Diese Episode kündigt den Beginn einer neuen Spezialreihe zum ökologischen Ansatz im Training und in der Therapie an. Der ökologische Ansatz, basierend auf den Ideen von Newell, Gibson und aktuell Rob Gray, wird als eine Methode vorgestellt, bei der Lernen als ein Entdeckungsprozess durch die Interaktion mit der Umwelt verstanden wird, anstatt durch bloßes Nachahmen oder detaillierte Anweisungen. Das Ziel ist es, Trainer und Therapeuten zu befähigen, Lernumgebungen zu gestalten, die die Selbstorganisation von Bewegungen fördern und individuelle Lösungen ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Schaffung von Bedingungen, sogenannten "Leitplanken" oder "Constraints", die das Verhalten steuern, anstatt direkte Anweisungen zu geben.
Die letzte Folge erörtert in Kürze die Entwicklung unseres Verständnisses von menschlichem Verhalten und psychischen Erkrankungen. Robert Sapolsky fordert hier auf, Empathie und Verständnis auf eine breitere Palette von Verhaltensweisen auszudehnen, da die Wissenschaft weiterhin individuelle Unterschiede als Spektrum und nicht als binäre Kategorien aufdeckt. Abschließend betont der Vortrag die Notwendigkeit, trotz der zunehmenden Komplexität des Wissens aktiv Gutes zu tun und Wissenschaft und Mitgefühl zu verbinden. Primärquelle: https://www.youtube.com/playlist?list=PL848F2368C90DDC3D (Robert Sapolsky: Human Behavioral Biology, Stanford University).