
SWR Aktuell Im Gespräch
Deutsch
Gratis en Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr SWR Aktuell Im Gespräch
Topthemen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sport: Wir ordnen ein, wir klären auf, wir bohren nach. "SWR Aktuell Im Gespräch" - das sind Interviews mit Menschen, die etwas zu sagen haben.
Alle Folgen
9557 Folgen"Unsere Butter wird verramscht": Milchbauernprotest vor der Lidl-Zentrale
SWR Aktuell: Die Bauern reden davon, ihre Ware würde verramscht. Ein hartes Wort. Wie ist Ihr Blick darauf? Ist der Vorwurf berechtigt? Martin Banse: Ich würde sagen, der Vorwurf ist nicht unbedingt berechtigt. Die milcherzeugenden Betriebe [https://milchindustrie.de/] haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr hoher Milchpreise erfreuen können. Die waren so hoch wie schon lange nicht mehr. Und wenn man aus so einer Hochpreisphase jetzt in eine niedrigere Preisphase rutscht, dann ist das natürlich immer schmerzhaft und macht nicht so viel Spaß. Ich würde nicht sagen, dass wir hier von Verramschen sprechen können. Das sind zeitlich befristete Sonderangebote. Die gibt es immer im Lebensmitteleinzelhandel und haben dann natürlich jetzt unter so einer Situation einen kleinen Skandalisierungsdruck. Aber warum haben wir jetzt so niedrige Preise? Wir haben zwei Entwicklungen. Die Situation gestaltet sich so, dass wir die Ausläufer der sogenannten Blauzungenkrankheit [https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/blauzungenkrankheit/] jetzt ausklingen sehen. Die hat sich vor allen Dingen darin niedergeschlagen, dass die Milchleistungen je Kuh deutlich zurückgegangen sind. Das war keine tödliche Krankheit, aber die Leistungen sind zurückgegangen. Und bei steigenden Preisen haben die milcherzeugenden Betriebe mehr Milchangeboten. Das Milchangebot ist deutlich gestiegen. Und das ist natürlich auf engen Märkten dann sofort ein Signal für Preisrückgänge. Und dann mit so einer Sonderrabattaktion wirkt das natürlich und schlägt voll durch. Und da gehen die Emotionen hoch. SWR Aktuell: Jetzt trifft so ein niedriger Preis ja nicht alle Betriebe gleichermaßen, und gerade im Segment Milch sind ja auch Großmolkereien am Start, die auch noch im Markt zwischengeschaltet sind. Wo sehen Sie da die größten Verluste? > Preissenkungen und Preissteigerungen werden verzögert weitergegeben. > > > Quelle: Martin Banse, Agrarwissenschaftler Banse: Die Weitergabe von Lebensmittelpreisen und Milchpreisen ist ein verzögerter Prozess, das geht in beide Richtungen. Preissenkungen werden verzögert weitergegeben und Preissteigerungen werden verzögert weitergegeben. Und diese Effekte wirken an Märkten. Wir haben es ja hier auch nach wie vor mit vielen genossenschaftlich orientierten Molkereien zu tun. Und hier muss einfach verhandelt werden und Klarheit geschaffen werden. Das ist in dieser Situation, wo wir auch hohe Marktkonzentrationen haben, natürlich auch immer ein heißes Eisen, das da angefasst wird. SWR Aktuell: Die großen Molkereien wiederum verhandeln mit den Ketten, also auch mit Discountern wie Lidl. Wie groß ist deren Macht am Markt? > Wettbewerb unter Discountern sorgt für niedrige Verbraucher- und Erzeugerpreise > > > Quelle: Martin Banse, Leiter Thünen-Institut für Marktanalyse Banse: Wir haben eine sehr hohe Marktkonzentration, der großen vier oder fünf am Markt. Aber wir haben hier nach wie vor unter den Discountern einen guten und ordentlichen Wettbewerb, der hier für solche niedrigen Preise, auch was die Verbraucherpreise angeht, sorgt. Wir haben hier eine Situation, wo ein sehr scharfer Wettbewerb herrscht, und hier werden niedrige Preise auch dann deutlich weitergegeben mit der Folge sinkender Erzeugerpreise. Aber ich hatte es ja in meinen ersten Worten auch gesagt: Wir kommen aus einer Situation mit historischen Höchstpreisen, und hier ist ein Preisrückgang auch fällig gewesen. Und diese Reaktion ist bei solchen engen Märkten hier dann deutlich zu spüren. SWR Aktuell: Diese Schwankungen gab es eigentlich schon immer, und auch schon immer diese Handelsgiganten, die die Preise vielleicht nicht diktiert, aber doch gedrückt haben. Was wäre aus Ihrer Sicht der effektivste ökonomische Hebel, um Bauern einen guten Preis zu garantieren auf der einen Seite – und Verbraucherinnen und Verbrauchern bezahlbare Butter auch zu Weihnachten zu bescheren? Banse: Auf der Erzeugerseite ist es sicherlich das, was viele Milchproduzierenden Einzelbetriebe inzwischen machen: sich zu Liefergenossenschaften und Liefergemeinschaften zusammenzuschließen. Das bietet den Milch erzeugenden Betrieben mehr Verhandlungsmasse, mehr Verhandlungshebel. Eine Preistransparenz wäre hier sicherlich von großem Vorteil, um zu sehen, was die konkurrierenden Milchunternehmen an Rohmilchpreisen [https://www.bmel-statistik.de/preise/milchpreis-milchmenge] bieten. Aber zurzeit sind wir eher in einer Abwärtstrendsituation, in der natürlich dann auch jeder halbe Cent für das Kilo Milch besonders attraktiv wird. Und auf der anderen kommen die Konsumierenden, die von hohen Agrarpreisen in den letzten zwei, drei Jahren betroffen waren, in den Genuss sinkender Verbraucherpreise. Und das ist aus meiner Sicht eine faire Situation, dass hier auch solche Preise dann an Konsumierende weitergegeben werden.
Nach Parteitag: Grüne in Baden-Württemberg setzen auf Özdemir und Wirtschaft
Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg sehen die Prognosen für die bislang das Land regierenden Grünen alles andere als rosig aus. Der langjährige Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt nicht wieder an. Für ihn soll Cem Özdemir den Wahlsieg sichern. Doch die Grünen liegen in den Umfragen nur auf Platz drei mit großem Abstand zum Führenden, ihrem aktuellen Koalitionspartner CDU. Auf dem Parteitag am Wochenende in Ludwigsburg hat Özdmir die Grünen mit einer kämpferischen Rede auf den Wahlkampf eingeschworen. Dabei setzt der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister vor allem auf die Wirtschaft. Die Landeschefin der Grünen, Lena Schwelling, erklärt in SWR Aktuell, dass dieses Thema sehr gut zur Partei passe: "Was die Leute am meisten umtreibt, ist die wirtschaftliche Situation. Wir haben große Bedrohungen von außen durch die Zollpolitik der USA und durch China. Und gleichzeitig haben wir durch die Klimakrise eine große Herausforderung. Und gleichzeitig wissen wir, dass es bei Wirtschaft und Klima kein ‚entweder oder‘ gibt." Deswegen setze die Partei im anstehenden Landtagswahlkampf auf eine Wirtschaftspolitik, die mit "Klimaschutz Hand in Hand geht." Wie die Grünen in diesem Zusammenhang mit einer absehbaren Rücknahme des EU-weiten Verbrenner-Aus bis 2025 umgehen, wollte SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch von Lena Schwelling wissen.
Stuttgart21: Bahnchefin kommt um erneute Verzögerung persönlich zu erklären
Gerade erst hat die neue Bahnchefin Evelyn Palla verkündet, dass der geplante Tiefbahnhof Stuttgart 21 nicht wie geplant zum Ende des kommenden Jahres in Betrieb gehen kann. Ein neuer Termin für die Eröffnung wurde seither nicht genannt. Heute kommt die Bahnchefin persönlich zu einem Treffen des Lenkungskreises S21 nach Stuttgart. Daran nimmt auch der Ministerpräsident Winfried Kretschmann teil. In SWR Aktuell erklärt SWR-Bahnexperte Frieder Kümmerer, wobei es bei diesem Treffen geht: "Es ist das erste Zusammentreffen aller Projektpartner von Stuttgart 21 seit der Verkündung, dass der Eröffnungstermin wieder nicht eingehalten werden kann. Auch personell gesehen ist das Treffen besonders, denn zum ersten Mal seit Jahrzehnten nimmt der Ministerpräsident von Baden-Württemberg persönlich teil." Die Projektpartner hätten "großen Druck gemacht, dass die Bahnchefin persönlich nach Stuttgart kommt, um zu erklären, woran die erneute Verschiebung des Eröffnungstermins liegt." Das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart, Flughafen und Verbandregion wollten persönliche Antworten von der Bahnchefin. Was Evelyn Palla ihnen zu sagen hat, darüber hat Frieder Kümmerer mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.
Zurück in die Zukunft: So verändert ein Jahr Smartphone-Detox das Leben
Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit lassen wir das Jahr nochmal Revue passieren und schauen uns an was gut und was schlecht lief. Und vielleicht merken wir auch, dass wir in diesem Jahr wieder fürchterlich viel Zeit am Smartphone verbracht haben. Aller Disziplin zum Trotz haben wir das Smartphone auch im Bett, im Wartezimmer oder in der Bahn ständig in der Hand. SMARTPHONE JEDEN TAG ZWEIEINHALB STUNDEN IN DER HAND Auch tagsüber haben wir unser Smartphone regelmäßig und viel in der Hand. Im Schnitt nutzen wir das Smartphone etwa zweieinhalb Stunden am Tag [https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Durchschnittliche-Smartphone-Nutzung-pro-Tag], über alle Altersgruppen hinweg. Jüngere Menschen verbringen insgesamt aber noch mehr Zeit [https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/handynutzung-von-jugendlichen-100.html] vor dem Bildschirm als ältere. Auch unsere kognitiven Fähigkeiten leiden unter der Handynutzung. Laut einer Studie der Universität Paderborn [https://www.uni-paderborn.de/nachricht/123972] arbeiten wir langsamer und können uns schlechter konzentrieren, wenn wir täglich viel Zeit am Handy verbringen. Wer weniger am Handy sitzt, leidet auch nicht so stark unter den negativen Effekten. SMARTPHONE AUCH IM BETT: DIE EIGENE TOCHTER MACHT AUF EXZESSIVE NUTZUNG AUFMERKSAM Das wurde auch der Berliner Bloggerin Clara Hahn irgendwann sehr deutlich gemacht. Sie hat ihre Tochter eines Abends ins Bett gebracht. Dabei hat sie auf ihr Smartphone geschaut und dachte, ihre Tochter bekäme es nicht mit. Allerdings sagt die dann: "Mama, du starrst nur aufs Handy." Das war für Hahn ein Schlüsselmoment - sie ersetzt ihr Smartphone mit einem alten Tastenhandy. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erklärt sie, wie ihr anschließendes Smartphone-freies Jahr aussah und wie die Rückkehr zum Smartphone gelungen ist.
Rückenschmerzen: Richtige Behandlung statt Operation
Lange Jahre habe man die Faszien gar nicht beachtet, erklärt Lothar Zimmermann. Es handele sich dabei um Hüllen für das Bindegewebe, die Muskeln und Muskelfasern umgeben. Sie könnten auch verkleben und Rückenschmerzen auslösen, dann könne man sie entweder mit einer Massage oder durch eine Behandlung mit einer Faszienrolle wieder lösen. FASZIENROLLEN: NICHT EINFACH DRAUFLOS ROLLEN Wichtig sei es zunächst, die richtige Faszienrolle zu benutzen, sagt Lothar Zimmermann. Am besten sei es, sich vorher zu informieren - zum Beispiel bei einem Physiotherapeuten. Der könne einem dann auch die entsprechenden Übungen zeigen. Die Rolle sollte nicht auf die Wirbelsäule drücken. Dafür gebe es Produkte mit Rillen. AUCH BEI STARKEN RÜCKENSCHMERZEN: HAUPTSACHE BEWEGUNG Selbst bei einem Bandscheibenvorfall sei es zunächst wichtig, in Bewegung zu bleiben. Der aktuelle Therapieansatz sei, Schmerzmittel zu geben, damit Bewegung möglich ist. Wenn diese Phase länger dauere, müsse man dann noch ein Magenschutzmittel verschreiben. Auch Stress könne eine Ursache für Rückenschmerzen sein. Dann müsse man zusätzlich Entspannungsübungen machen. MANCHMAL MUSS EINE OPERATION SEIN Im Fall einer Blasen- oder Mastdarmlähmung müsse man operieren, erklärt Lothar Zimmermann. Das könne im Zweifelsfall lebensgefährlich werden. Generell gelte trotzdem, dass man heute sehr lange konservativ arbeite, also möglichst ohne eine OP. Die Arbeit mit einem Physiotherapeuten sei zwar langwierig, führe aber meist zum Erfolg. Eine Operation müsse immer das letzte Mittel sein.





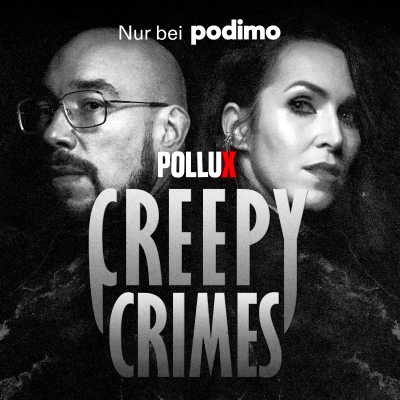






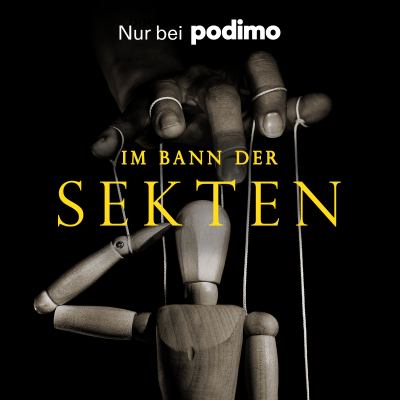

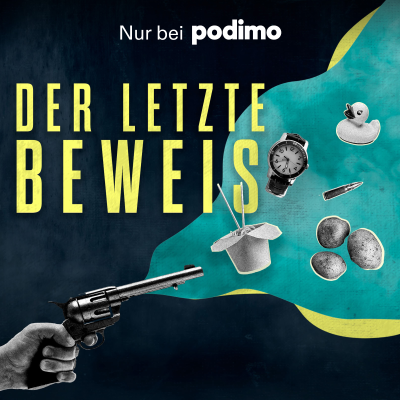
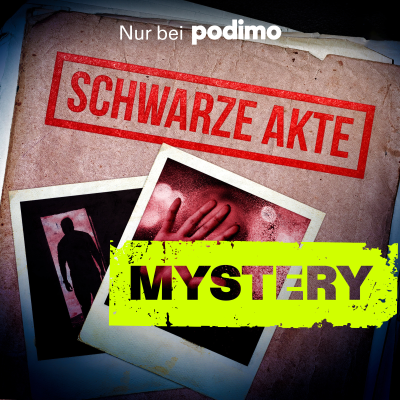




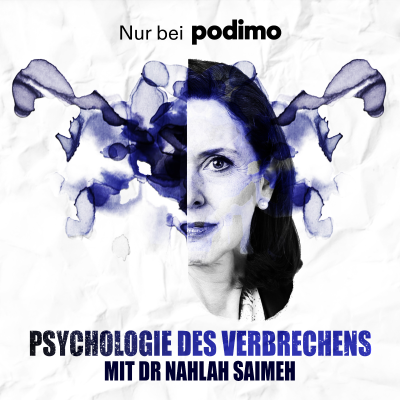



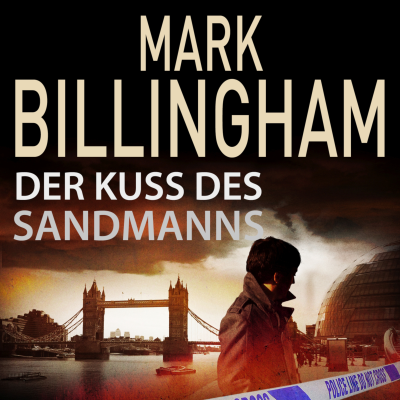
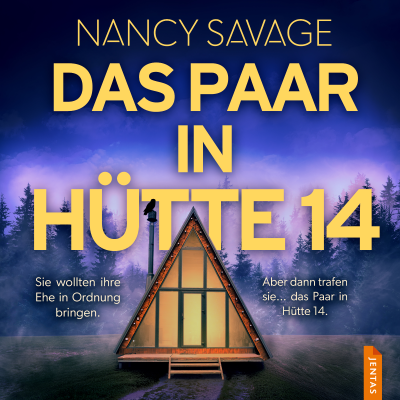
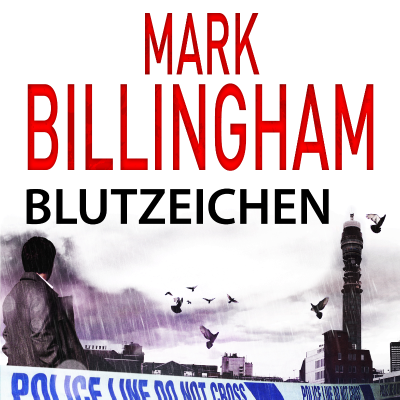
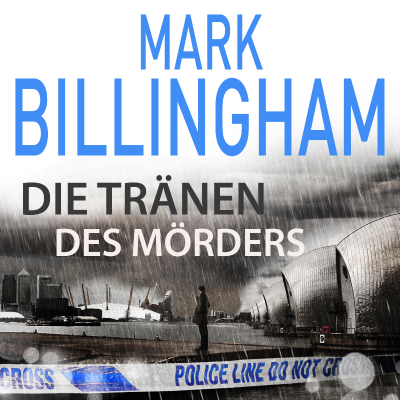

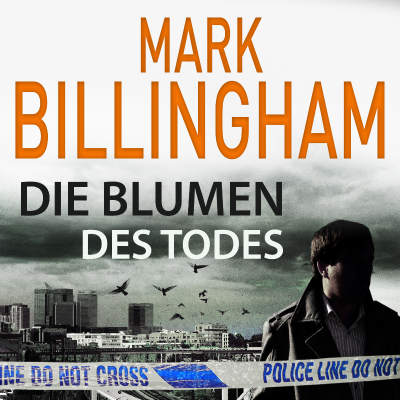
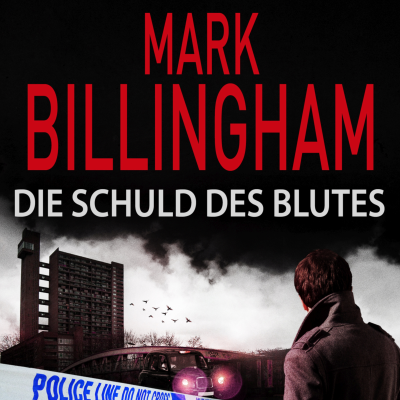
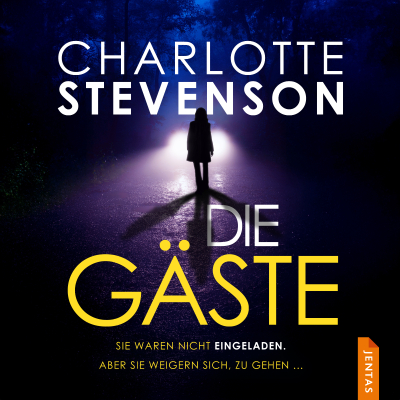
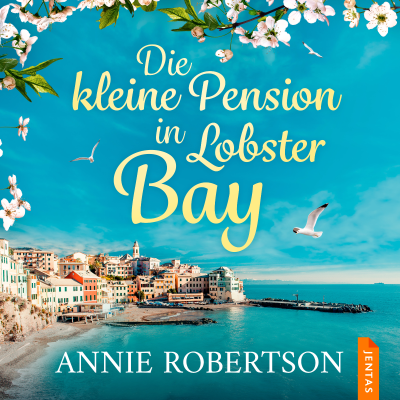
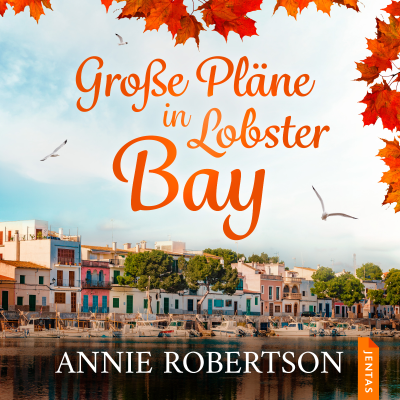
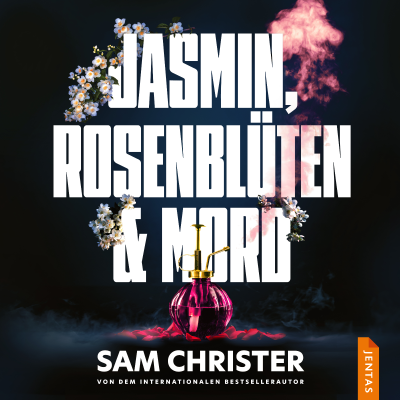
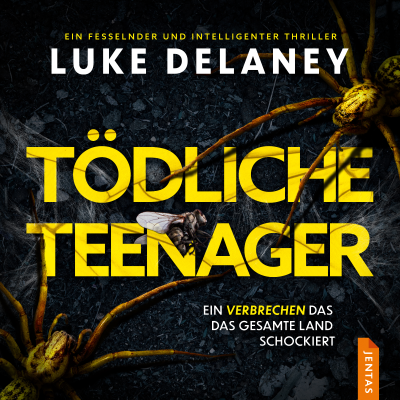
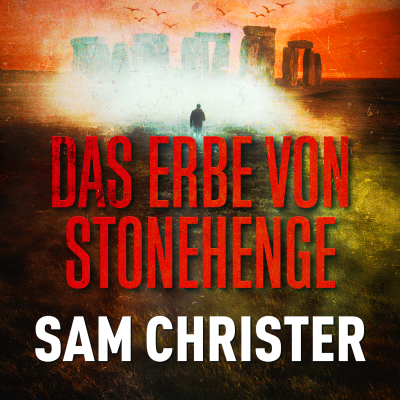
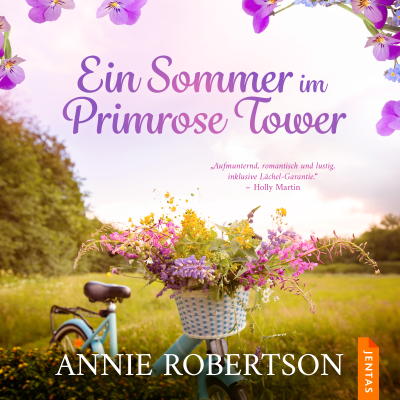
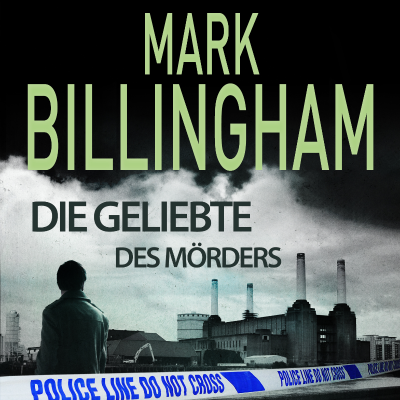
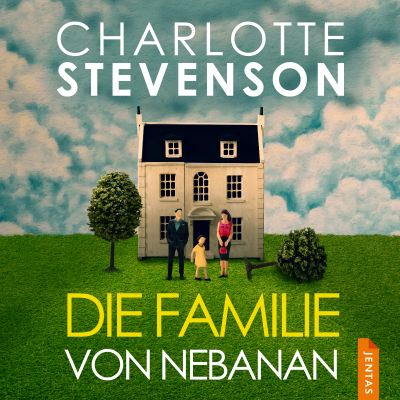
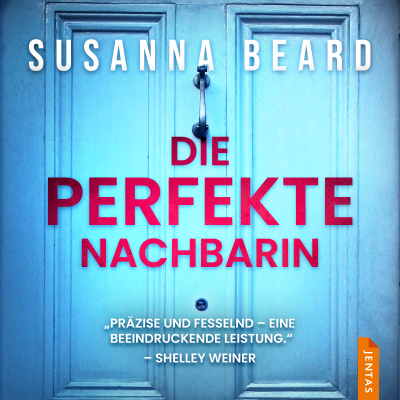
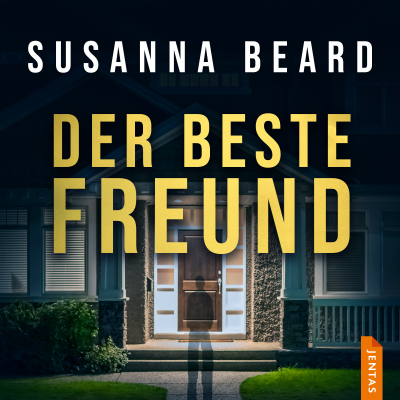
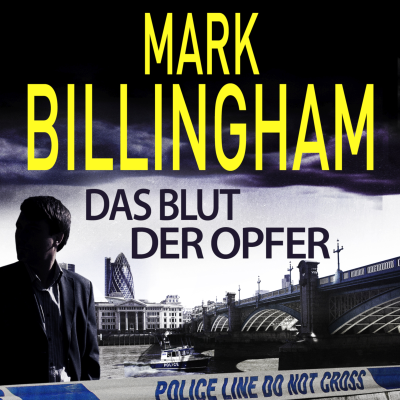
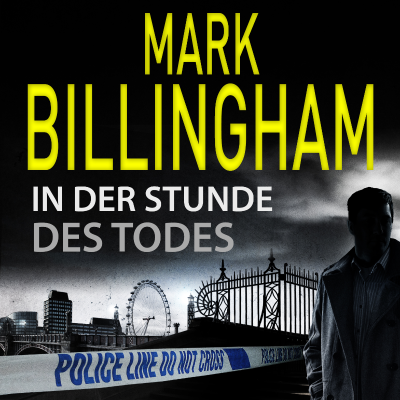
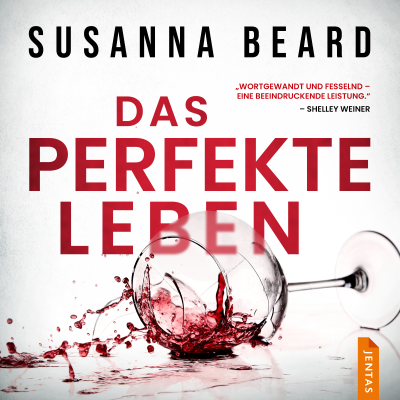
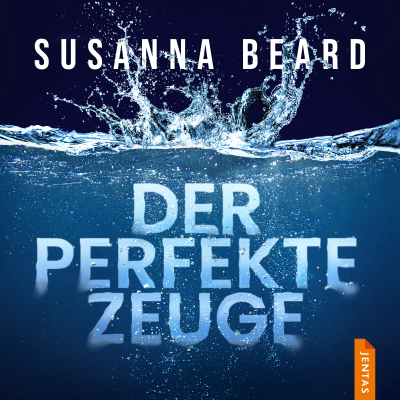
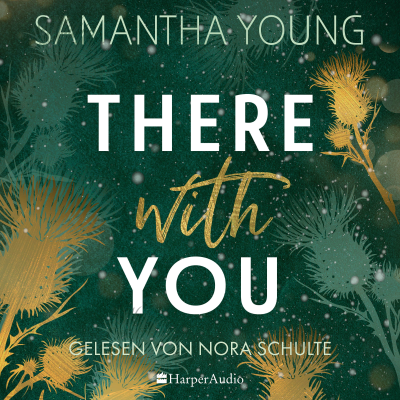
![Schöne falsche Welt [ungekürzt]](https://cdn.podimo.com/images/94ef5516-5cad-447c-a77c-763337e12a35_400x400.png)