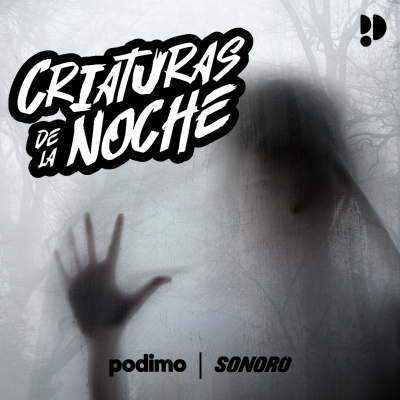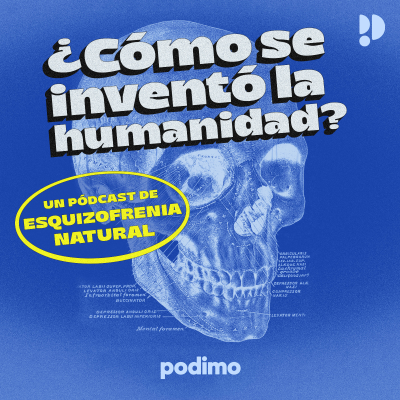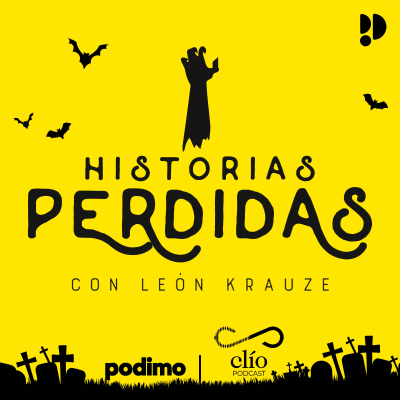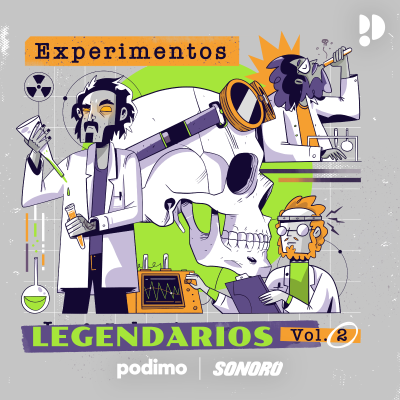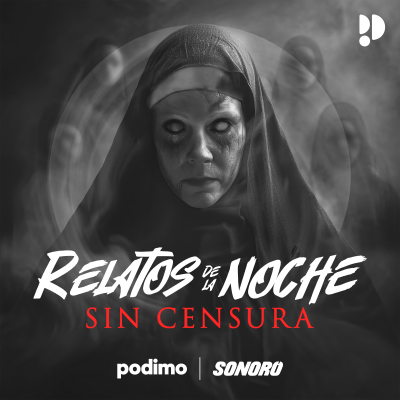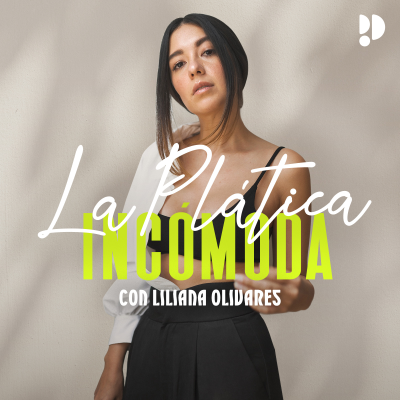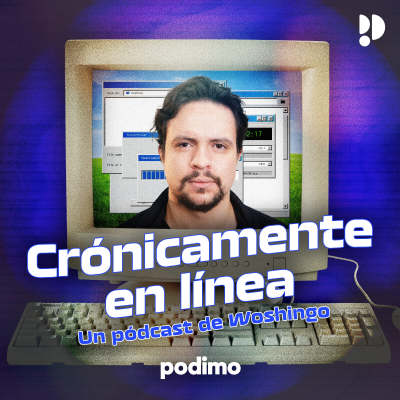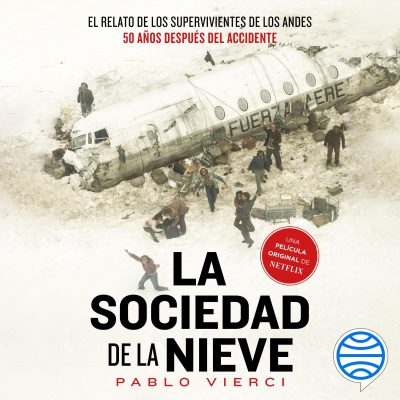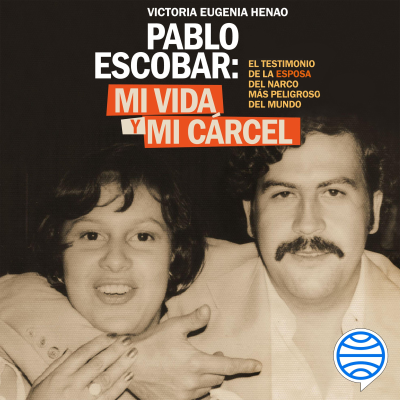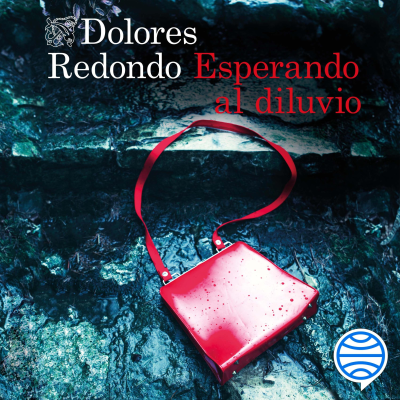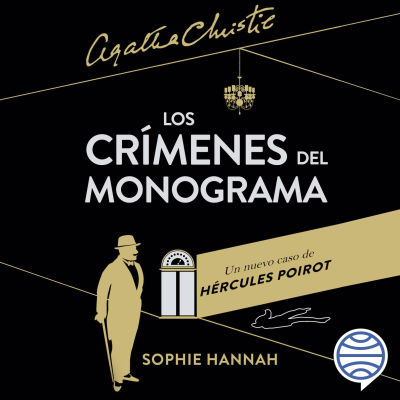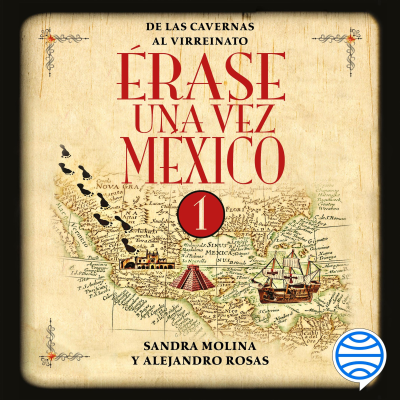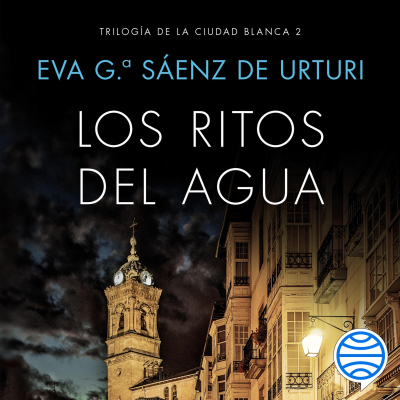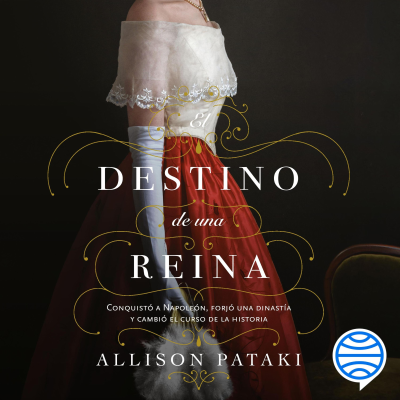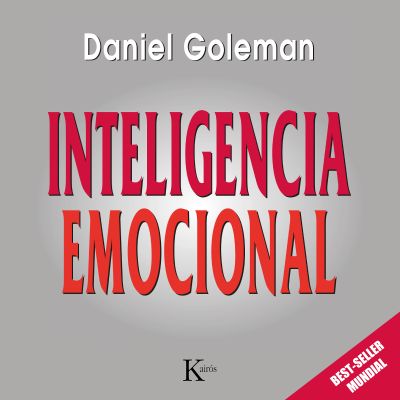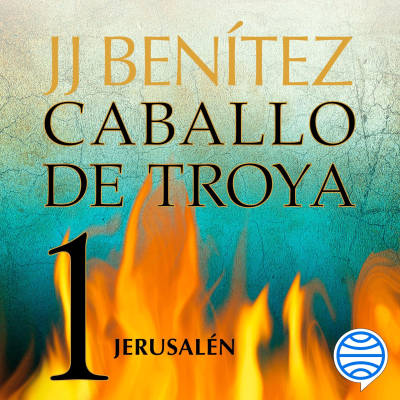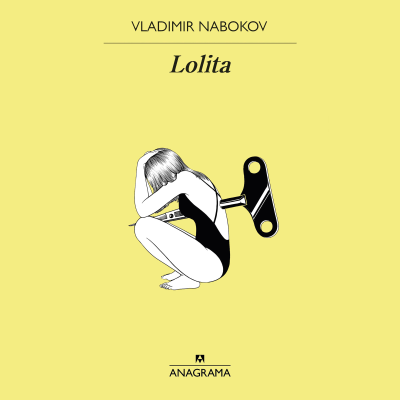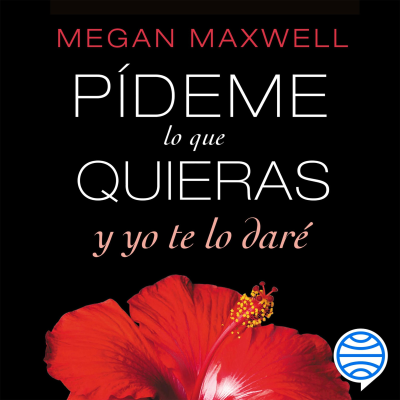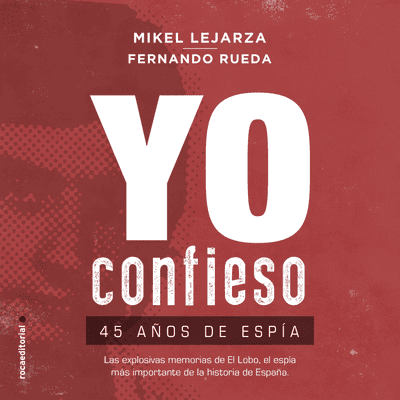In aller Ruhe
German
Personal stories & conversations
Limited Offer
2 months for 19 kr.
Then 99 kr. / monthCancel anytime.
- 20 hours of audiobooks / month
- Podcasts only on Podimo
- All free podcasts
About In aller Ruhe
Die Krisen überschlagen und verbinden sich: Pandemie, Klima, russischer Angriffskrieg. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz stellen die Gesellschaft vor immer neue Herausforderungen. Unsere Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Es lohnt sich deshalb, aus der schnellen Aktualität und der eigenen Perspektive auf die Welt auszutreten. Philosophin, Publizistin und SZ-Kolumnistin Carolin Emcke spricht in diesem Podcast dafür mit Aktivistinnen, Autoren, Künstlerinnen oder Wissenschaftlern über politisch-philosophischen Fragen hinter aktuellen Ereignissen und sortiert mit ihnen große gesellschaftliche Debatten. Die Folgen erscheinen alle zwei Wochen ab dem 25. Februar 2023.
All episodes
56 episodes„Das pure Grauen“ – Stefanie Schüler-Springorum bei Carolin Emcke über Unterdrückung in der Nachkriegsgesellschaft
Die Demokratisierung der Bundesrepublik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird häufig verklärt. Gerade die Unterdrückungserfahrungen von Minderheiten werden im Rückblick ausgeblendet. Darüber spricht Carolin Emcke im Podcast mit der Historikerin Stefanie Schüler-Springorum. Sie erzählt, wie auch lange nach dem Ende des Krieges Kontinuitäten aus der Zeit des Nationalsozialismus bestanden haben. Ein Hinweis: Ab der nächsten Folge hören Sie diesen Podcast nur noch mit einem SZ Plus-Abo. Sollten Sie noch kein SZ Plus-Abo haben, so finden Sie unter sz.de/ruheplus ein exklusives Probeabo zum Testen und Weiterhören. Mit einem Abo unterstützen Sie die Arbeit der SZ-Redaktion und damit den unabhängigen Journalismus. Stefanie Schüler-Springorum, geboren 1962 in Hamburg, leitet seit 2011 das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Zuvor hat sie das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg geleitet. In ihrem neuesten Buch „Unerwünscht. Die westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes“ schildert die Historikerin die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft aus Sicht der Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden. „Man muss demokratisch stabil bleiben.“ Stefanie Schüler-Springorum beschreibt die Ergebnisse ihrer Recherche zur deutschen Nachkriegszeit als „das pure Grauen“. Wer nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehörte, wurde ausgegrenzt und unterdrückt. Juden, Homosexuelle, Zwangsarbeiterinnen, Sinti und Roma – im Podcast beschreibt sie die Lebenswirklichkeiten dieser Bevölkerungsgruppen in den 50er- und 60er-Jahren. Und den langen Weg hin zu mehr Gleichheit in der Gesellschaft. Diskussionen über Opfer- und Täterschaft seien zu lange verkürzt geführt worden, betont die Historikerin. Im Gespräch mit Carolin Emcke legt Schüler-Springorum die Gründe dafür dar. Unter anderem nennt sie ein „deutsches Überlegenheitsgefühl“, das die Gesellschaft auch nach dem Ende des Nationalsozialismus und im Übergang zur Demokratie zusammengehalten habe. Schließlich geht es im Podcast noch darum, wie die Erinnerung an die vergangene Geschichte auch nach vielen Jahren noch aufrecht gehalten werden kann. Schüler-Springorum beklagt, dass vielen Menschen heute das Interesse an einer Auseinandersetzung mit der Geschichte fehle. Gleichzeitig plädiert sie bei dem Thema für mehr Gelassenheit. Auch ohne intensive Geschichtsstudien sei es möglich, „demokratisch stabil“ zu bleiben. „Man muss einfach hoffen, dass genug Spuren gelegt sind, auf die man sich beziehen kann.“ Empfehlung von Stefanie Schüler-Springorum Als Kulturtipp legt die Historikerin den Hörerinnen und Hörern ans Herz, sich tiefergehend mit der deutschen Geschichte zu beschäftigen. „Lest die Originale. Lest die ganze Lebensgeschichte von Hugo Höllenreiner oder von Hans Frankenthal oder den großartigen Interview-Band aus den 90er-Jahren mit jüdischen Überlebenden in Berlin.“ Moderation, Redaktion: Carolin Emcke Redaktionelle Betreuung: Ann-Marlen Hoolt Produktion: Imanuel Pedersen Bildrechte Cover: G. Faller-Walzer/Bearbeitung SZ
„Autoritäres Moment“ – Martin Saar bei Carolin Emcke über die ausgehöhlte US-Demokratie
Wochenlang greift die Trump-Regierung nun schon die Universitäten an, streicht ihnen Gelder und zwingt sie dazu, Programme für Vielfalt und Inklusion einzustellen. In dieser Woche hat sie der angesehenen Harvard-Universität Gelder in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar entzogen, weil diese sich den Forderungen der Regierung widersetzt hatte. Langsam regt sich Widerstand gegen Donald Trump. Dabei sah es lange so aus, als könne der US-Präsident ungestört gegen alles, was links, kritisch oder vielfältig ist, kämpfen. Was sagt das über die Demokratie der USA aus? Darüber spricht Carolin Emcke in dieser Folge des Podcasts mit dem Sozialphilosophen Martin Saar. Saar, geboren 1970 in Tübingen, ist Professor für Sozialphilosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er forscht zur politischen Theorie der Gegenwart und zur politischen Ideengeschichte, zu Macht, Ideologie und Demokratie. Saar ist gut in den USA vernetzt, unter anderem forschte und lehrte er an der New School of Social Research in New York. Kürzlich erschien sein Buch „Was ist Sozialphilosophie?“. ** Egal, ob Krebs- oder Genderforschung. Die ganze Wissenschaft ist betroffen** Während der Aufnahme des Podcasts befindet sich Martin Saar im amerikanischen St. Louis. Im Podcast berichtet er von Gesprächen mit Trump-Wählerinnen und Wählern, die ein generelles Gefühl der Entfremdung von politischen und wissenschaftlichen Eliten eint. „Das, was ich heraushöre, ist: Hier räumt jemand auf mit einem Laden, der als elitär abgehoben, nicht den Interessenbedürfnissen des Volkes entsprechend angesehen wird.“ Der Sozialphilosoph vermutet, dass Donald Trumps Versuche, die liberale Demokratie zu untergraben und autoritäre Strukturen in den Vereinigten Staaten zu etablieren, seinen Unterstützern ein Gefühl der Selbstermächtigung vermittle. In diesem Sinne analysiert Martin Saar auch die Budgetkürzungen bei Hochschulen und Universitäten: als generellen Angriff auf die Wissenschaft, die gemeinhin für Pluralismus und liberale Werte stehe. Dabei sei es egal, ob Krebs- oder Genderforschung betroffen sind. Das gesamte universitäre System werde „als Teil einer nicht volksmäßigen, abgehobenen, isolierten Schicht“ angesehen. Keine Disruption, sondern ein Ausnutzen der Schwächen des Systems Als Faschismus möchte Martin Saar das, was in den USA passiert, jedoch nicht bezeichnen. Stattdessen sieht er einen Autoritarismus am Werk, der die formalen Strukturen der Demokratie gleichzeitig ausnutze und aushöhle. Das demokratische System bleibe formell intakt, während Bürgerfreiheiten und Minderheitenrechte systematisch untergraben werden. Der Sozialphilosoph plädiert dafür, in der Analyse die bereits in westlichen Demokratien angelegten Ambivalenzen kritisch zu reflektieren, statt eine idealisierte Vorstellung von Demokratie zu verteidigen. „Die demokratischen Verfahren und Legitimierungsformen, hatten immer auch eine Gewaltseite.“ In diesem Kontext müsse auch die Politik der Trump-Regierung betrachtet werden. Nicht als groß angelegte Disruption des Systems, sondern als autokratisch-demokratische Mischstruktur. Empfehlung von Martin Saar Martin Saars Kulturtipp ist das kürzlich erschienene Album „Lonely People with Power“ der Band Deafheaven. „Immer wenn es mir ganz schlecht geht, höre ich das, dann geht es mir noch etwas schlechter, und die Musik führt mich aber auch genau da heraus.“ Gerade die Mischung aus Traurigkeit und Aggression des Albums spreche ihn an, erzählt Saar. Deafheaven ist eine Band, die am ehesten dem Post-Metal zugeordnet werden kann. Die Musik betont Düsternis, Atmosphäre und Emotionen. „Das ist Heavy Metal, der aus sich heraustritt und zu etwas ganz anderem wird.“ Moderation, Redaktion: Carolin Emcke Redaktionelle Betreuung: Ann-Marlen Hoolt Produktion: Imanuel Pedersen Bildrechte Cover: Jürgen Lercher, Goethe-Universität/Bearbeitung SZ
„Rückkehr der Baseballschlägerjahre“ – Marco Wanderwitz bei Carolin Emcke über den Wahlerfolg der AfD
Die AfD ist in einigen Regionen Deutschlands zur dominierenden politischen Kraft geworden. Obwohl die gesamte Partei als rechtsextremistische Verdachtsfall eingestuft ist und Teile bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft sind. Im Podcast fragt Carolin Emcke den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz, wie sich diese Entwicklung zurückdrehen lässt, ob die AfD verboten werden sollte und ob seine Partei, die CDU, den Kern konservativer Politik aus den Augen verloren hat. Wanderwitz wurde 1975 in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, geboren. Nach der Wende trat er 1990 in die Junge Union ein. Als CDU-Politiker war er von 2002 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestags. Außerdem war er parlamentarischer Staatssekretär verschiedener Bundesministerien und zwei Jahre lang Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Wanderwitz engagiert sich für eine kompromisslose Abgrenzung der CDU zur AfD und hat im vergangenen Jahr einen Antrag für ein AfD-Verbotsverfahren initiiert. Bei der vergangenen Bundestagswahl hat er auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Weltoffene und vielfältige Räume werden angegriffen Im Podcast erklärt Wanderwitz, warum er in den Wahlerfolgen der AfD eine Gefahr für die Demokratie sieht. Je kleiner ein Ort sei, desto schneller drohe dieser – bei hohen Zustimmungswerten zur AfD – „zu kippen“. Dies führe etwa dazu, dass Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören, wegziehen. Und dass sich rechtsextreme Straftaten häufen, auch Gewalttaten. Oder dass Demokratieprojekten Gelder entzogen werden. „Die Räume, in denen es vielfältig und weltoffen ist, die werden angegriffen.“ Um die Wirkmächtigkeit der AfD einzudämmen, plädiert Wanderwitz daher für ein Verbotsverfahren gegen die Partei. Im Podcast erläutert er, wie er die Chancen eines entsprechenden Verfahrens einschätzt und welche Hürden er dafür sieht. Und er spricht über die eigentliche „Mammutaufgabe“ für die Demokratie, nämlich die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückzugewinnen. Muss die CDU wieder mehr nach links rücken? Wanderwitz erklärt, wie seine Partei, die CDU, bereits jetzt versucht, den Menschen, die mit der AfD sympathisieren, im eigenen Wahlprogramm ein Angebot zu machen. Dass dies notwendig sei, erlebe er regelmäßig im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich in den etablierten Parteien nicht wiederfinden, gleichzeitig aber auch nicht die AfD wählen wollen. „Ich kann eine gewisse Zahl von Menschen nur erreichen, wenn man auch bereit ist, stellenweise zu sagen: Ich komme euch entgegen.“ Der ehemalige Bundestagspolitiker hält es für möglich, entsprechende Positionen im Wahlprogramm aufzunehmen, ohne den konservativen Kern der Partei zu vernachlässigen. Die CDU sei immer schon eine Sammlungsbewegung gewesen, die viele unterschiedliche Positionen vereine, sich aber gleichzeitig klar vom „demokratischen Abrisspunkt abgrenze. Und die damit verbundenen inneren Spannungen muss man eben aushalten und moderieren. So ist es immer gewesen.“ Empfehlung von Marco Wanderwitz Marco Wanderwitz empfiehlt eine Reise nach Chemnitz, Europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2025. „Chemnitz und das Umfeld hat viel Kultur zu bieten.“ Wanderwitz erzählt im Podcast, dass es gegen die Entscheidung für Chemnitz als Kulturhauptstadt auch Widerstand aus der rechtsextremistischen Szene gegeben habe. „Eine gelebte, vielfältige Kultur ist ja nichts, womit ein Rechtsextremist umgehen kann.“ Schon allein deshalb wünsche er sich möglichst viele Besucherinnen und Besucher in der Stadt. In den vergangenen Monaten sei er immer mal wieder auf Chemnitz angesprochen worden, „nach dem Motto 'Kann man da hingehen?' Und ich möchte ausdrücklich sagen: Ja, kann man. Und es wäre schön, wenn es möglichst viele tun.“ Moderation, Redaktion: Carolin Emcke Redaktionelle Betreuung: Ann-Marlen Hoolt Produktion: Imanuel Pedersen Bildrechte Cover: Marco Wanderwitz/Bearbeitung SZ
„Demolition Phase“– Bernard Harcourt über Trumps konservative Gegenrevolution
Die Vereinigten Staaten von Amerika scheinen zunehmend autokratischer zu werden. Schon nach zwei Monaten Trump Präsidentschaft hat sich derart viel in dem Land verändert, dass man hierzulande fast nicht mehr mitkommt. Tausende Menschen wurden in Abschiebehaft gesteckt, die Rechte von trans Menschen wurden beschränkt, viele Staatsbedienstete entlassen. Schritt für Schritt scheinen viele föderale Institutionen gerade abgebaut zu werden. Begeht Donald Trump hier einen Staatsstreich? Über diese Frage spricht Carolin Emcke mit Bernard Harcourt, US-amerikanischer Jurist und Politikwissenschaftler. Bernard E. Harcourt, geboren 1963, studierte an den Elite-Universitäten Princeton und Harvard. Er ist sowohl Politik- als auch Rechtswissenschaftler, vertrat und vertritt als Rechtsanwalt zahlreiche Häftlinge, die zum Tode oder zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt wurden. Zurzeit lehrt er als Professor sowohl an der Columbia University als auch an der École hautes études en sciences sociales in Paris. Hier ist Harcourt auch wissenschaftlicher Direktor. Sein wissenschaftlicher Fokus liegt unter anderem auf Praktiken des Bestrafens, auf kritischer Theorie und politischem Protest. Er ist Autor von mehr als einem Dutzend Bücher. Ist das ein Umsturz oder eine Gegenrevolution? Carolin Emcke und Bernard Harcourt sprechen im Podcast über die aktuelle politische Lage in den Vereinigten Staaten, insbesondere über die Bemühungen der Trump-Regierung, Bundesinstitutionen abzubauen sowie Macht und Ressourcen umzuverteilen. Harcourt analysiert dies als neue Phase einer langjährigen konservativen Gegenrevolution in den USA. Er zieht dabei Parallelen zur Reagan-Ära und dem gewaltsamen Vorgehen gegen Demonstrierende in den 1970er-Jahren. Die Trump-Regierung befinde sich gerade in der Abrissphase. „Das ist immer die einfachste Phase eines Bauprozesses“, sagt Harcourt im Podcast. „Es ist sehr einfach, eine Axt in die Hand zu nehmen und Wände einzubrechen.“ Schwerer werde es, auf den Trümmern dann wieder etwas aufzubauen, das lange und sicher hält. Harcourt spricht im Podcast außerdem darüber, welche verheerenden Auswirkungen Trumps Politik auf marginalisierte Bevölkerungsgruppen – wie Einwanderer oder trans Menschen – hat. Er erzählt von einem ehemaligen Studenten, der ohne ordnungsgemäßes Verfahren abgeschoben wurde und den er als Strafverteidiger vertreten hat. „Er wurde aus seiner Gemeinschaft gerissen und nach Jamaika abgeschoben.“ Obwohl er die Todestrakte amerikanischer Gefängnisse kenne, sagt Harcourt, „schockiert es mich immer wieder, was im Bereich der Einwanderung möglich ist.“ Europa wird den Wert der Demokratie verteidigen müssen Mit Hinblick auf den Mangel an sichtbarem Widerstand und Protest aus der amerikanischen Bevölkerung mutmaßt Harcourt, dass die Strategie der Demokratischen Partei, auf die Selbstzerstörung der Republikaner zu warten, möglicherweise fehlgeleitet sein könnte. Und er fordert Europa auf, eine aktivere Rolle bei der Verteidigung demokratischer Werte und Institutionen zu spielen. „Europäische Länder müssen verhindern, bei ihren Wahlen aus dem demokratischen Sattel geschleudert zu werden.“ Ursprünglich sollte es im Gespräch auch um die geplante Abschiebung von Mahmoud Khalil gehen. Einem Graduierten der Columbia University, der trotz Greencard abgeschoben werden sollte, weil er an pro-palästinensischen Protesten teilgenommen hat. Doch der Podcast wurde hier von aktuellen Ereignissen eingeholt. Auf Bitte von Bernard Harcourt wurde diese Passage deshalb nachträglich aus dem Gespräch herausgeschnitten. Gerne können Sie sich anhand von weitergehender Literatur zu dem Fall informieren. Eine Einordnung von SZ-Korrespondent Boris Herrmann: Trump will an Mahmoud Khalil ein Exempel statuieren. [https://www.sueddeutsche.de/politik/donald-trump-khalil-kampf-meinungsfreiheit-li.3219051] Ein Kommentar von Bernard Harcourt im britischen Guardian: The US is poised to use terror laws against students. [https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/mar/21/october-7-taskforce-students-free-speech-mccarthyism] Eine Zusammenfassung des amerikanischen New Yorker: The Case of Mahmoud Khalil. [https://www.newyorker.com/magazine/2025/03/24/the-case-of-mahmoud-khalil] American Civil Liberties Union: A Letter from Mahmoud Khalil. [https://www.aclu.org/news/free-speech/a-letter-from-palestinian-activist-mahmoud-khalil] Empfehlung von Bernard Harcourt Bernard Harcourt empfiehlt ein Album, das ihn angesichts der politischen Lage zurzeit am meisten beruhigt: „Berlin – Songs of Love and War, Peace and Exile.“ Der Jazzsänger und Komponist Theo Bleckmann interpretiert darauf Lieder von Bertolt Brecht, gemeinsam mit Fumio Yasuda, Todd Reynolds, Courtney Orlando, Caleb Burhans und Wendy Sutter. Bleckmann ist Professor für Jazzgesang an der Manhatten School of Music, stammt aber ursprünglich aus Deutschland. Moderation, Redaktion: Carolin Emcke Redaktionelle Betreuung: Ann-Marlen Hoolt Produktion: Imanuel Pedersen Bildrechte Cover: Harcourt/Bearbeitung SZ
„Geprägt werden“ – Asal Dardan über das Echo von Gewalt
Wenn Morde geschehen, benutzen wir häufig den Namen des Ortes des Geschehens als Chiffre. Wir sagen „Kassel“, „Hanau“, „Halle“ oder „Mannheim“ und meinen natürlich nicht die Städte, sondern das, was dort vorgefallen ist. Darüber, wie sich Spuren von Trauma und Gewalt in Orte einschreiben, etwa in Gebäude und Denkmäler, hat die Schriftstellerin Asal Dardan ein Buch geschrieben: "Traumaland". Darüber und über Möglichkeiten des Erinnerns spricht Carolin Emcke mit ihr in dieser Folge des Podcasts. Dardan, geboren 1978 in Teheran, ist nach der Flucht ihrer Eltern aus Iran in Köln und Berlin und Aberdeen aufgewachsen. Sie hat Kulturwissenschaften und Nahoststudien studiert. Ihr Buch "Betrachtungen einer Barbarin" war für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Dardan schreibt als freie Autorin für diverse Zeitungen und lebt mit ihrer Familie in Berlin und auf Öland in Schweden Die eigene Biografie prägt den Blick auf die Landkarte Im Gespräch mit Carolin Emcke erzählt Asal Dardan von einem Abendessen mit Freunden, bei dem die Idee für ihr Buch entstanden ist. "Ich sprach über Dessau und wie stark sich daran ein traumatischer Moment fest macht und hab erst im Laufe des Gesprächs gemerkt, dass alle am Tisch an das Bauhaus dachten, nur ich an den Mord an Oury Jalloh." Ihr sei dabei bewusst geworden, wie unterschiedlich der Blick auf die deutsche Landkarte sein könne, je nach persönlicher Erfahrung oder Biografie. Dardan plädiert dafür, diese vielfältigen Geschichten und Erfahrungen, die Deutschland bis heute prägen, sichtbarer zu machen und miteinander in Beziehung zu setzen. Nur dann könne ein komplexes Verständnis der deutschen Geschichte und Gegenwart entstehen. Die Menschlichkeit der anderen verteidigen Im Podcast geht es außerdem um die Herausforderungen im Umgang mit belastender Vergangenheit, um Verdrängung sowie Möglichkeiten des Erinnerns und der Solidarität. Dabei argumentiert Dardan, auch die Biografien der Täter in den Blick zu nehmen: "Ich glaube der Fokus sollte primär auf den Opfern liegen." Trotzdem verrieten eben gerade die Biografien der Täter häufig viel über "Kontinuitäten von Gewalt" in unserer Gesellschaft. "Wo ist der Moment, wo sie sich zurückziehen, auch von ihrer eigenen Menschlichkeit?" Sie spricht sich im Podcast für ein behutsames und reflektiertes Nachdenken über individuelle und gesellschaftliche Dimensionen von Trauma und Gewalt aus. Ihr sei es wichtig, dabei nicht vorschnell andere Positionen zu verurteilen. "Widerstand zu leisten in der Verteidigung der eigenen Menschlichkeit, das hat eine immense Kraft. Aber ich glaube gesellschaftlich geht es nur vorwärts, wenn wir für die Menschlichkeit des anderen kämpfen." Empfehlung von Asal Dardan Als Kulturtipp empfiehlt Asal Dardan einen Podcast, in den sie, wie sie sagt "regelrecht verliebt" ist. Und zwar "Past, Present, Future", moderiert von David Runciman. Dardan schätzt dessen Moderation erzählt sie, weil er sich "traut anders zu denken". Der Politikwissenschaftler lehrt in Cambridge und spricht in seinem Podcast alle zwei Wochen mit Gästen aus der Wissenschaft oder Literatur. Besonders beeindruckt hat Dardan eine Folge über "Gullivers Reisen" von Jonathan Swift. "Am Ende ist mir die Sprache weggeblieben", erzählt die Schriftstellerin. "Ich habe kaum atmen können, weil ich es so spannend fand." Moderation, Redaktion: Carolin Emcke Redaktionelle Betreuung: Ann-Marlen Hoolt Produktion: Imanuel Pedersen Bildrechte Cover: Cihan Çakmak/Bearbeitung SZ
Choose your subscription
Limited Offer
Premium
20 hours of audiobooks
Podcasts only on Podimo
All free podcasts
Cancel anytime
2 months for 19 kr.
Then 99 kr. / month
Premium Plus
Unlimited audiobooks
Podcasts only on Podimo
All free podcasts
Cancel anytime
Start 7 days free trial
Then 129 kr. / month
2 months for 19 kr. Then 99 kr. / month. Cancel anytime.