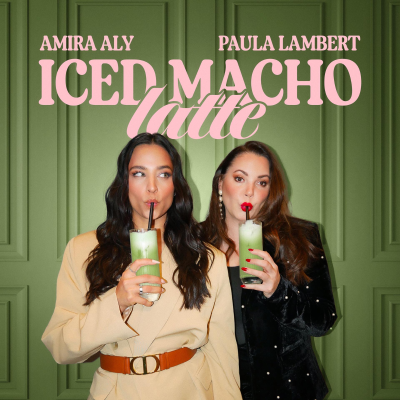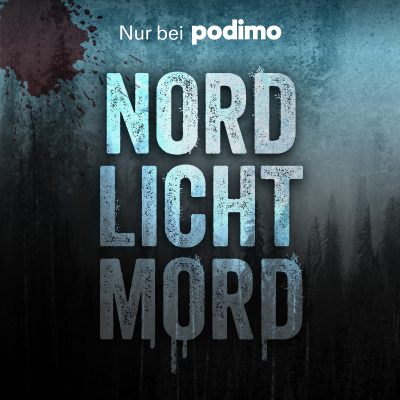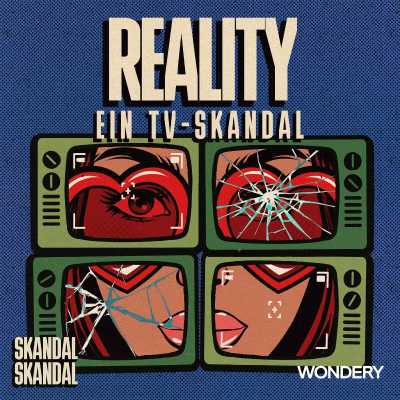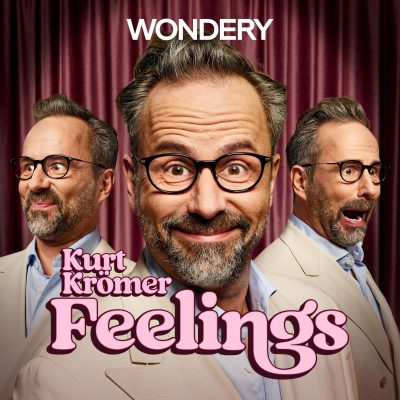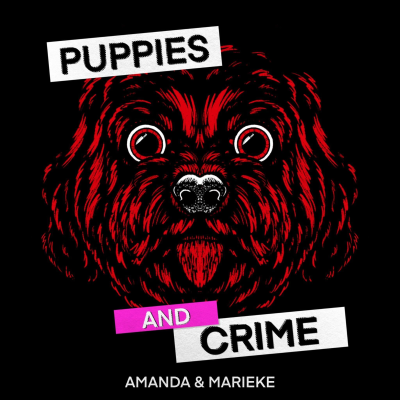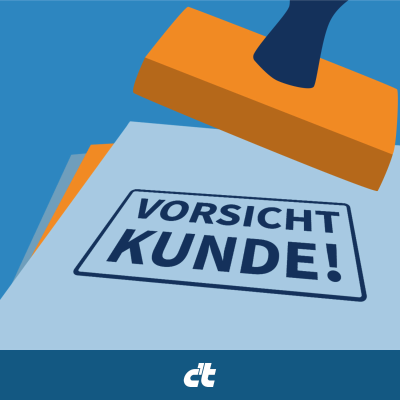
Vorsicht, Kunde!
Podcast von c’t Magazin
Nimm diesen Podcast mit
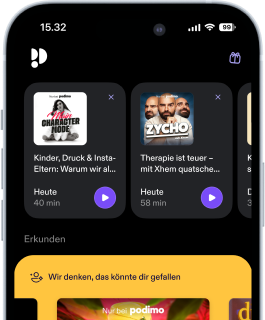
Mehr als 1 Million Hörer*innen
Du wirst Podimo lieben und damit bist du nicht allein
Mit 4,7 Sternen im App Store bewertet
Alle Folgen
38 FolgenDer Verbraucherschutz-Podcast der c’t In der aktuellen Episode sprechen wir über Probleme beim Paketversand, insbesondere wenn Pakete verloren gehen. Niklas klärt über die Rechte von Sender und Empfänger und die Pflichten des Transportdienstleisters auf: Wer kann einen Nachforschungsantrag stellen, wie lange hat der Paketdienstleister Zeit, auf eine Verlustmeldung zu reagieren und wer haftet bei Verlusten? Wer bei einem missglückten Versand haftet, hängt vom sogenannten Gefahrübergang ab. Verkaufen Unternehmen eine Ware an private Verbraucher, sind sie bis zur Zustellung der Ware für die Sendung zuständig. Bei Geschäften zwischen Privatleuten endet die Haftung des Versenders dagegen mit Übergabe des Pakets an den Versanddienstleister. Urs rät dringend dazu, die zu versendende Ware sicher zu verpacken, damit sie beim Transport auch mal rauer behandelt werden kann. Außerdem empfiehlt er, sich Sendungen an einen Paketshop schicken zu lassen statt nach Hause, oder aber eine Abstellgenehmigung am Haus zu erteilen. Ulrike weist darauf hin, dass die Pakete dann nicht mehr versichert sind, sobald der Lieferdienst sie abgelegt hat. Sie bevorzugt deshalb eine Packstation, bei Niklas nehmen stattdessen die Nachbarn alle Sendungen entgegen. Geht ein Paket verloren, sollte man einen Nachforschungsantrag stellen und in diesem alle nötigen Fakten zum verschickten Inhalt nennen, also was ist drin, welchen Wert hat die Ware, wann wurde sie verschickt und mit welcher Liefernummer quittiert. Außerdem sollte man alle Belege anhängen, eine Frist setzen und gegebenenfalls Schadensersatzansprüche geltend machen. Wie man beim Paketdienst effektiv sein Recht einfordert, welche Fristen beim Paketversand und der Verlustklärung angemessen sind und was es mit der Bring-, Hol- und Schickschuld auf sich hat, klären wir Podcasts. Der Fall Andreas K.: Vorsicht Kunde: Lange Reaktionszeiten bei DPD [https://www.heise.de/-10289657] Gesetze und Verordnungen: § 446 Gefahr- und Lastenübergang [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__446.html] § 447 BGB Gefahrübergang beim Versendungskauf [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__447.html] § 475 Abs. 2 BGB Verbrauchsgüterkauf: Gefahr des zufälligen Untergangs [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__475.html] § 823 Absatz 1 BGB Schadensersatzpflicht [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__823.html]
Der Verbraucherschutz-Podcast der c’t Ein verlockendes Angebot im Rahmen einer Kundenrückgewinnung, eine mündliche Zusage am Telefon und am Ende gilt der versprochene Rabatt doch nicht. Was passiert, wenn die mündlichen Absprachen später in der Vertragszusammenfassung fehlen und wie verbindlich sind mündlichen Zusagen überhaupt? Grundsätzlich gilt in Deutschland Vertragsfreiheit, erklärt Niklas. Ein Vertrag kann mündlich, schriftlich oder sogar rein durch schlüssiges Verhalten wie täglich beim Brötchenkauf zustande kommen. Nur wenige Verträge wie Miet- oder Arbeitsverträge und notarielle Beurkundungen benötigen die Schriftform. Eine mündliche Zusage am Telefon ist demnach bindend, doch kommt es zum Streit, steht Aussage gegen Aussage. Deshalb solltet ihr die schriftliche Vertragszusammenfassung der mündlichen Vereinbarung, die ein Anbieter nach einem Telefonat schickt, sofort prüfen. Falls sie nicht mit der mündlichen Absprache übereinstimmt, solltet ihr möglichst schnell schriftlich reklamieren und dem Anbieter eine kurze Frist zur Korrektur setzen. Dabei ist es wichtig, das gesetzliche Widerrufsrecht im Auge zu behalten. Wer zu lange auf Korrekturen wartet, verliert diese einfache Möglichkeit, aus dem Vertrag auszusteigen und steckt im Beweisdilemma, warnt Niklas. Urs vermutet hinter den vagen Aussagen von Kundenservices oft Systemprobleme: Was im System nicht vorgesehen ist, kann der Mitarbeiter auch nicht eingeben. Für den Kunden ist das jedoch unerheblich. Niklas bringt mal wieder seine Lateinkenntnissen an, die Ulrike leider fehlen. "Pacta sunt servanda" bedeutet im Zivilrecht "Verträge sind einzuhalten". Dass in einigen Fällen §164 BGB weiterhilft und wieso der Gesprächspartner sich nicht mit einem Hinweis auf Datenschutz aus der Affäre ziehen kann, besprechen wir im Podcast. Der Fall Martin K.: O2 verweigert Rabatt für DSL-Anschluss [https://www.heise.de/-10491460] Gesetze und Verordnungen: § 164 BGB: Vertretungsmacht bei Stellvertretung [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__164.html] § 355 BGB: Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__355.html] Artikel 15 DSGVO: Auskunftsrecht der betroffenen Person [https://dejure.org/gesetze/DSGVO/15.html] § 59 Telekommunikationsgesetz (TKG): Anbieterwechsel und Rufnummernmitnahme [https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2021/__59.html]
Der Verbraucherschutz-Podcast der c’t Wer mehr über den eigenen Stromverbrauch erfahren möchte und diesen flexibel auf die jeweils aktuellen Strompreise anpassen kann, braucht ein Smart Meter. Solche intelligenten Messstellen erfassen den Verbrauch im Viertelstundentakt und übermitteln die Daten zum Messstellenbetreiber, der sie an den örtlichen Netzbetreiber und der wiederum an den Stromanbieter weiterreicht. Seit diesem Jahr haben Kunden Anspruch auf ein intelligentes Messsystem: Theoretisch muss es auf Wunsch innerhalb von vier Monaten eingebaut werden. In der Praxis scheitert das aber oft daran, dass die Messstellenbetreiber beziehungsweise die von ihnen beauftragten Handwerksbetriebe nicht mit der Installation, der Einbindung ins Netzwerk und der Anmeldung hinterherkommen. Die Installation funktioniert meist noch, denn die kann jeder Elektriker übernehmen. Problematischer ist schon die Netzwerkanbindung, und bei der Kommunikation der beteiligten Unternehmen untereinander geht das meiste schief, berichtet Urs. Hat man mit dem Energieversorger einen Vertrag über einen dynamischen Stromtarif abgeschlossen, bietet dieser oft einen preislich interessanten Übergangstarif an. Der sollte nicht an einen festen Ablauftermin geknüpft sein, sondern bis zur Einrichtung des Smart Meters und der Umstellung auf den neuen Tarif läuft, rät Niklas. Dauert der Wechsel dann länger und entstehen dadurch zusätzliche Kosten, können Kunden Schadensersatz nach §280 BGB einfordern. Die Bundesnetzagentur hält auf ihrer Webseite Vorlagen für Beschwerden bereit. Der Einbau des Smart Meter darf bei einem Stromverbrauch von unter 6000 kWh pro Jahr maximal 100 Euro kosten. Hinzu kommen jährliche Betriebskosten, die zwischen 30 und 50 Euro liegen. Höhere Installationskosten muss der Messstellenbetreiber sehr genau begründen. Das gilt aber nur, wenn man den grundzuständigen Messstellenbetreiber beauftragt hat, warnt Urs. Überlässt man den Einbau einem anderen Unternehmen, etwa dem Installateur der Photovoltaikanlage, sollte man den Kostenvoranschlag sehr genau daraufhin prüfen. Außerdem kommen oft weitere Kosten hinzu, etwa wenn ein neuer Zählerkasten eingebaut werden muss oder es an Ort und Stelle weder WLAN noch Ethernet gibt. Weil sich aus den erfassten Energiedaten einige sehr persönliche Dinge ableiten lassen, prüft und zertifiziert das Bundesamt für Sicherheit in der In¬formationstechnik (BSI) sowohl Geräte als auch Betreiber. Wer die personenbezogenen Daten verarbeiten darf, beschreibt das Messstellenbetriebsgesetz. Der Fall Martin B.: Octopus Energy vergeigt Smart-Meter-Installation [https://www.heise.de/-10474248] Gesetze, Regelungen, Vorlagen: § 21 Messstellenbetriebsgesetz: Mindestanforderungen an intelligente Messsysteme [https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/__21.html] § 49 MsbG: Verarbeitung personenbezogener Daten [https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/__49.html] § 14a EnWG: Netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen [https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__14a.html] Artikel 25, DSGVO: Datenschutz durch Technikgestaltung [https://dejure.org/gesetze/DSGVO/25.html] Artikel 32, DSGVO: Sicherheit der Verarbeitung [https://dejure.org/gesetze/DSGVO/32.html] Broschüre der Bundesnetzagentur zu intelligenten Messsystemen [https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Metering/Flyer_iMSys.pdf?__blob=publicationFile&v=1] Vorlagen der BSI für Beschwerden [https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/BeschwerdeSchlichtung/start.html]
Der Verbraucherschutz-Podcast der c’t Wer seine Wohnung umgestaltet, oder den Kleiderschrank aufräumt, kann die überflüssigen Dinge einfach im ehemaligen eBay-Portal kleinanzeigen.de anbieten. Doch wehe, wenn das Unternehmen das Angebot als kritisch einstuft. Dann zieht es die Anzeige ein und kann danach das gesamte Nutzerkonto vorübergehend oder sogar endgültig sperren. Die Einstufung für vermeintliche AGB-Verstöße erfolgt automatisch, also ohne Eingriff eines Menschen. In einem zweiten Schritt kann die Kleinanzeigen-Moderation die Entscheidung überprüfen, muss sie aber nicht. Gemäß Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sollte eine solche automatisierte Entscheidungsfindung verhindert werden, sofern sie rechtlich relevante Wirkung hat, erklärt Niklas. Und weist zugleich auf die Ausnahme in Artikel 22, Absatz 2 a hin. Diese greift, sofern die vollautomatisierte Entscheidung notwendig ist, um ein Vertragsverhältnis zu erfüllen. Geht man davon aus, dass wöchentlich mehrere zehntausend Inserate bei Kleinanzeigen online gehen, ist es dem Unternehmen kaum möglich, diese komplett manuell auf unzulässige Inhalte zu prüfen. Über eine Kontensperrung bei Kleinanzeigen kann man sich innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnisnahme beschweren. Beschwerden sind jedoch nicht so einfach, denn Kleinanzeigen verrät nicht, weshalb eine Anzeige gesperrt wurde. Hier sollte man sich die Nutzungsbedingungen genau anschauen sowie die unzulässigen Aktivitäten studieren und auf keinen Fall dieselbe Anzeige erneut schalten, rät Urs. Denn dann greift wieder die Entscheidungsautomatik und sperrt den Nutzeraccount womöglich dauerhaft, weil ein mehrfacher Verstoß vorliegt. Und wer einmal dauerhaft ausgeschlossen wurde, darf sich auch nicht mit einem anderen Nutzerkonto anmelden. Was Betroffene tun sollten, wenn sie von Kleinanzeigen ausgesperrt werden, diskutieren wir im Podcast. Der Fall Falk K.: kleinanzeigen.de sperrt Kunden aus [https://www.heise.de/-10437073] Nutzungsbedingungen und DSGVO: Nutzungsbedingungen von Kleinanzeigen [https://themen.kleinanzeigen.de/nutzungsbedingungen/] Unzulässige Aktivitäten bei Kleinanzeigen [https://themen.kleinanzeigen.de/policy/#unzulaessig] Artikel 22, DSGVO: Automatisierte Entscheidungen [https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html]
Der Verbraucherschutz-Podcast der c’t Lotto, Sportwetten, online-Casino – Glücksspiel ist beliebt. Der Gewinn beim Glücksspiel hängt allerdings ausschließlich vom Zufall ab und ist nicht planbar. Genau dieser Zufalls unterscheidet Glücksspielen von anderen Spielen wie beispielsweise Pokern, dessen Ausgang man mit ausreichend Übung und Geschick zumindest in Teilen beeinflussen kann. Wer beim Glücksspiel gewinnt, muss auf den Geldwert, das gewonnene Auto oder andere Gewinne keine Steuern zahlen. Wer dagegen professionell spielt, etwa besagtes Pokerspiel, muss seinen Gewinn versteuern. Die Einnahmen aus Glücksspielen kommen anders als beim Poker nicht nur dem Veranstalter, sondern auch der Allgemeinheit zugute: Der Staat bekommt einen Teil der eingesetzten Gelder, um sie sinnstiftend für wohltätige Zwecke auszugeben. Wer einen Lottogewinn erbt, muss diesen anders als der ursprüngliche Gewinner im Rahmen der Erbschaftssteuer versteuern. Dabei haben Erben ein Recht auf Auszahlung, erklärt Niklas. Um etwaige Widersprüche auszuräumen, sollten Betroffene mit einem Erbschein nebst Angabe von Adresse und Kontonummer beim Vertragspartner auf sofortige Auszahlung bestehen. Etwaige Nutzerkonten der Verstorbenen sollten anschließend im Rahmen des Sonderkündigungsrechts wegen Todesfall aufgelöst werden. Wird ein Konto durch einen Todesfall nicht mehr genutzt, darf es der Glücksspielanbieter erst mit Ablauf der in den AGB genannten Frist kündigen. Einige Glücksspielanbieter neigen wie bei dem im Podcast behandelten Fall von Jochen B. dazu, Erben zu verunsichern, indem sie unzutreffende Angaben machen. Wie man in solchen Fällen vorgeht, besprechen wir im Podcast. Der Fall Jochen B.: Lottohelden.de will vererbtes Guthaben behalten [https://www.heise.de/-10435019] Gesetze: Glücksspielstaatsvertrag 2021 [https://gluecksspiel-behoerde.de/de/fuer-gluecksspielanbieter/gesetzliche-regelungen]