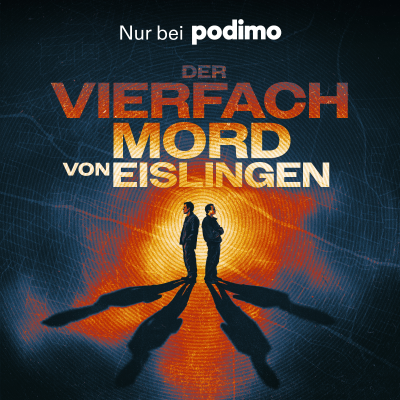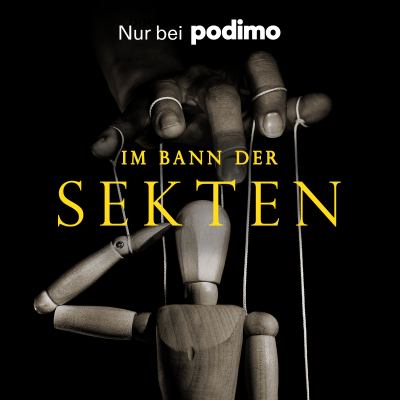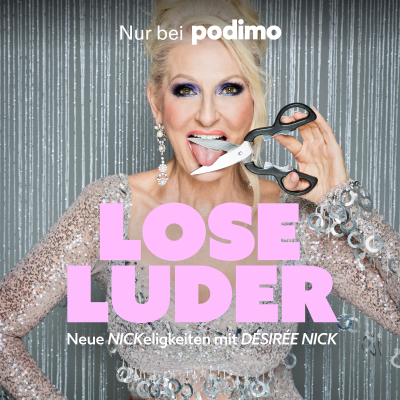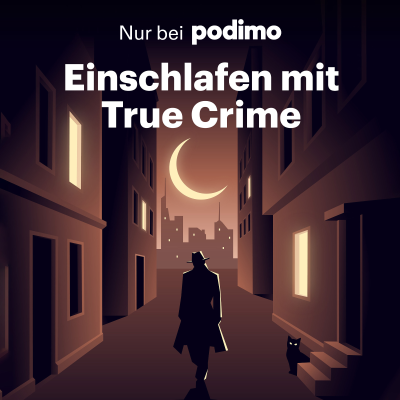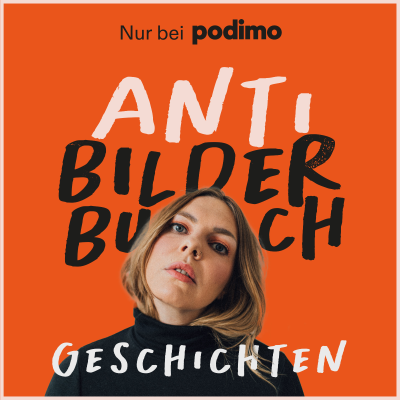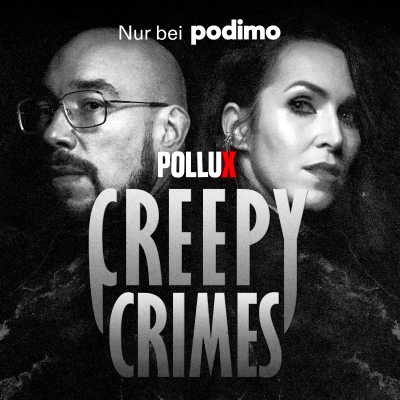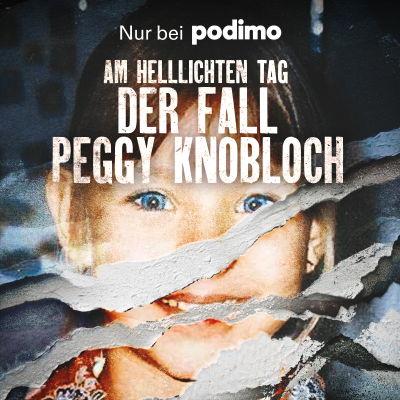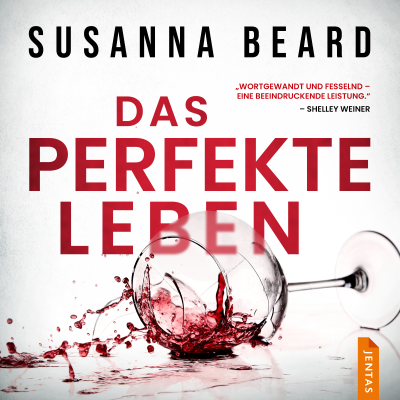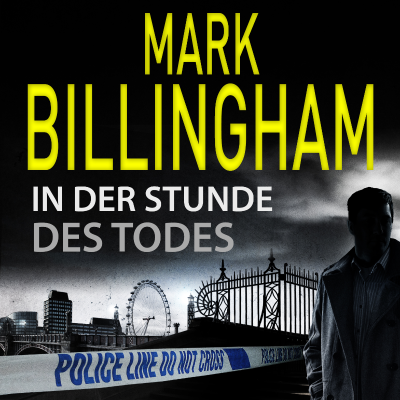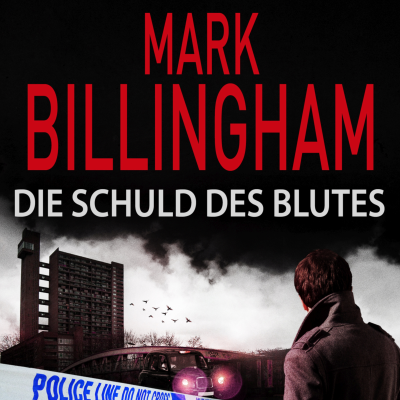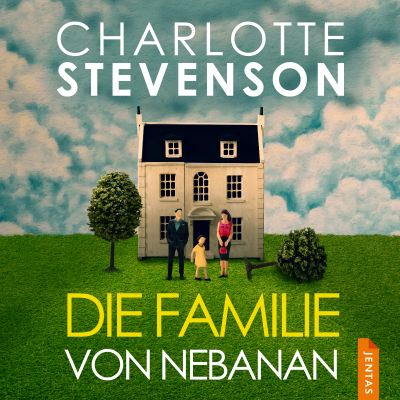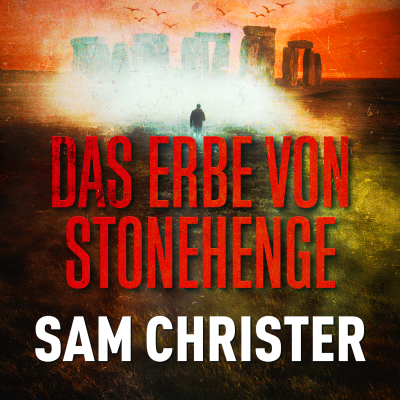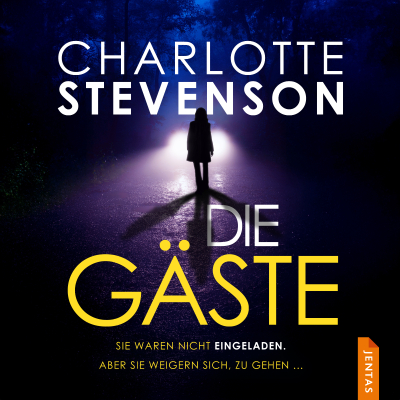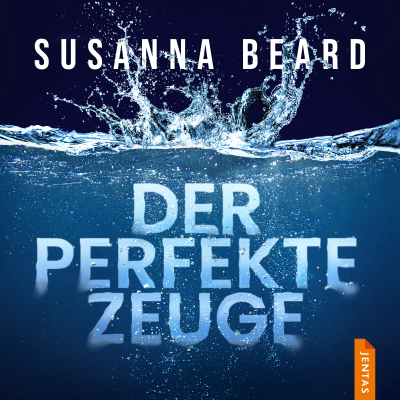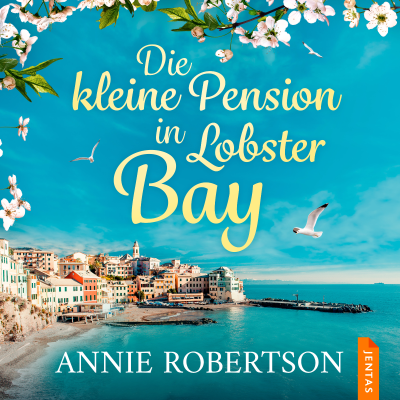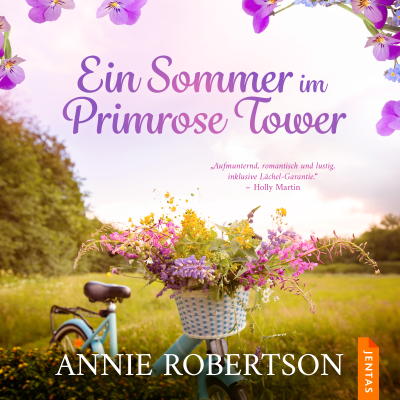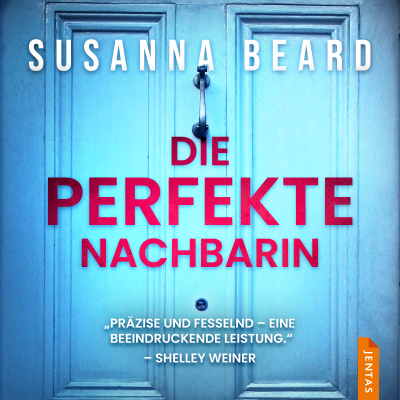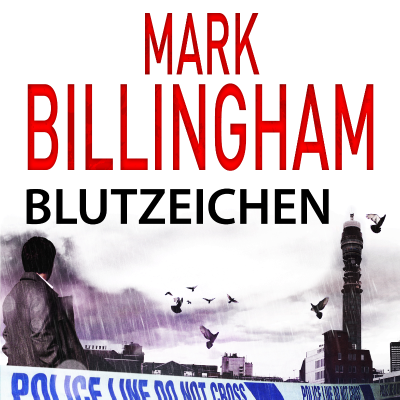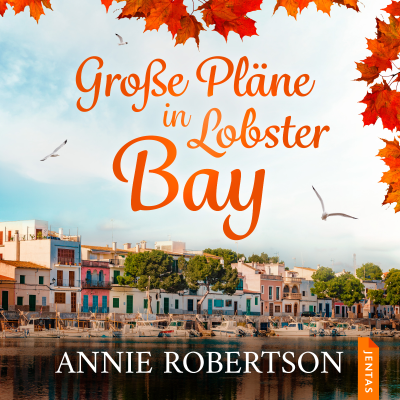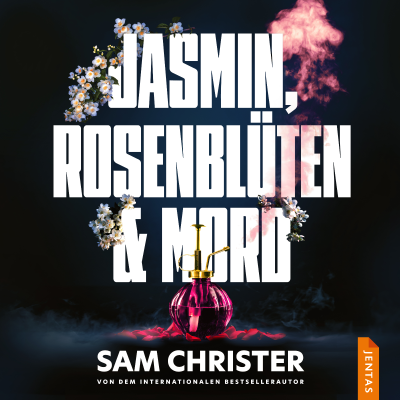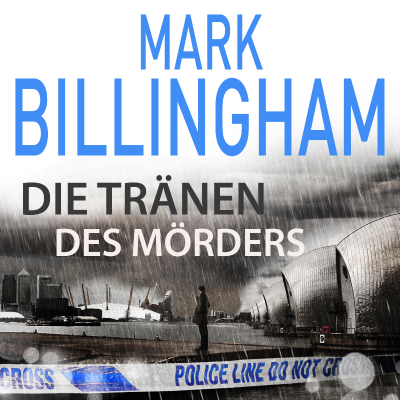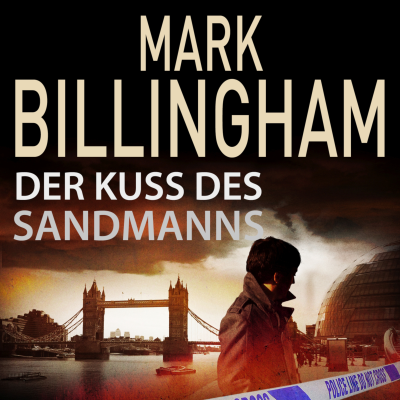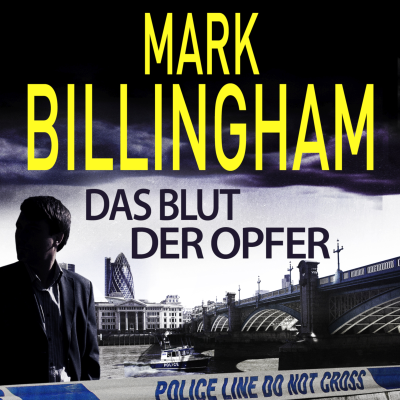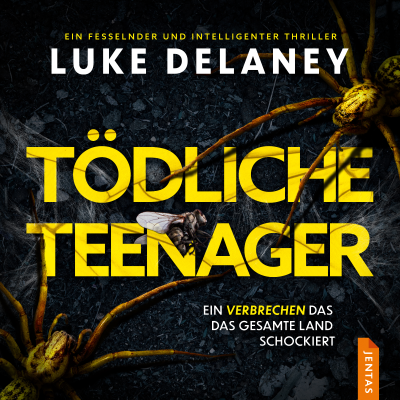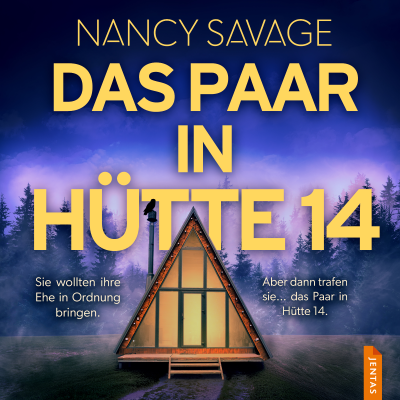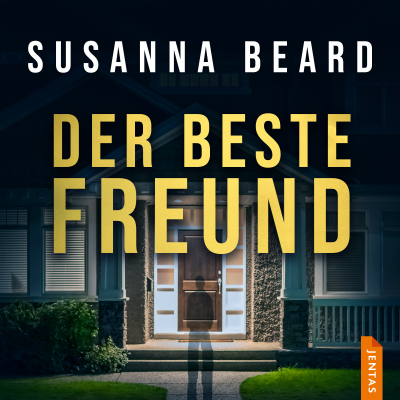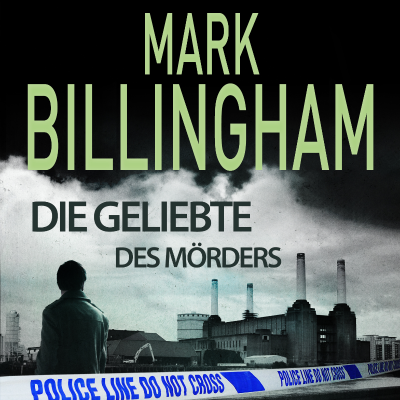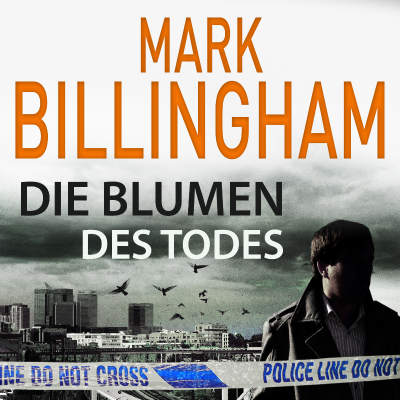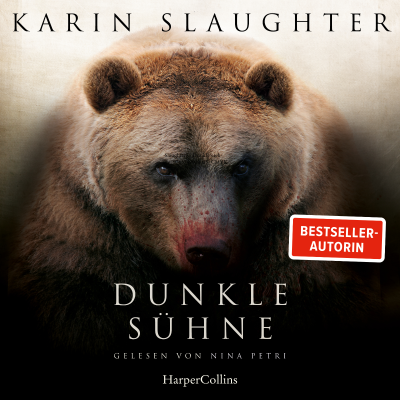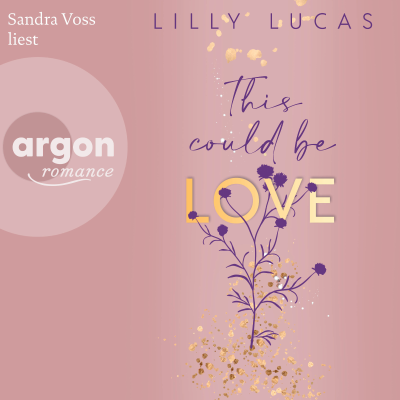Das Thema
1.2K
Deutsch
Gratis en Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr Das Thema
Welches Thema bewegt diese Woche besonders? Welchen Schwerpunkt behandelt die Süddeutsche Zeitung ausführlich? Lars Langenau und Timo Nicolas diskutieren mit den Autorinnen und Autoren der SZ das Thema der Woche und die Hintergründe der Recherchen. Das Beste aus den Geschichten der SZ – zum Hören.
Alle Folgen
297 Folgen"Das Krankenhaus des Todes": Folter in Syrien unter Assad
Unter der Herrschaft von Baschar al-Assad verschwanden in Syrien seit dem Arabischen Frühling 2011 mehr als 160 000 Menschen. Den Großteil dieser Menschen dürften die Schergen des gestürzten Diktators ermordet haben. Das Regime hat einen Teil seiner Taten akribisch dokumentiert. Ein Datensatz mit entsprechenden Fotos und Unterlagen war dem NDR übergeben worden, der ihn gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung, dem WDR und dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ausgewertet hat. Die Ergebnisse wurden nun von mehreren Medien weltweit unter dem Titel "Damascus Dossier" veröffentlicht. Woher die Daten stammen und was die abertausenden Fotos von Leichen belegen, darüber spricht Lena Kampf, stellvertretende Leiterin des SZ-Ressorts Investigative Recherche und eine der vielen Beteiligten an diesem internationalen Projekt, im SZ-Recherchepodcast “Das Thema”. Das Militärkrankenhaus Harasta in Damaskus spielt eine zentrale Rolle in Assads Unterdrückungsmaschinerie: Häftlinge wurden dort schwer misshandelt und gefoltert. Und dort wurden auch die Leichen aus Gefängnissen der Geheimdienste fotografisch dokumentiert, bevor sie in Massengräbern verscharrt wurden. Das Regime hat laut Kampf versucht, den Schein der Legalität aufrechtzuerhalten, indem massenweise Todesscheine mit falschen Angaben ausgestellt wurden. Die detaillierten Dokumentationen dienten der internen Kontrolle und gleichzeitig zur Verschleierung dieser Verbrechen. Zum Weiterlesen: Die Texte zum “Damascus Dossier” lesen Sie hier. [https://www.sueddeutsche.de/thema/Syrien] In Koblenz sind fünf Männer angeklagt, weil sie in Damaskus gefoltert und getötet haben sollen. Hier lesen Sie einen Bericht unserer Korrespondentin über diesen Prozess. [https://www.sueddeutsche.de/politik/koblenz-prozess-syrer-folter-assad-li.3337870] Hier finden Sie den Text unseres Krisenreporters Tomas Avenarius, [https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/mazen-hamada-symbol-hoffnung-traeume-aufstand-e115043/] der in Damaskus vor einem Jahr den Trauerzug für einen vom Regime ermordeten Aktivisten begleitet hat, dessen Foto auch in dem Datensatz gefunden wurde. Wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns unter podcast@sz.de [podcast@sz.de]. Klicken Sie hier, wenn Sie sich für ein Digitalabo der SZ interessieren, um unsere exklusiven Podcast-Serien zu hören: www.sz.de/mehr-podcasts [http://www.sz.de/mehr-podcasts] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Wenn der Mann an Verschwörungsmythen glaubt
Social Media ist ein idealer Verstärker für Verschwörungserzählungen, in denen die Welt nur noch als bipolar wahrgenommen wird. Was tun, wenn jemand aus der eigenen Familie abdriftet? Darüber spricht Christina Lopinski in der aktuellen Ausgabe des SZ-Recherchepodcasts “Das Thema”. Sie hat einer Frau getroffen, deren Mann solchen Erzählungen vertraut. “Wenn Menschen an Verschwörungserzählungen glauben, dann haben sie ganz automatisch das Gefühl, über eine Art Geheimwissen zu verfügen“, sagt zudem Roland Imhoff, Professor für Sozial- und Rechtspsychologie an der Gutenberg-Universität in Mainz. „Sie fühlen sich erleuchtet.“ Oft, so Imhoff, hänge der Glaube an Verschwörungsmythen eng mit biografischen Episoden des Scheiterns zusammen. Zum Weiterhören und -lesen: Den Text zu Lopinskis Recherche “Mein Mann, der Schwurbler” lesen Sie hier [https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/gesellschaft/liebe-verschwoerungserzaehlungen-beziehung-e160358/]. Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Movieclips. Moderation, Redaktion: Lars Langenau Redaktion: Katharina Erschov, Annkathrin Stich, Laura Terberl Produktion: Imanuel Pedersen Klicken Sie hier, wenn Sie sich für ein Digitalabo der SZ interessieren, um unsere exklusiven Podcast-Serien zu hören: www.sz.de/mehr-podcasts [http://www.sz.de/mehr-podcasts] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Frankreichs Horrorjahr 2015: Charlie Hebdo, Germanwings, Bataclan
Christian Wernicke war 23 Jahre Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung: in Brüssel, Washington, D.C., Paris und zuletzt in Düsseldorf für die Berichterstattung aus Nordrhein-Westfalen. In seiner Zeit in Frankreich erlebte er den rasanten Aufstieg von Emmanuel Macron, aber auch „elendig viel Terror“, wie er sagt. Im Recherchepodcast „Das Thema“ berichtet Wernicke über seine Erfahrungen in Frankreichs „Horrorjahr 2015“: zunächst die Anschläge auf das Satiremagazin Charlie Hebdo am 7. Januar in Paris und dann am 24. März den vom Co-Piloten geplanten Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen. Im November dann die Massaker von Islamisten in den Straßen von Paris und bei einem Konzert im Bataclan, deren Brutalität und Grausamkeit nicht nur Wernicke tief erschüttert hat. Eindrücklich schildert Wernicke, wie er diese Zeit erlebt hat und welche Herausforderungen diese Ausnahmesituationen auch an einen gestandenen Journalisten stellen – und er spricht offen über die psychische Belastung für ihn persönlich. Zudem reflektiert er die gesellschaftlichen Auswirkungen der Terroranschläge, die bis heute nicht nur in Frankreich wirkmächtig sind. Zum Weiterlesen: Alle Texte von Christian Wernicke finden Sie hier. [https://www.sueddeutsche.de/autoren/christian-wernicke-1.1143392] Den Podcast zum Abschied unserer Österreich- und Osteuropa-Korrespondentin Cathrin Kahlweit hören Sie hier. [https://www.sueddeutsche.de/politik/osteuropa-autoritaere-rechtsextreme-rechtspopulismus-li.3200101] Die Ausgabe von “Das Thema” mit unserem ehemaligen Israel-Korrespondenten Peter Münch hören Sie hier. [https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-nahost-gewalt-konflikt-hoffnung-li.3209107] Moderation, Redaktion: Lars Langenau Redaktion: Timo Nicolas, Laura Terberl Produktion: Imanuel Pedersen Klicken Sie hier, wenn Sie sich für ein Digitalabo der SZ interessieren, um unsere exklusiven Podcast-Serien zu hören: www.sz.de/mehr-podcasts [http://www.sz.de/mehr-podcasts] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Seltene Erden: China erpresst die Welt
China hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum wichtigsten Lieferanten für Seltene Erden entwickelt. In vielen Fällen ist das Land die einzige echte Option auf dem Markt dieser gar nicht so seltenen, aber äußerst schwer abzubauenden Metalle. Diese Macht wird zur Gefahr, die China nutzt: Peking beschränkt oder stoppt Ausfuhren, kontrolliert den Zugang zu Know-How, schützt sein Wissen über die Verfeinerung der Metalle und macht dem Rest der Welt damit schlicht klar, wer am längeren Hebel sitzt. Das ist besonders heikel, da Europa gerade massiv aufrüstet. Denn in modernem Kriegsgerät, in Radaranlagen und Mikrochips, sowie in Panzern und Nachtsichtgeräten sind Seltene Erden oder vergleichbare Metalle verbaut. Eine moderne Armee ohne sie ist undenkbar. Wie China zum Weltmarktführer bei Seltenen Erden wurde und über die Aufholjagd von Europa und den USA sprechen wir in der neusten Folge unseres Podcasts “Das Thema”. Die Aufnahme für diese Thema-Folge war noch vor dem Treffen von Donald Trump und Xi Jinping Ende Oktober in Südkorea, bei dem die beiden eine einjährige Handelsruhe vereinbart hatten. Nach dem Treffen wurde verkündet, dass die Exportbeschränkungen gelockert werden sollen. Wie genau diese Lockerungen aussehen sollen, weiß man aber bisher nicht. Am 5. November veröffentlichte das chinesische Finanzministerium eine Ankündigung, laut der einige Zölle auf US-amerikanische Agrarprodukte zurückgenommen werden sollen. Zum Weiterhören und -lesen: Den Text zur Recherche von Gregor Scheu und Lea Sahay finden Sie hier [https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/china-seltene-erden-handelskrieg-usa-baotou-rohstoffe-e077237/]. Die “Das Thema”-Folge über Germanium und den Drohnenabwehrschirm finden Sie auf Spotify [https://open.spotify.com/episode/0QrPKeOShYIsZlQzHCsQka?si=519180ce8d00434c] oder sz.de. [https://www.sueddeutsche.de/politik/drohnen-abfangen-podcast-das-thema-li.3323054] Wenn Sie mehr über Chinas Geschichte erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen die Podcast-Serie “Die Kiste” auf Spotify [https://open.spotify.com/show/3Fse0GYpwkw18aaSZcmBur?si=95d223c627324c66] oder sz.de [https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/panorama/verbotene-liebesbeziehung-alte-kiste-nazi-deutschland-china-podcast-e264211/]. Moderation, Redaktion: Timo Nicolas Redaktion: Lars Langenau Produktion: Imanuel Pedersen Klicken Sie hier, wenn Sie sich für ein Digitalabo der SZ interessieren, um unsere exklusiven Podcast-Serien zu hören: www.sz.de/mehr-podcasts [http://www.sz.de/mehr-podcasts] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Greta - Die Geschichte einer Eskalation
“Greta“ - Die Geschichte einer Eskalation“ ist ein neuer Podcast aus der SZ-Redaktion. Folge 1 können Sie jetzt hier in voller Länge hören, alle weiteren erscheinen auf www.sz.de/greta [https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/gesellschaft/greta-thunberg-fridays-for-future-gaza-israel-podcast-klimaaktivistin-e295746/?utm_source=Shortlink&utm_campaign=greta-podcast&utm_content=greta&em=pc] oder auf Spotify [https://open.spotify.com/show/27ONMlIW8141z4UkUqi6pw]. Sie benötigen für alle weiteren Folgen ein SZ-Digitalabo oder ein Probeabo. Mit 15 Jahren wird Greta Thunberg zur Ikone. Ihre Schulstreiks lösen die Fridays-for-Future-Bewegung aus – und bringen das Thema Klimaschutz weltweit auf die Agenda. Sieben Jahre später ist das Mädchen von damals eine Frau – und macht mit ihrem Engagement für Gaza Schlagzeilen. Vor allem in Deutschland wird Greta Thunberg Antisemitismus vorgeworfen. Die SZ-Journalistin Vera Schroeder möchte verstehen, wie aus der Heldin eine Figur wurde, die immer stärker polarisiert. In einer Zeit, in der die Klimaziele in weite Ferne rücken, macht sie sich auf eine sehr persönliche Spurensuche. Und erzählt die Geschichte von Thunbergs einzigartigem Aufstieg noch mal neu. Hat sich Greta Thunberg wirklich so verändert? Oder die Welt, in der wir leben? Eine Podcast-Serie über die größte Klimaaktivistin aller Zeiten. Und über uns alle. Hören Sie hier die erste Folge kostenlos – alle weiteren fünf Folgen wöchentlich ab dem 23. Oktober mit SZ Plus. Die nächste reguläre Folge von "Das Thema" erscheint am 05.10.2025. Klicken Sie hier, wenn Sie sich für ein Digitalabo der SZ interessieren, um unsere exklusiven Podcast-Serien zu hören: www.sz.de/mehr-podcasts [http://www.sz.de/mehr-podcasts] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]