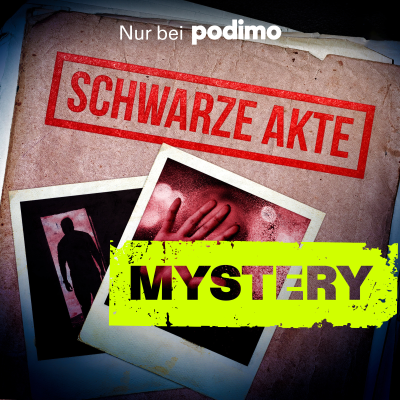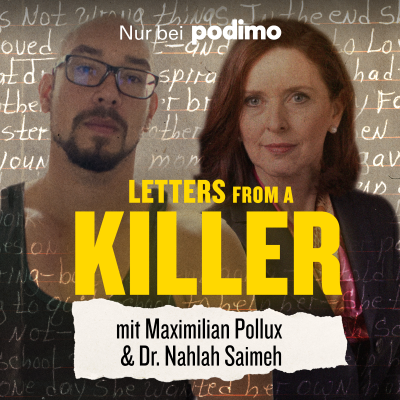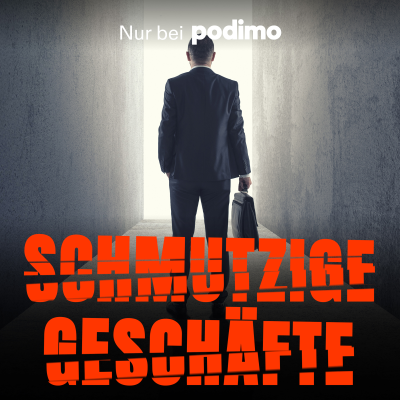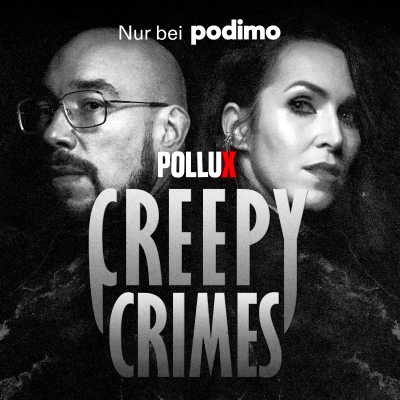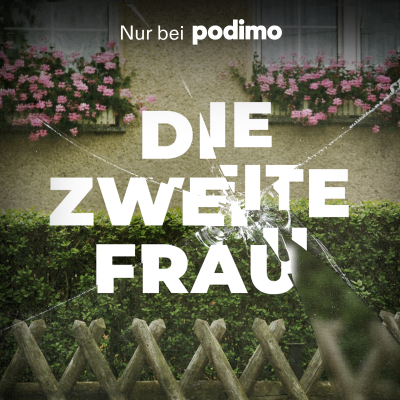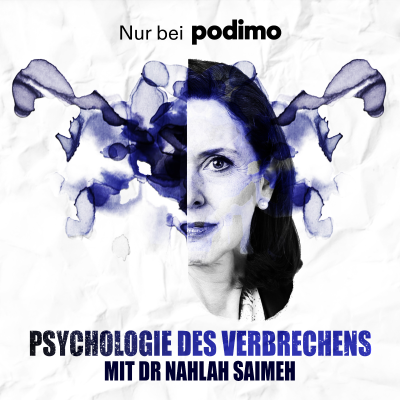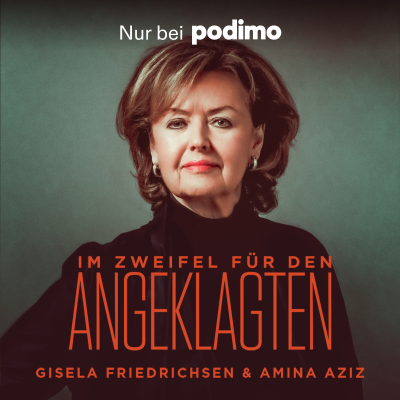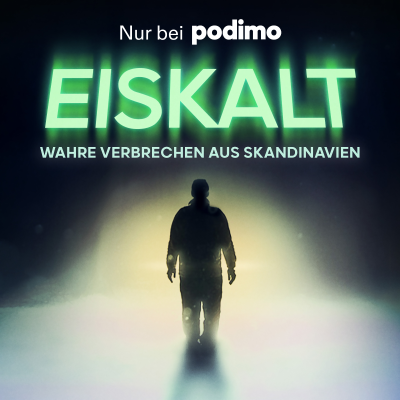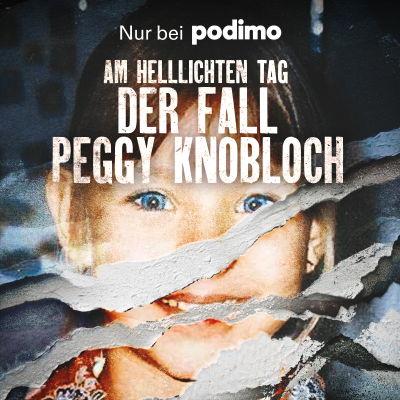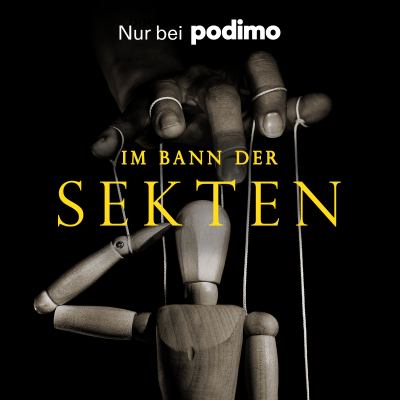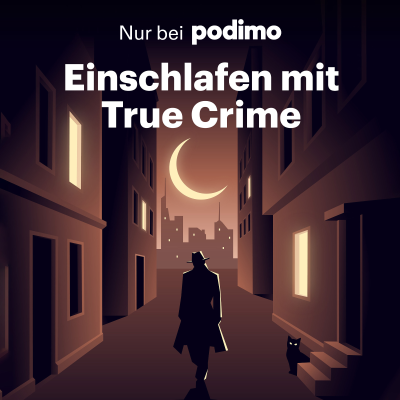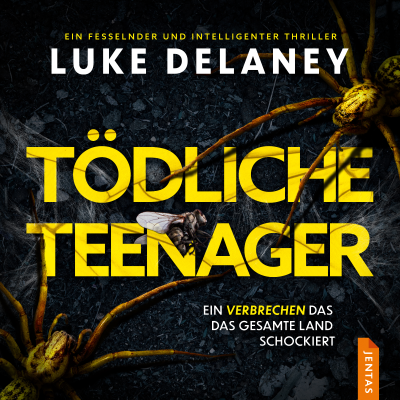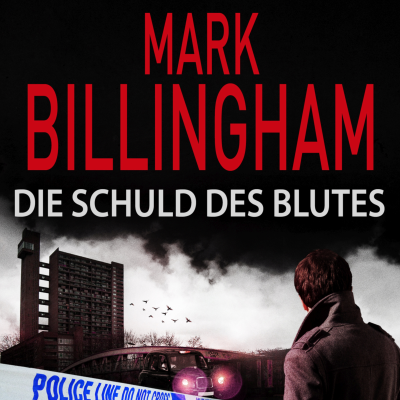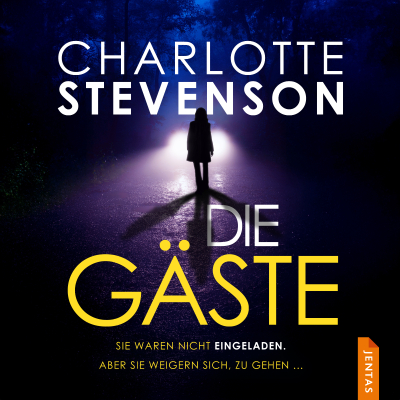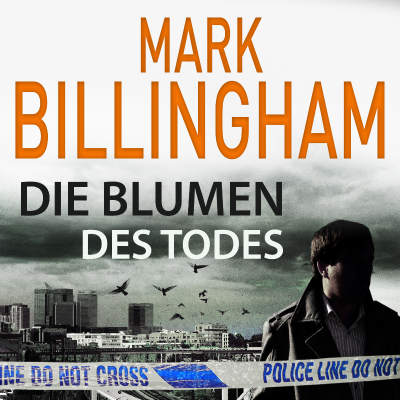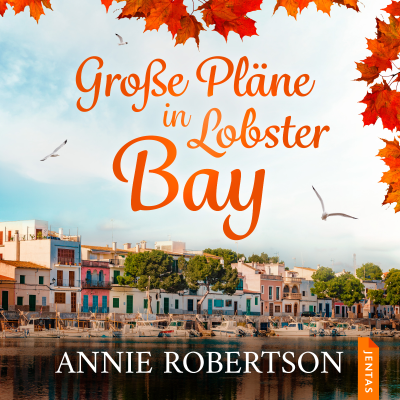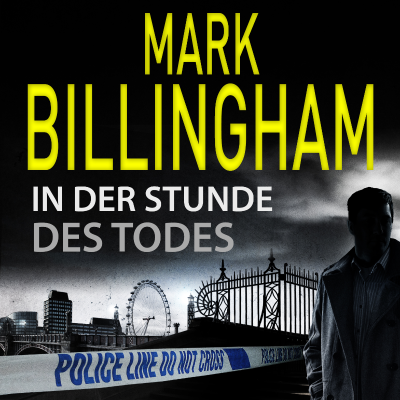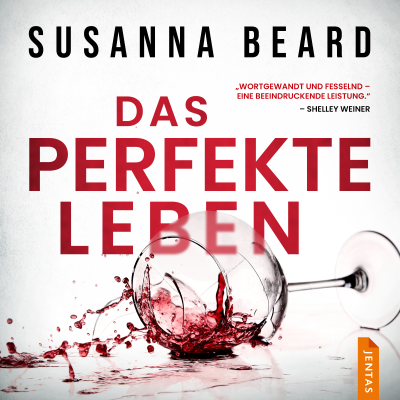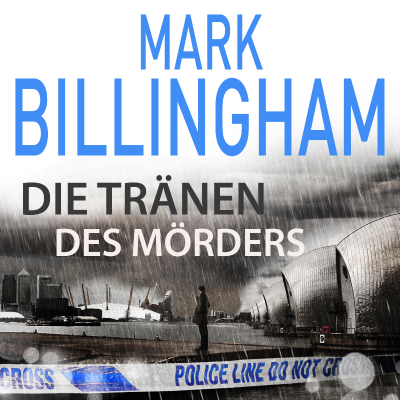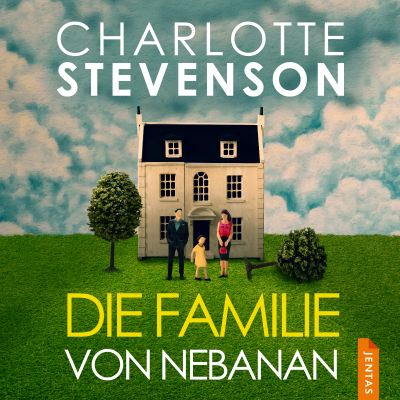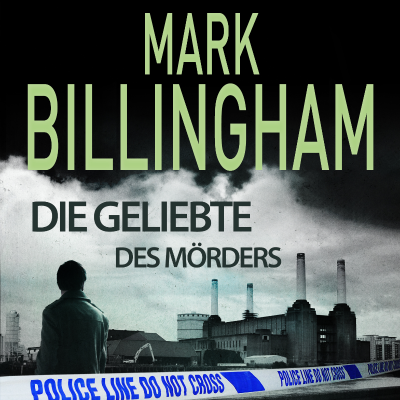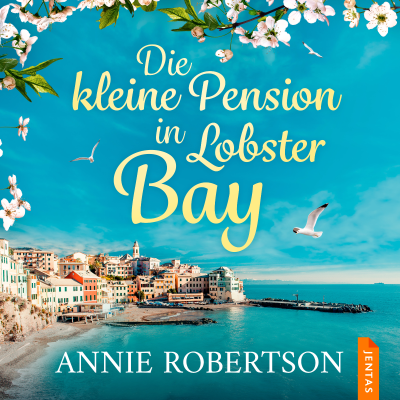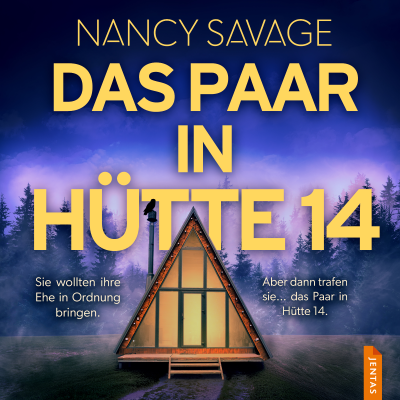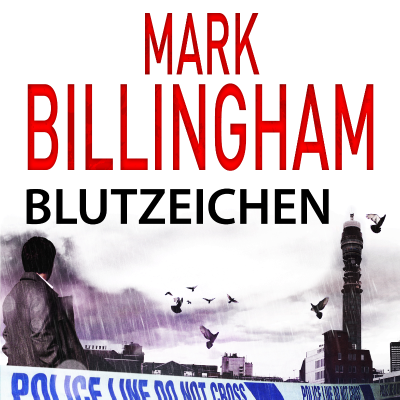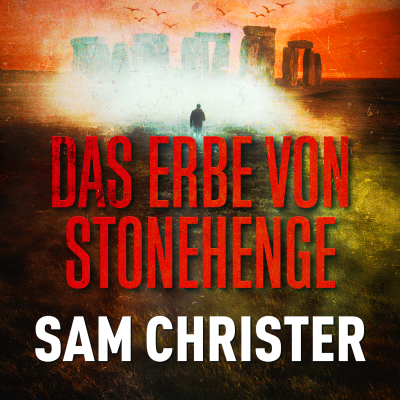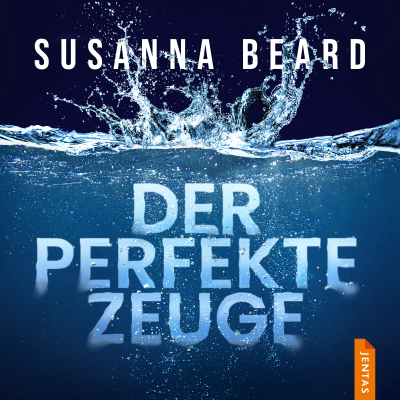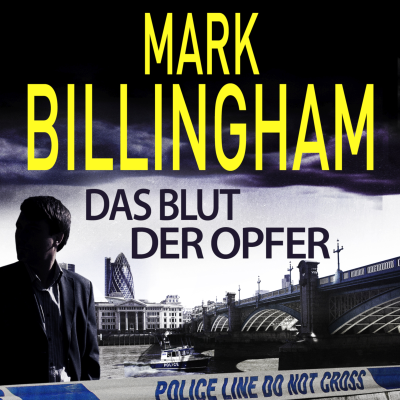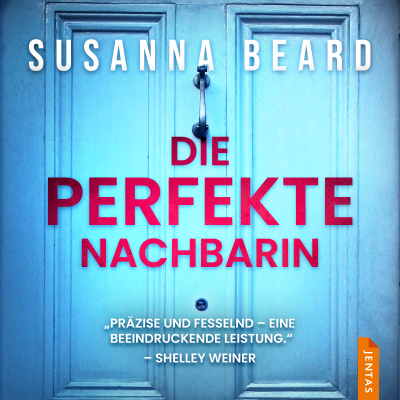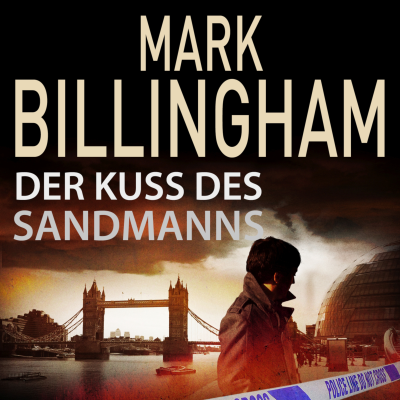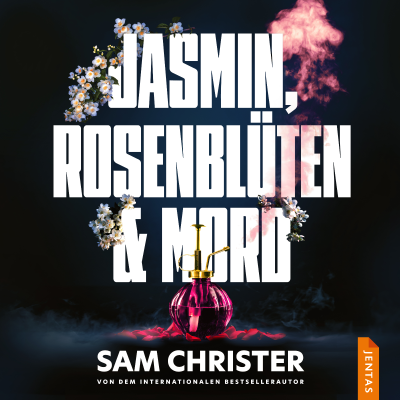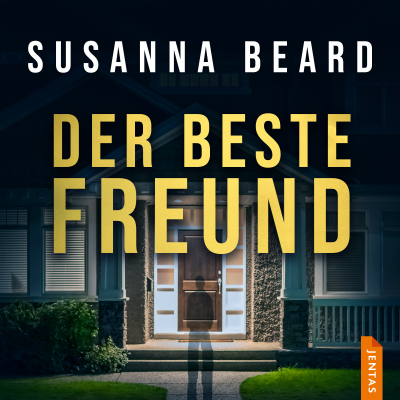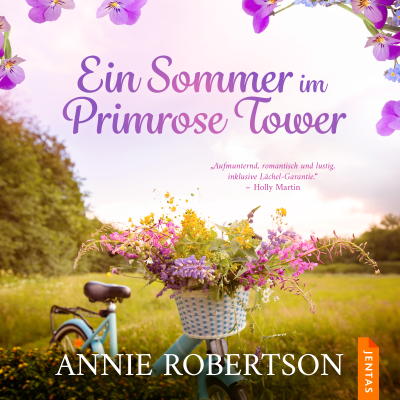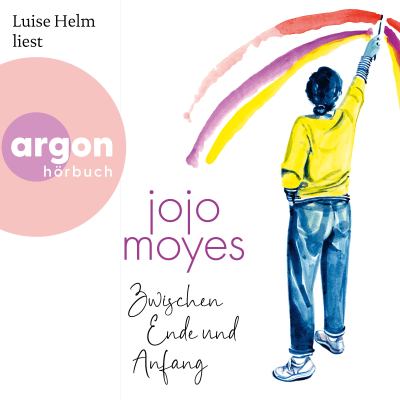ÄrzteTag
Deutsch
Gratis en Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr ÄrzteTag
ÄrzteTag - der Podcast der "Ärzte Zeitung". Wir blicken kommentierend und persönlich auf den Tag, wichtige Ereignisse und Meilensteine. Wir laden Gäste ein, mit denen wir über aktuelle Ereignisse aus Medizin, Gesundheitspolitik, Versorgungsforschung und dem ärztlichen Berufsalltag reden.
Alle Folgen
762 FolgenWie schlimm steht es um die Sicherheit der Telematikinfrastruktur, Herr Saatjohann?
Ein bisschen Provokation muss sein: Über „Noch mehr Kaos in der Telematikinfrastruktur“ hat Professor Christoph Saatjohann beim Chaos Communication Congress in Hamburg gesprochen. Immer wieder hat der ethisch arbeitende Hacker vom Chaos Computer Club, der sich an der FH Münster unter anderem mit Cybersicherheit im Medizinumfeld beschäftigt, Sicherheitslücken in der TI aufgedeckt. Dies ist ihm auch bereits im Mailing-Dienst in der TI Kommunikation im Medizinwesen, kurz KIM. Dieses Kunststück hat Saatjohann im vergangenen Jahr wiederholt und beim Kongress in Hamburg am Jahresende die Ergebnisse vorgestellt. Im „ÄrzteTag“-Podcast erläutert Saatjohann, welche Angriffsmöglichkeiten auf KIM-Mails er gefunden hat und warum Empfänger von Mails über KIM nicht ganz sicher sein können, dass diese Mails tatsächlich „sauber“ sind. Zur Sprache kommt auch, warum in der wachsenden Telematikinfrastruktur immer mehr potenzielle „Innentäter“ unterwegs sind - allein durch die immer weiter steigenden Anwenderzahlen. Auch aus diesem Grund sei es möglich, dass über KIM Phishing-Attacken auf eine Praxis vorstellbar wären. Welche Konsequenzen Ärztinnen und Ärzte und Praxisteams aus diesen möglichen Angriffsszenarien ziehen sollten und wie sie sich gegen Attacken schützen können, beschreibt der IT-Sicherheitsforscher im Gespräch. Nicht zuletzt kommen auch die Schwachstellen in Klinikinformationssystemen (KIS) und Praxisverwaltungssystemen (PVS) zur Sprache und wie eine verstärkte Regulierung helfen könnte, die Lücken zu schließen. (Dauer: 25:45 Minuten)
Wie erkenne ich Schmerzen bei Menschen mit Demenz, Professorin Miriam Kunz?
Über Selbst- und Fremdeinschätzung von Schmerzen Im „ÄrzteTag“-Podcast erklärt Professorin Miriam Kunz, Medizinische Psychologie und Soziologie, Universität Augsburg, wie sich Schmerzen bei Demenz-Patienten erfassen lassen. Worauf gilt es bei Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung zu achten? Hier gibt es weitere Informationen: GeriPAIN-Leitlinie [https://register.awmf.org/assets/guidelines/145-005l_S3_Schmerzmanagement-bei-geriatrischen-Patientinnen-in-allen-Versorgungssettings-GeriPAIN_2025-10.pdf] Beurteilung von Schmerzen bei Demenz (BESD) [https://www.schmerzgesellschaft.de/topnavi/die-gesellschaft/arbeitskreise/schmerz-und-alter/downloads] Beobachtungsinstrument für das Schmerzassessment bei alten Menschen mit Demenz (BISAD) [https://www.schmerzgesellschaft.de/fileadmin/pdf/BISAD_Kurzanleitung_2012_06.pdf] PAIC 15 Skala (Pain Assessment in Impaired Cognition) [https://paic15.com/] PAIC 15 E-Training [https://paic15.com/e-training/] Zurich Observation Pain Assessment (ZOPA) [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096433972030077X]
Wie schaffen es Praxen, die Kriterien für die neue Vorhaltepauschale zu erfüllen, Dr. Lübben?
Welche Hausarztpraxis schafft es, mindestens acht von zehn Kriterien zu erfüllen, um durch die Vorhaltepauschale(n) in Zukunft mehr Honorar zu generieren als bisher? Und wer könnte ab Januar, wenn die neue Gebührenordnungsposition nach GOP 03040 ff. in Kraft tritt, zu den Verlierern gehören? Und was müssen Praxen tun, damit sie zu den Gewinnern gehören? Mit diesen Fragen haben sich in den vergangenen Monaten die Kassenärztlichen Vereinigungen, aber auch Allgemeinarzt und Unternehmensberater Dr. Georg Lübben von der Praxisberatung AAC (Berlin) intensiv beschäftigt. Lübben hat anhand der Daten von Hunderten von Praxen simuliert, wie sich die Änderungen bei der Vorhaltepauschale, die im Sommer beschlossen worden sind, auf das Honorar auswirken werden. Ähnliches haben auch viele KVen getan – laut Lübben mit ähnlichen Ergebnissen wie er. Das Ergebnis: „Die allermeisten Praxen werden nicht verlieren“, so die Prognose Lübbens. Sie würden mindestens zwei der zehn Kriterien wie Anzahl der Hausbesuche, Geriatrie-Leistungen, Videosprechstunden oder Praxisöffnungszeiten in Randbereichen erfüllen. Acht bis zehn Prozent, so die Schätzung Lübbens auf Basis der Simulation, könnten direkt acht Kriterien erreichen und so das bisherige Honorar für die Vorhaltepauschale um 20 Punkte und damit um rund 2,50 Euro je Fall steigern. Im Podcast erläutert der Praxisberater aber auch, dass es viele Praxen gebe, die sechs oder sieben Kriterien aus dem Stand erfüllen und damit nur relativ geringen Aufwand haben würden, um auf acht erfüllte Kriterien zu kommen. Lübben führt weiter aus, inwieweit sich die Ergebnisse seiner Simulation retrospektiv über mehrere Quartale mit Simulationen aus den KVen decken. Manche Leistungen würden bereits erbracht, bei der Abrechnung gerade in großen Praxen aber teilweise vergessen. Nicht zuletzt beschreibt er, was Praxen tun können, um mehr Kriterien als bisher zu erfüllen, wie Praxen schon im Quartalsverlauf nachhalten können, wie sie bei den Kriterien aktuell dastehen, und inwieweit die Erfüllung mancher Kriterien auch den Fallwert anderweitig deutlich steigern könnte. (Dauer: 25:51 Minuten)
Was bringen die neuen Hybrid-DRG für die Praxis, Herr Henniger?
Die Ambulantisierung bei Operationen wird in Deutschland 2026 weiter vorangetrieben. Statt bisher 22 wird es dann nach Beschluss des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses 69 Hybrid-DRG geben, hinter denen 904 statt bisher 583 OPS-Codes liegen. Unter anderem sollen dann auch Appendektomien, Cholezystektomien sowie minimalinvasive Eingriffe an den Koronararterien und peripheren Gefäßen über Hybrid-DRG abgerechnet werden können. Im „ÄrzteTag“-Podcast erläutert der Vorsitzende des Berufsverbands der Niedergelassenen Chirurgen (BNC) Jan Henniger die Konsequenzen des Beschlusses und welche Bedeutung die bisher bereits gültigen Hybrid-DRG für seine Praxis in Frankfurt haben. Henniger beschreibt, wie er mit einer Klinik vor Ort zusammenarbeitet und dort den OP nutzen kann, wie sich die Aufteilung der neuen Honorare zwischen Anästhesisten und Chirurgen zunächst „einruckeln“ musste und in welchen Bereichen bereits viele Operationen nach Hybrid-DRG erbracht werden. Neue Hybrid-DRG und zusätzliche OPS-Codes, die darüber abgerechnet werden können, seien für die niedergelassenen Chirurgen kein Selbstzweck, sie müssten schon eine Verbesserung des Status quo bringen, sagt Henniger. Er verweist auf manche Fuß-Operationen, die nach der Umstellung auf Hybrid-DRG praktisch nicht mehr erbringbar gewesen seien, weil nicht kostendeckend berechnet. Hintergrund: Wegen der in die Hybrid-DRG inkludierten Sachkosten können teure Implantate, die in einer Operation verwendet werden müssen, die Erträge für die operierenden Ärztinnen und Ärzte komplett aufzehren. Henniger beschreibt, welche Auswirkungen die neuen Hybrid-DRG auf die Fallzahlen haben könnten, weil für manche Fachgruppen der Zugriff auf den Bereich der sektorengleichen Vergütung völlig neu sein werde, etwa für Kardiologen. Im Podcast wird auch deutlich, wie wichtig es zukünftig werde, die Kompetenzen zwischen ambulant und stationär tätigen Ärzten zu bündeln – und warum es schwierig sein kann, in einem akuten Fall wie einer Blinddarmentzündung ein hybrides Setting zu wählen. Auch um die Pläne, die Honorierung der Hybrid-DRG an die Vergütung der ambulanten Operationen anzugleichen, äußert sich der BNC-Chef engagiert im Podcast.
Was hilft gegen den Nachwuchs- und Fachkräftemangel in der Labormedizin, Frau Jaster und Herr Raddatz?
Woran es hängt und was dagegen zu tun wäre. In Praxen, Kliniken, Laboren und der Pflege – überall gibt es Klagen über drohenden Fachkräftemangel. Woran es hängt und was dagegen zu tun wäre, erläutern Carola Jaster und Fabian Raddaz im „ÄrzteTag“-Podcast am Beispiel der medizinischen Fachlabore. In vielen Praxen und Kliniken tun sich zunehmend Lücken in der Personaldecke auf, der Wettbewerb um das Personal wird härter. Nachwuchs ist knapp, und viele Berufsangehörige gehen auf die Rente zu. Das trifft besonders die medizinischen Fachlabore, hat jetzt eine Arbeitsgruppe der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) festgestellt. In einem vor kurzem vorgelegten Positionspapier „MT-Berufegesetz praxisnah weiterentwickeln – Qualität sichern, Fachkräfte gewinnen“ werden unter anderem fehlende bundeseinheitliche Standards in der Ausbildung, die ungleiche Finanzierung der Ausbildung, problematische Wege der Anerkennungsverfahren für internationale Fachkräfte, schwierige Bedingungen für die Berufsschulen und ein viel zu komplizierter Quereinstieg aus benachbarten Berufen beklagt. Im „ÄrzteTag“-Podcast berichten die beiden Sprecher der Arbeitsgruppe Carola Jaster, Prokuristin im Labor 28 in Berlin, und Fabian Raddatz, Geschäftsführer des Labors Berlin Charité Vivantes, über die spezielle Problematik für die Labore, die sich aus dem MT-Berufegesetz (MTBG) ergeben. Zum Beispiel die ungeklärte Finanzierung vieler Schulen oder die Regulatorik, die die Kosten der Berufsausbildung für die Labore nach oben treibt. So führten viele Faktoren dazu, dass für ein so vielfältiges Berufsbild, wie die Medizinische Technologie (MT) es bietet, Ausbildungsplätze verloren gingen, anstatt zusätzliche zu schaffen. Dabei brächten gerade die technische Entwicklung, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und auch neue Biomarker, die erforscht werden, immer neue Arbeitsfelder für MTL, so Jaster und Raddatz.