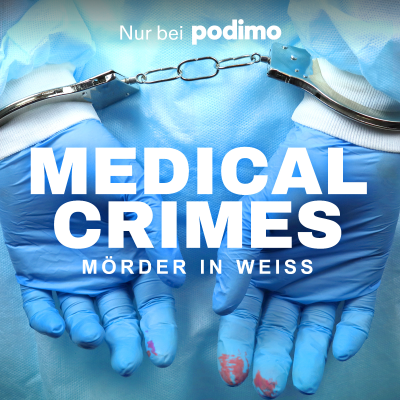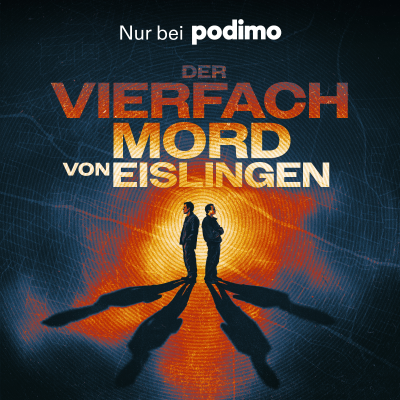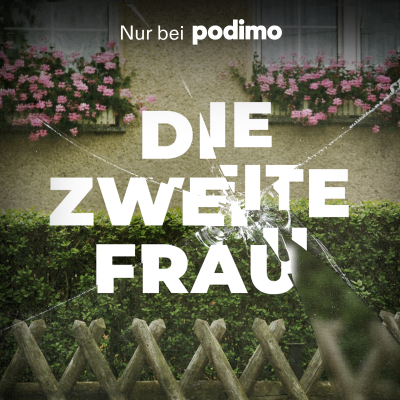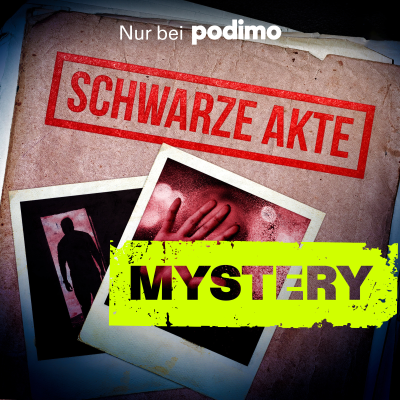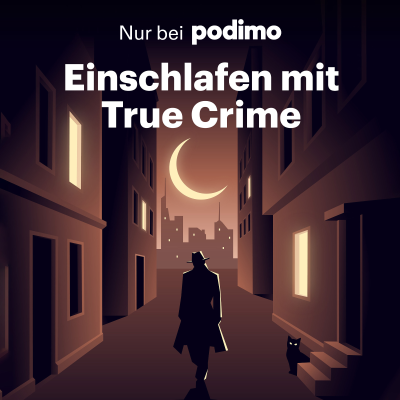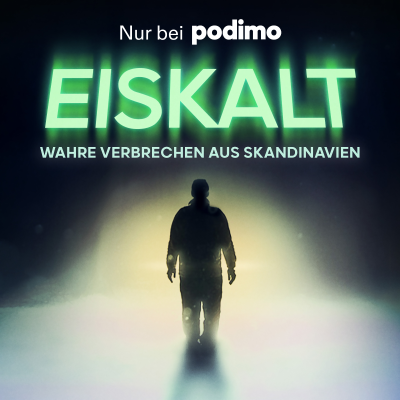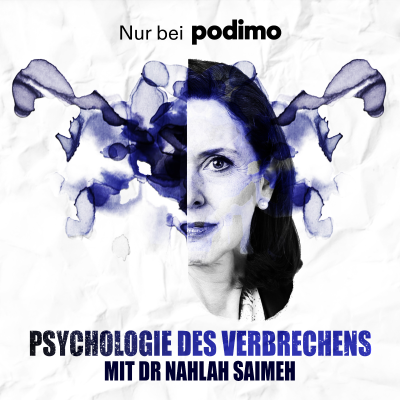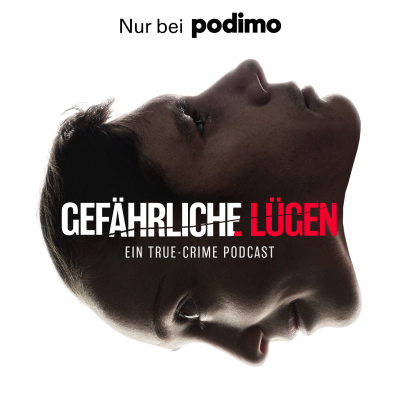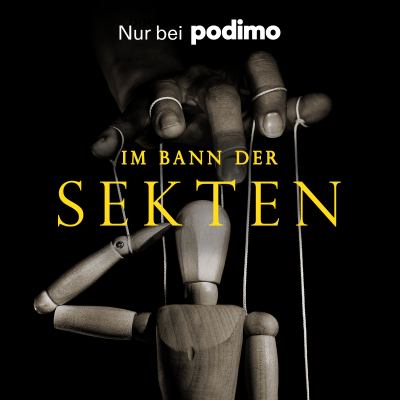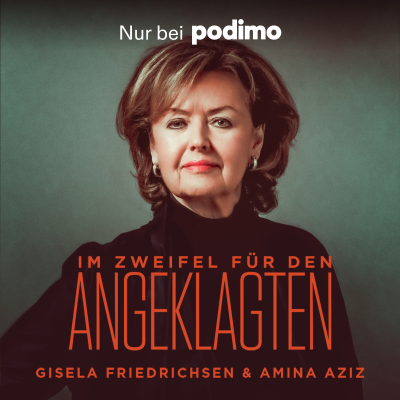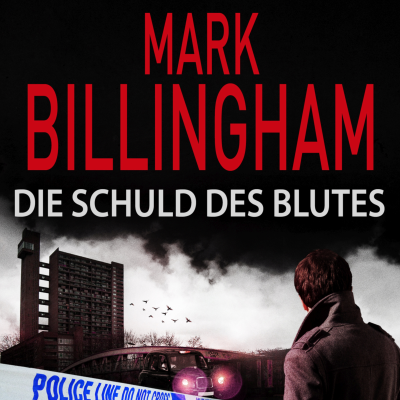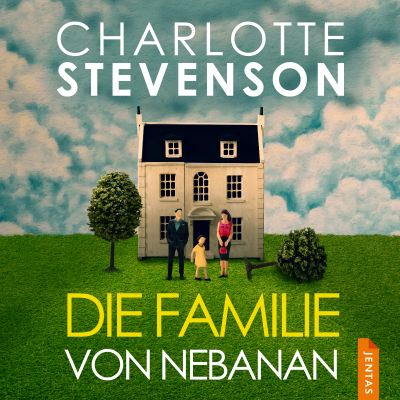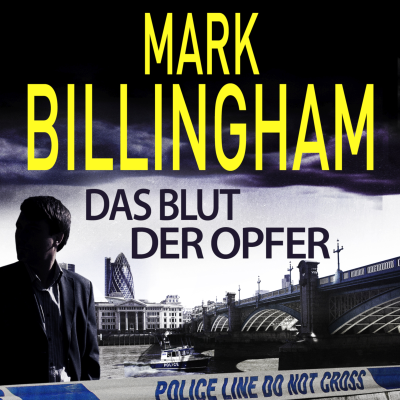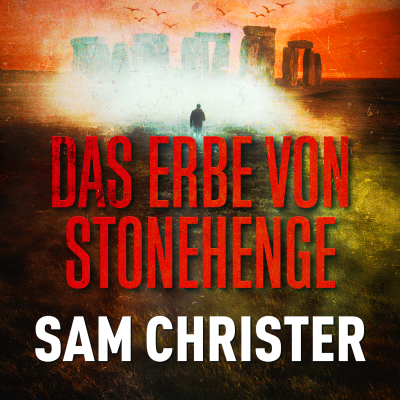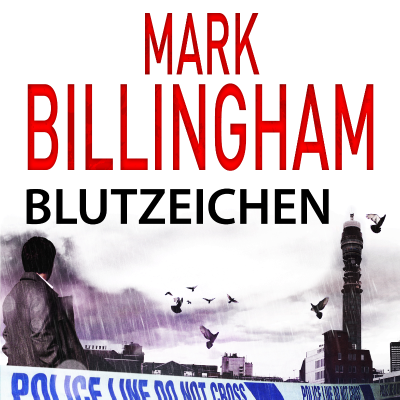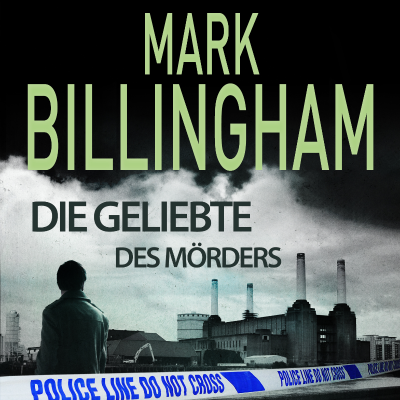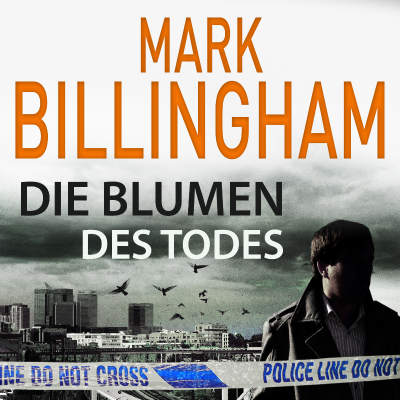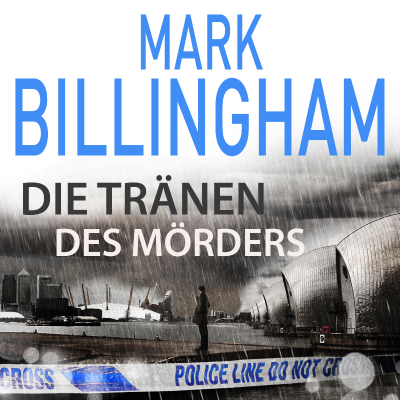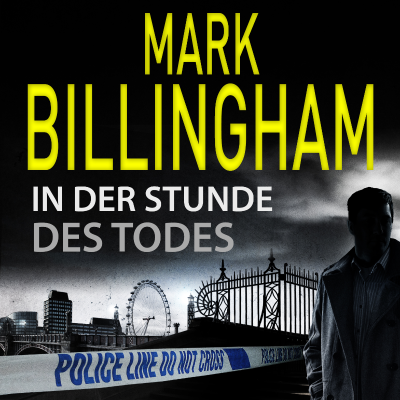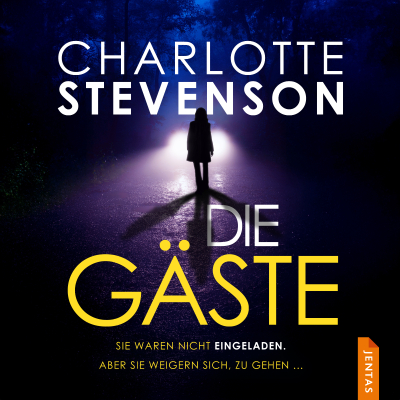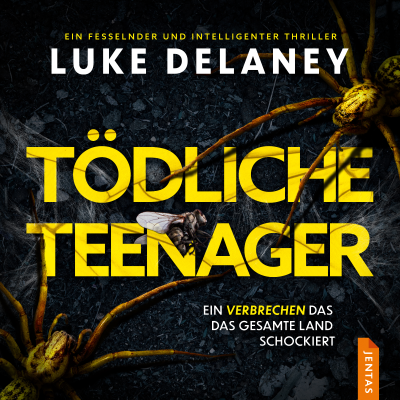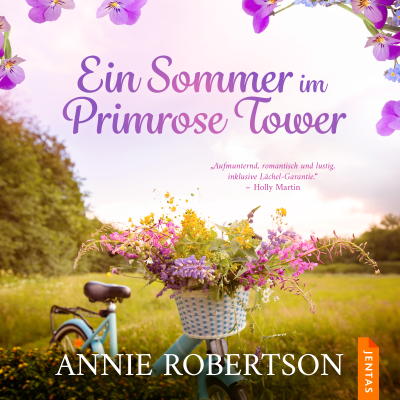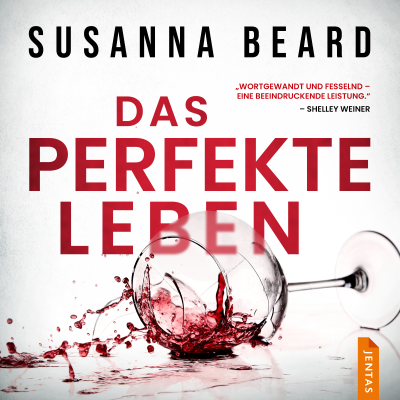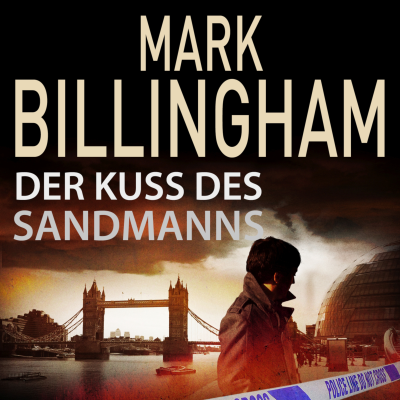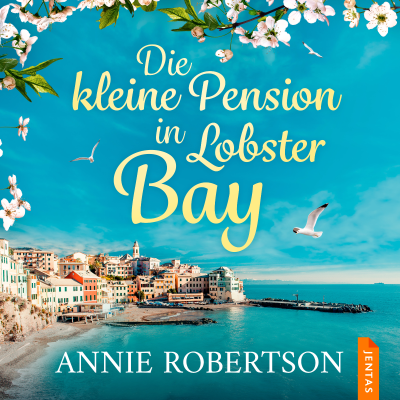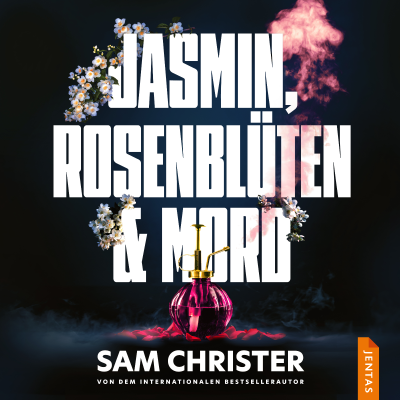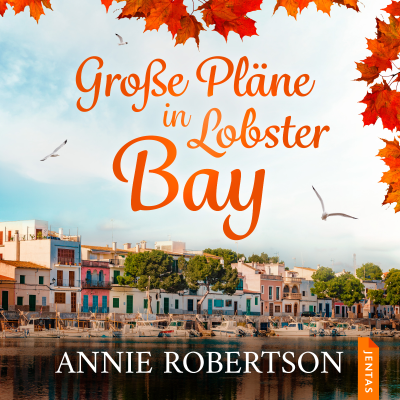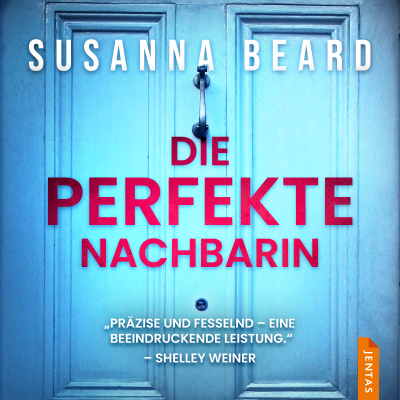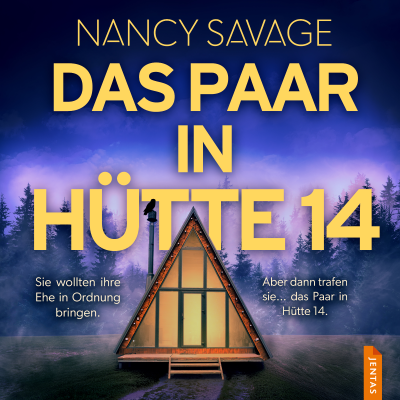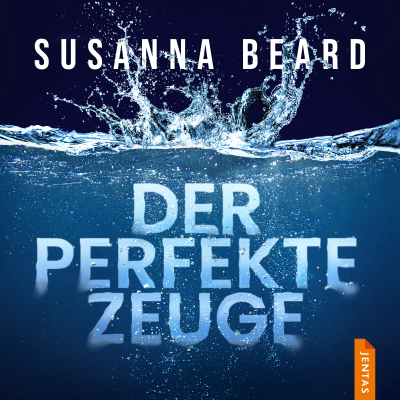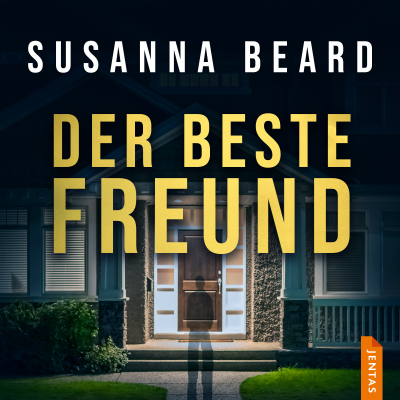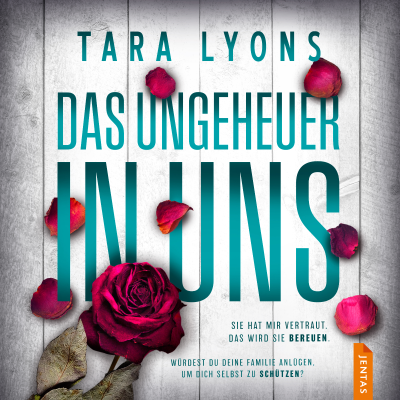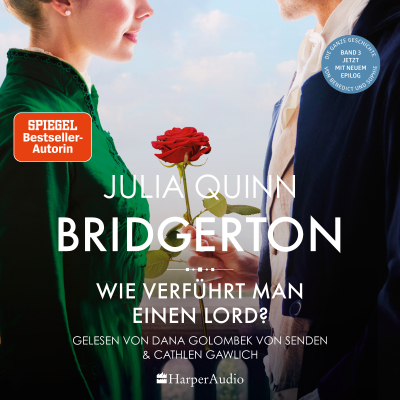Das Thema
1.2K
Deutsch
Kostenlos bei Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr Das Thema
Welches Thema bewegt diese Woche besonders? Welchen Schwerpunkt behandelt die Süddeutsche Zeitung ausführlich? Lars Langenau und Timo Nicolas diskutieren mit den Autorinnen und Autoren der SZ das Thema der Woche und die Hintergründe der Recherchen. Das Beste aus den Geschichten der SZ – zum Hören.
Alle Folgen
302 FolgenAsylzentren in Albanien: Wie human ist die EU?
Mit welcher Härte die Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten vorgeht, entsetzt derzeit viele. Doch machen wir es in der Europäischen Union besser? Gehen wir wirklich humanitärer und emphatischer mit Asylbewerbern und Migranten um? Daran sind massive Zweifel angebracht, wie Lina Verschwele, Redakteurin im SZ-Ressort Investigative Recherche nach einem Besuch in Albanien berichtet. Denn dort, außerhalb der EU, hat Italiens Regierung Migrationszentren errichten lassen, in denen geplant war, bis zu 3000 Asylanträge pro Monat in Schnellverfahren abzuhandeln. Auch wenn das zunächst juristisch gestoppt wurde, dienen diese Lager nun als Abschiebegefängnisse. Eindrücklich schildert Verschwele die ganze Härte eines Systems, das zum Modell für die gesamte EU werden könnte. Obwohl sich Berichte über Suizidversuche und Selbstverletzungen der Insassen in diesen Lagern häufen, hat das EU-Parlament mit den Stimmen von konservativen bis rechtsextremen Abgeordneten für eine Verschärfung des Asylrechts gestimmt. Und demnach sollen EU-Staaten Asylverfahren künftig komplett in sichere Drittstaaten verlagern dürfen. Verschweles Recherche aber legt nahe, dass zumindest die zwei Abschiebezentren in Albanien ein fragwürdiges Modell sind, da es Menschenrechte missachtet und keine sinnvolle Lösung für die Migrationsfrage darstellt. **Zum Weiterlesen: ** Den Text von Lina Verschwele über ihre Recherche in Albanien lesen Sie hier. [https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/europa-italien-albanien-migrationszentren-e502205/] Die Studie zum ökonomischen Wert von Zuwanderung können Sie hier nachlesen. [https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/migration-zuwanderung-deutschland-studie-kosten-sozialstaat-li.3264196] Den Report der Ärzte ohne Grenzen zur Lage auf Nauru und dem Resignation Syndrome finden Sie hier [https://www.msf.org/indefinite-despair-report-and-executive-summary-nauru] und hier die Nauru Files im Guardian. [https://www.theguardian.com/news/series/nauru-files] Antworten auf Fragen über die sogenannte Drittstaatenregelung finden Sie hier. [https://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebezentren-europa-drittstaaten-fragen-antworten-li.3322194?reduced=true] Über die Abstimmung im EU-Parlament zur Verschärfung der Asylregeln [https://www.sueddeutsche.de/politik/europaparlament-brandmauer-sozialdemokraten-weber-li.3358729] hat unser Brüssel-Korrespondent Josef Kelnberger geschrieben und ganz aktuell hier. [https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-asylrecht-regeln-migration-li.3385090] Unseren Podcast über Giorgia Melonie können Sie hier [https://www.sueddeutsche.de/politik/meloni-merz-faschismus-li.3376702] hören. Moderation, Redaktion: Lars Langenau Redaktion: Laura Terberl, Timo Nicolas Produktion: Imanuel Pedersen Klicken Sie hier, wenn Sie sich für ein Digitalabo der SZ interessieren, um unsere exklusiven Podcast-Serien zu hören: www.sz.de/mehr-podcasts [http://www.sz.de/mehr-podcasts] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Giorgia Meloni: Europas erfolgreichste Rechtspopulistin
Als die Postfaschistin Giorgia Meloni 2022 die Wahlen in Italien gewann, befürchteten viele einen Rechtsruck ohnegleichen. Doch die Realität ist komplexer: Meloni erweist sich als geschickte Außenpolitikerin, die sowohl mit der EU als auch mit Donald Trump auf Augenhöhe agiert - und Italien damit internationale Anerkennung verschafft. Unser scheidender Italien-Korrespondent Marc Beise zeichnet das Porträt einer Regierungschefin mit Widersprüchen: Einerseits sorgt sie bislang für ungewöhnliche Stabilität in einem Land chronischer Regierungskrisen, andererseits scheut sie große strukturelle Reformen, die Italien dringend bräuchte. Und während sie außenpolitisch moderate Töne anschlägt, verfolgt sie innenpolitisch eine knallharte rechte Agenda. Ist das politische klug oder eine gefährliche Camouflage? Zum Weiterlesen: Lina Verschweles Recherche zu Albaniens Abschiebezentren. [https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/europa-italien-albanien-migrationszentren-e502205/] Marc Beises Porträt von Giorgia Meloni [https://www.sueddeutsche.de/kultur/giorgia-meloni-italien-regierungschefin-einfluss-erfolg-gruende-li.3372672] Wie steht Meloni wirklich zur Ukraine? [https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-meloni-selenskij-rom-treffen-li.3352146] Moderation, Redaktion: Laura Terberl Redaktion: Timo Nicolas Produktion: Carolin Lenk Klicken Sie hier, wenn Sie sich für ein Digitalabo der SZ interessieren, um unsere exklusiven Podcast-Serien zu hören: www.sz.de/mehr-podcasts [http://www.sz.de/mehr-podcasts] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Ein Jahr Trump: So gefährlich ist die Welt geworden
Am Dienstag ist es ein Jahr her, dass Donald Trump zum zweiten Mal als Präsidenten der USA vereidigt wurde. Außenpolitisch so richtig Fahrt aufgenommen haben er und seine Administration in den vergangenen Wochen und Monaten. Es wird viel gedroht, viel geschossen und sogar ein Staatschef entführt. Das alles erinnert an imperialistische Zeiten, also an die Welt vor 100, 150 Jahren, in der wenige Großmächte tun und lassen konnten, was sie wollten, solange sie den anderen Großmächten nicht auf die Füße treten. Ist das die neue Realität? Leben wir wieder in einer Zeit, in der das Völkerrecht egal ist und es nur darauf ankommt, wer das größte Kanonenboot, den dicksten Flugzeugträger und die mächtigste Rakete hat? Darüber spricht Timo Nicolas im Podcast “Das Thema” mit dem USA-Korrespondenten der SZ, Peter Burghardt in Washington. Zum Weiterhören und -lesen: Den Text “Wie eine Demokratie erlischt” über das erste Jahr von Trumps zweiter Amtszeit lesen Sie hier. [https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/usa-trump-demokratie-e202311/] Ein Porträt über den US-Außenminister Marco Rubio lesen Sie hier. [https://www.sueddeutsche.de/politik/us-aussenminister-rubio-venezuela-kuba-suedamerika-sozialismus-li.3365195] Und die Reportage aus Grönlands Hauptstadt Nuuk zusammen mit Michael Neudecker hier. [https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/groenland-trump-usa-daenemark-washington-nato-e393948/] Moderation, Redaktion: Timo Nicolas Redaktion: Lars Langenau, Ann-Marlen Hoolt Produktion: Aylin Sancak. Klicken Sie hier, wenn Sie sich für ein Digitalabo der SZ interessieren, um unsere exklusiven Podcast-Serien zu hören: www.sz.de/mehr-podcasts [http://www.sz.de/mehr-podcasts] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Was Missbrauch im Sport begünstigt
Inzwischen brechen immer mehr Opfer von Machtmissbrauch ihr Schweigen im Profi- und Breitensport. Doch es gibt Handlungsbedarf, um Athleten bereits im Vorfeld des Missbrauchs besser zu schützen. Besondere Strukturen im Sport begünstigen Übergriffe. Scheinbar kleinere Fälle werden von Tätern genutzt, um Grenzen auszutesten, bevor es dann wirklich zum schweren Missbrauch kommt, sagt Johannes Knuth. Es herrsche ein starkes Machtgefälle zwischen Tätern und Opfern. Der Redakteur des SZ-Sportressorts befürwortet die Einrichtung einer unabhängigen Anlaufstelle für Betroffene sowie ein Trainerregister, um Täter nicht unerkannt von Verein zu Verein wechseln zu lassen. Zum Weiterlesen: Einen Text von Johannes Knuth über die ungenügende Opferhilfe im deutschen Sport lesen Sie hier. [https://www.sueddeutsche.de/sport/sportpolitik-dosb-kritik-thomas-de-maiziere-ethik-li.3350872] Hier lesen Sie Knuths Text über das Ringen um ein unabhängiges Zentrum für “Safe Sport”. [https://www.sueddeutsche.de/sport/deutschland-safe-sport-zentrum-schutz-gewalt-li.3325933] Moderation, Redaktion: Lars Langenau Redaktion: Timo Nicolas, Laura Terberl Produktion: Imanuel Pedersen Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ZDF, NDR, SWR, ARD-Sportschau. Klicken Sie hier, wenn Sie sich für ein Digitalabo der SZ interessieren, um unsere exklusiven Podcast-Serien zu hören: www.sz.de/mehr-podcasts [http://www.sz.de/mehr-podcasts] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]
Zweckbündnisse unter Druck – Was prägt die neuen Koalitionen in Österreich und Deutschland? (Live-Aufzeichnung)
Österreich und Deutschland werden seit diesem Frühjahr von Koalitionen regiert, die so eigentlich nicht zusammenarbeiten wollten. In beiden Ländern haben sich Zweckbündnisse gebildet. Auf der einen Seite aus Union und SPD. Und auf der anderen aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen NEOS. Diese Zweckbündnisse regieren vor allem deshalb zusammen, weil die rechten Konkurrenten AfD und FPÖ viele Stimmen gewinnen konnten. Wie diese Regierungen unter einem schwierigen politischen und wirtschaftlichen Klima zusammenarbeiten und wie sie mit der momentanen sicherheitspolitischen Lage umgehen, damit beschäftigt sich diese Folge von Das Thema, diesmal mit einer Live-Aufzeichnung von der Wiener Buchmesse. Das Gespräch wurde am 16. November geführt. Mit dabei waren Verena Mayer, SZ-Österreich Korrespondentin, Velina Tchakarova, Geopolitikexpertin und Vinzent-Vitus Leitgeb, der im Politik-Ressort der SZ über Bildungsthemen berichtet. Den Österreich-Newsletter der Süddeutschen Zeitung können Sie unter sz.de/oesterreich [sz.de/oesterreich] kostenlos abonnieren. Die nächste reguläre Folge von "Das Thema" erscheint am 14.01.2026. Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner finden Sie HIER [https://cmk.sueddeutsche.de/cms/articles/15600/anzeige/podcast-werbepartnerinnen/hier-gibt-s-weitere-infos-zu-den-angeboten-unserer-werbepartner-innen]